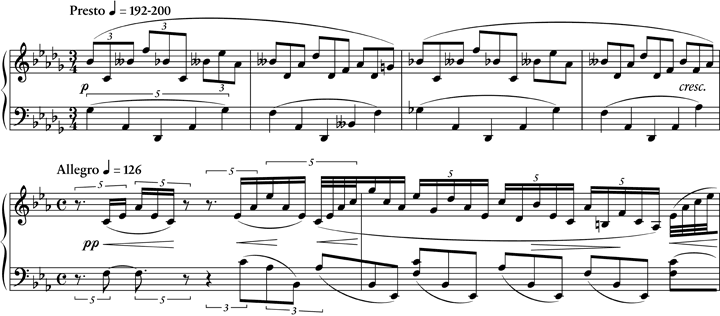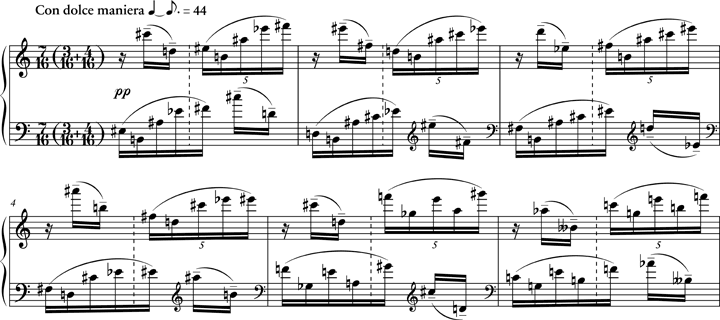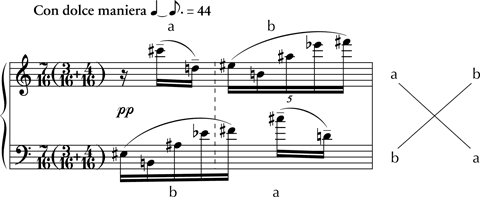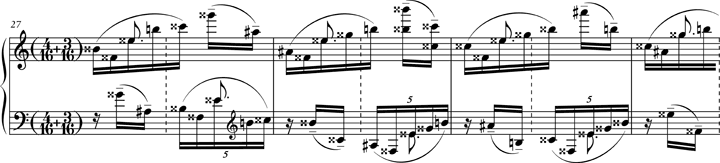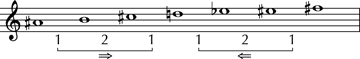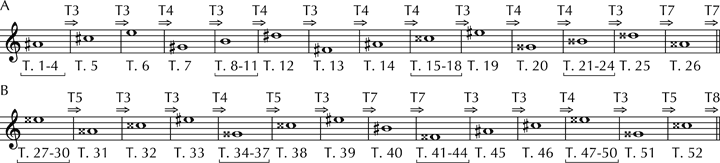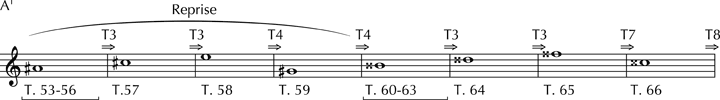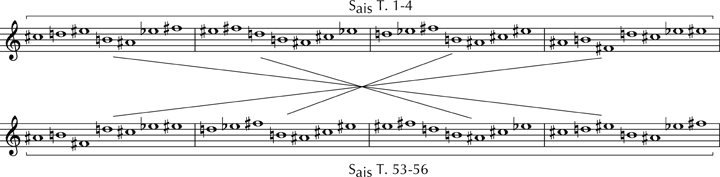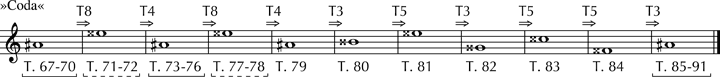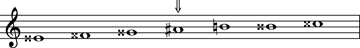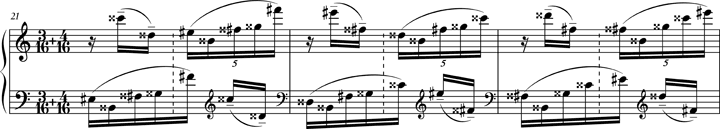Theoriebildung in ästhetischer Praxis[1]
Nikolai A. Roslawez’ zweite Klavier-Etüde Pianissimo aus den Trois Études (1914)
Michael Koch
Die von Alexander Skrjabin stark geprägte russische Avantgarde der 1910er und 1920er Jahre zeichnet sich insbesondere durch das Experimentieren mit Verfahren nichttonaler Tonhöhenorganisation aus. Posttonales Komponieren trägt dabei von Beginn an rationale, systemhafte und konzeptuelle Züge, die auf den Ebenen der Tonhöhenorganisation und der Formbildung wirksam werden. Ohne dass in Moskauer oder Petersburger Konservatoriumskreisen eine Schulbildung bzw. eine pädagogische Vermittlung derartiger Verfahren angestrebt wurde, bildet sich ein experimentelles (Klavier-)repertoire heraus, in welchem die Komponisten individuelle Theorien regelrecht demonstrieren bzw. in ästhetischer Praxis erproben. Die zweite der 1914 von Nikolai Roslawez komponierten Trois Études weist in besonderem Maße Gestaltungsmittel auf, die es erlauben, ihre augenscheinliche Hermetik zu durchbrechen und die unter der strukturellen Oberfläche verborgenen Kompositionsprinzipien, ihre Ästhetik und Technologie zu erkennen und freizulegen.
The Russian avant-garde of the 1910s and the 1920s was strongly influenced by Scriabin and is marked by experimental procedures of non-tonal pitch-organization. From the start, Russian post-tonal composition was characterised by rational, proto-serial and conceptual features, which affected parameters of pitch-organization and formal structure. Although there had been no institutionalised schooling or formal teaching of such methods in Saint Petersburg and Moscow, an experimental (piano-)repertoire evolved within conservatory circles where composers paraded their theories and put them to the test as an ›aesthetic praxis‹. The second of Nikolai Roslawez’ Trois Études (1914), in particular, is characterised by techniques that allow one to penetrate its apparent hermetic surface and to identify and demonstrate the underlying compositional structure and aesthetic principles.
»Kunst ist nicht nur eine Tätigkeit des Künstlers, sondern auch desjenigen, an den sie sich wendet. So wie sich der Künstler bei der Bezwingung des Materials und seiner formalen Organisation abgemüht hat, so soll sich auch derjenige abmühen, der sie aufnehmen möchte.«[2]
Die Ablösung von tonalen Normen Ende des 19. Jahrhunderts ließ in Russland die Suche nach neuen Formen der Tonhöhenorganisation und Gestaltungsprinzipien der musikalischen Formbildung zu einem immer dringlicheren Problem werden. Früher als in Mitteleuropa, wo insbesondere die Komponisten der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg erst in den 1920er Jahren nach einer (krisenhaften) Phase freier Atonalität zu einer theoriefähigen Methode der Tonhöhenorganisation von systematischem Anspruch gelangten, zeichnen sich in Russland den Tonalitätsverlust kompensierende systematisch-theoretische Ansätze bereits zu Beginn der 1910er Jahre ab. Diese neuen Konzepte werden jedoch nicht ausschließlich in Form von Traktaten oder Essays formuliert, sondern vor allem auch in Kompositionen demonstrativen Charakters, welche die neuartigen Verfahren der Tonhöhenorganisation in ästhetischer Praxis quasi vorführen. Obgleich die russische musikalische Avantgarde der 1910er und 1920er Jahre eine eigenständige Parallelerscheinung zu mitteleuropäischen Avantgardebewegungen darstellt, ist sie in der Anerkennung ihrer Protagonisten aufgrund der sowjetischen Kulturpolitik kaum angemessen rezipiert worden.[3] Dieses Rezeptionsdefizit verweigert bis heute mehr als einer ganzen Komponistengeneration und ihrem Erbe eine angemessene Würdigung durch die westliche Musikwissenschaft und -theorie. Erst seit dem Erscheinen von Gojowys Studie[4] (1980) setzte eine umfassendere Aufarbeitung im deutsch- und englischsprachigen Raum ein, die Forschungsarbeiten, Editionen[5] und in jüngster Zeit auch CD-Produktionen[6] hervorbrachte.
Vor allem Skrjabins harmonische Sprache in ihrer systemhaften Gestalt[7] beeinflusste die Entwicklung der russischen Avantgardebewegung und wirkte sich als ein Theoriebildung fördernder Katalysator aus. In Russland avancierte im unmittelbaren Anschluss an Skrjabin[8] das individuelle Verfahren, die »eigene Theorie«, zum Signum kompositorischer Originalität, sodass sich in der russischen Musikszene eine Art früher Konzeptualismus ausbildet.[9] Obgleich Skrjabin sein Verfahren nicht in einer ›Harmonielehre‹ theoretisch fixierte und ihm aufgrund seiner radikal-individualistischen Kunstauffassung eine private oder gar institutionelle Vermittlung seiner Errungenschaften wohl fernlag, hat er doch in seinen Werken in künstlerischer Form Materialkonfigurationen hinterlegt, die der nachfolgenden Generation als hinreichend theoriefähige Vorarbeit erscheinen mussten, um daraus verschiedene aus damaliger Sicht ästhetisch legitime Systematiken nicht-tonaler Tonhöhenorganisation zu gewinnen.[10] Skrjabins Kompositionen trugen gewissermaßen ›Systemcharakter‹ und gerade diese Vermittlungsform neuer theoretischer Ansätze sollte in einem bestimmten Sinne in dieser Epoche Schule machen.
Fraglos können Nikolai A. Roslawez (1881–1944) und sein seit den frühen 1910er Jahren entwickeltes ›Neues System der Tonorganisation‹ als bedeutendste Erscheinungen dieser Epoche gelten.[11] Jenes Tonsystem verwirklicht der Komponist zunächst innerhalb von Kompositionen, die in der souveränen handwerklichen Verfügung über die neuen Mittel und einer stimmig erscheinenden Konvergenz von Materialebene, Oberflächenfaktur und Formbildung einen hohen ästhetischen Rang beanspruchen dürfen. Wie Skrjabins späte Werke weisen auch diese Stücke Systemcharakter auf[12], ohne dass der Komponist zu dieser Zeit bereits eine Theorie seiner Verfahrensweise öffentlich niedergelegt hätte.[13] Die Klangzentrumstechnik[14] Skjrabins wird hier in einen ungleich höheren Grad rationaler Verfügung überführt, indem eine aus dem chromatischen Total planvoll ausgewählte Menge von in der Regel sechs bis acht (gelegentlich auch mehr) Tönen gebildet wird, die sich jedoch nicht wie bei Skrjabin auf nur einen Idealtypus mit verschiedenen Varianten zurückführen lässt, sondern von Werk zu Werk neu gefunden und durch planvolle Transpositionsfolgen zur Formbildung eingesetzt wird.[15] Roslawez’ ›Neues System der Tonorganisation‹ beruht demnach auf einem proto-seriellen Verfahren transponierender Tonkomplexe, für die er spätestens zu Beginn der 1920er Jahre selbst den Terminus ›Synthetakkorde‹ einführte.[16]
Die Analyse von Roslawez’ Etüde Nr 2 (Pianissimo) soll nun demonstrieren, in welch progressiver Form sich sowohl konstruktivistische als auch spekulative Elemente russischen Musikdenkens in seiner frühen Kompositionspraxis (um 1914) bereits innovativ und vollgültig niederschlagen. Anhand verschiedener Eigenschaften des untersuchten Beispiels wird gezeigt, dass Werke solch mustergültig-demonstrativen Charakters selbst als Teil eines zeitgenössischen theoretischen Diskurses zu begreifen sind, indem diese den theoretisch-ästhetischen Stand des Komponierens eigentlich zum Gegenstand werden lassen, sozusagen Theorie in ästhetisiertem Gewand sind.
Analyse I: Oberflächenstruktur
Die Etüde Nr 2 (Pianissimo)[17] aus den 1914 komponierten Trois Études folgt äußerlich dem Satztypus der poetischen Klavieretüde des 19. Jahrhunderts in ihrer charakteristischen Skrjabinschen Prägung (vgl. Bsp. 1). Insbesondere dienen dessen Sammlungen op. 42 und 65 hier insofern als Vorbild, als in ihnen zum einen verschiedene rhythmische Konfliktoppositionen und metrische Experimente eine übergeordnete Rolle spielen, zum anderen, wie in den drei Etüden op. 65, mit spezifischen Materialbeschränkungen operiert wird[18] – Aspekte, die auch für die vorliegende Etüde von zentraler Bedeutung sind.
Beispiel 1: Alexander N. Skrjabin, Etüden op. 42/1, T. 1–4, und op. 42/8, T. 1/2
Als übergeordnete Gestaltungsidee liegt Roslawez’ Etüde typischerweise ein sich auf das gesamte Stück erstreckendes motorisches Satzmuster zugrunde, das eine dichte Konfliktrhythmik innerhalb eines zusammengesetzten Metrums ausprägt (siehe Bsp. 2). Als pianistisch taktiler Etüden-Aspekt darf neben der konfliktrhythmischen Verschränkung wohl die relativ weite Spreizung beider Hände begriffen werden. Der zusammengesetzte Siebener-Takt (3+4 Sechzehntel) wird dadurch ausdifferenziert, dass den ersten vier Sechzehnteln der linken Hand in der rechten zunächst eine ternäre Gruppe, den folgenden drei Sechzehnteln der Linken in der Rechten eine Quintolengruppe gegenübergestellt wird. Die im Takt angezeigte gestrichelte Linie legt eigentlich eine Zusammensetzung 4+3 nahe. Möglicherweise aber intendiert der Komponist eine weitere Ausdifferenzierung gerade dadurch, dass das letzte Sechzehntel der ersten Fünfergruppe diese gestrichelte Linie überschreitet, was sich allerdings auf Ausführung und Klangergebnis kaum hörbar auswirkt und deshalb wohl besser als eine Art ›Augenmusik‹[19] verstanden werden sollte.
Beispiel 2: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2 (Pianissimo) aus Trois Études (1914), T. 1–6
Die ganze rhythmische Raffinesse Skrjabins, in deren Tradition sich Roslawez hier stellt, strebt danach, interpretationspraktische Manieren romantisch-expressiver Pianistik in ein konkretes, fixes Satzbild zu überführen. Pianistische Gewohnheiten romantischer Interpretationsästhetik, wie z.B. jene, exponierte Melodietöne der Rechten gegenüber dem Bass minimal verzögert nachschlagen zu lassen, werden zur Maxime einer fragilen und nervös überexpressiven Agogik, die nun in einer extrem ausdifferenzierten rhythmischen Notation selbst zum Parameter kompositorischer Originalität wird. Die Beschaffenheit der Faktur zeigt ferner eine ganz bestimmte strukturelle Ordnung: beide Hände werden in der Art eines chiastischen Imitationsmodells aufeinander bezogen, sodass man das Satzprinzip auch als ›Invention im doppelten Kontrapunkt‹ begreifen darf (siehe Bsp. 3).
Beispiel 3: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, Kreuzstellung der Satzelemente
Obgleich die Skrjabinschen Vorbilder, die man hier vermuten darf, eine solche Art satztechnischer Verdichtung nicht kennen, besteht eine auffällige Verwandtschaft in der pianistisch-taktilen Beschaffenheit dieses Satzmusters, die sich erst vollständig offenbart, sobald man das Stück einmal selbst unter den Händen hat: Das ständige Ineinandergreifen der Daumenregion wird schon von Schibli als stilprägendes Charakteristikum von Skrjabins Klavierstil benannt.[20] Der großformale Satzverlauf lässt sich in drei Teile zergliedern, die der Komponist durch Doppelstriche und Zäsurhäkchen anzeigt, wodurch sich die folgende Taktordnung ergibt: A (T. 1–26) – B (T. 27–52) – A’ (T. 53–93; dieser Teil inklusive ›Coda‹-Abschnitt ab T. 67, dessen Formfunktion sich jedoch wesentlich auf der Materialebene erschließt und in der Oberflächenfaktur nicht hervortritt).
Die Gestaltung des B-Teils bezieht sich auf A durch einen vorgenommenen ›Stimmtausch‹ im Imitationsmodell; gleichzeitig wird die pianistische Ausführung nun durch das Eintreten einer Liegestimme und eingestreute Oktaven erschwert[21], die jedoch dem Satzmuster substanziell nichts Neues hinzufügen (siehe Bsp. 4). Der dritte Teil, A’, stellt das Ausgangsmuster wieder her, behält aber die Liegestimme bei. Der Reprisencharakter dieser Stelle wird unten ausführlich erläutert.
Beispiel 4: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, T.27–29, Beginn des B-Teils; ›Stimmtausch‹, separat gehalste Liegestimmen (punktierte Achtel) und eingestreute Oktaven
Würde man versuchen, die leitende ›geistige‹ Idee der Etüde näher sprachlich zu erfassen, so ließe sich vielleicht sagen, dass durch das klangliche Kreisen hier ein unbestimmter psychischer Zustand des Dämmerns oder Deliriums abgebildet wird. Die Musik überführt in eine eigentümliche Ausdruckssphäre aus resignativer Monotonie und tranceähnlicher Meditation, angedeutet wird eine andere Bewusstseinsregion als die des Wachens, eine Art ›Traumeswirren‹, wenn man so will.[22] Herbeigeführt werden diese Assoziationen durch musikalische Mittel, die auf rhythmischer wie harmonischer Ebene eine besondere Form von Haltlosigkeit erzeugen. Es gilt offenbar, die ordnende Metrik des einfachen Akzentstufentakts zu überwinden und den musikalischen Fluss in einem schwerelosen Schwebezustand zu halten.[23] Dies wiederum konvergiert mit dem global sich entfaltenden Klangbild, das insgesamt jede Art deutlicher Zäsurbildung (etwa im Sinne einer ›Kadenz‹) oder schärfere Akzentuierung bestimmter Satzelemente vermeidet, und stattdessen als Mäandern durch den Tonraum beschrieben werden kann. Die im ersten Takt eingeführte dynamische Vorschrift (Pianissimo) wird im Rahmen des Gesamtverlaufs nicht ein einziges Mal modifiziert, auch das Fehlen lokaler dynamischer Entwicklungen ist auffällig, was insgesamt für Roslawez’ Werke untypisch ist. Aus der extremen Stereotypie und Entwicklungslosigkeit des eingangs eingeführten Taktmodells sowie des Festhaltens an der zu Beginn etablierten dynamischen Vorgabe über die Gesamtdistanz resultiert eine Ereignisarmut, die den Blick des Betrachters unmittelbar auf die Materialebene selbst lenkt, denn dort finden Vorgänge statt, die im Notat eines ›atonalen‹ (!) Klavierwerks nicht nur Doppelkreuze, sondern ab T. 21 auch Tripelkreuze notwendig machen.
Analyse II: Tonmaterial und Substruktur
Das von Roslawez verwendete Tonmaterial und seine formbildende Handhabung können am leichtesten in einigen Basisbegriffen der Pitch-Class set theory beschrieben werden, da zwischen Roslawez’ Systematik und den von Allen Forte eingeführten Analyseinstrumenten eine gewisse Verwandtschaft besteht. Die oft als problematisch deklarierten Elemente der Forte’schen Theorie – der Mangel an verbindlichen Segmentierungs-Regeln, die Behandlung von Segmentlücken, die empirische Relevanz der Inversionsäquivalenz etc.[24] – sind zumindest für den hier verhandelten Analysegegenstand nicht von Bedeutung. Als notwendige Operationen werden aus der ›pc theory‹ im Folgenden einzig die Transposition und die (im Folgenden meist taktweise fortschreitende) Sammlung und engste skalare Darstellung des anfallenden Tonmaterials (Setbildung) verwendet. Die Adäquanz der verwendeten Analysemethode ergibt sich daraus, dass Roslawez’ Verwendung des ›Synthetakkords‹ und das Konzept des ›pitch-class sets‹ strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen[25], die Abstraktionsleistung des Analyseverfahrens dem untersuchten Kompositionsverfahren also entspricht.
Der Tonvorrat des ersten Taktes besteht in einer Menge von sieben Tönen. Ihre engstmögliche skalare Darstellung ergibt ein auf ais stehendes Set, welches als auffälligste Eigenschaft Punktsymmetrie um den Ton d aufweist, wir nennen es von nun an Synthetakkord auf ais, kurz: Sais (siehe Bsp. 5).[26]
Beispiel 5: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, punktsymmetrisches Basis-Set Sais
Das Verhältnis von Satzfaktur und Material kann insofern als konsequent stimmig gelten, als die sieben Töne des Sets aufgrund des Imitationsmodells jeweils vollständig in beiden Händen auftreten. Es hat den Anschein, als wäre die Faktur unmittelbar aus der materialen Disposition gewonnen worden. Die Klanglichkeit dieser Tonmenge erscheint ›skrjabinesk‹ farbig-glitzernd durch die konkrete Anordnung ihrer Elemente im Satzbild: Zu beobachten sind Tritonusexposition und akustische Nivellierung scharfer Dissonanzen durch die Aufspreizung der im Set vorhandenen engen Intervalle in ihre weniger scharfen Komplementärformen.
Der Komponist bezieht nun die Gesamtform des Ablaufs aus einem deutlich erkennbar planvoll gestalteten Transpositionsschema dieser Tonmenge (dem einzigen in diesem Stück verwendeten Synthetakkord), welches mit der oben äußerlich vollzogenen Formeinteilung konvergiert (siehe Transpositionsplan, Bsp. 6). Tonal geschlossen wird die Form dadurch, dass der Schlussakkord wieder aus Sais gebildet wird.[27]
Beispiel 6: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, Transpositionsschema der T. 1–52 (Formteile A und B; die eckigen Klammern deuten die Plateaus an)
Der ›harmonische Rhythmus‹ ergibt sich in der Regel aus einer taktweisen Transposition[28] des Tonmaterials, wobei im Gesamtverlauf jede der zwölf möglichen Transpositionen mindestens einmal auskomponiert wird. An mehreren Stellen jedoch wird vom Prinzip taktweiser Transposition abgewichen, der ›harmonische Rhythmus‹ beruhigt sich hier für jeweils vier Takte und bildet vorübergehend ein harmonisches Plateau auf einer einzigen Transpositionsstufe. Wie der Transpositionsplan erkennen lässt, ist in den Teilen A und B die Abfolge von viertaktigen Plateaus und taktweiser Transposition regelmäßig (je zweimal Plateau + jeweils dreimal taktweise Transposition, dann je zweimal Plateau + jeweils zweimal taktweise Transposition).
Die Reprise besteht zunächst in einer Wiederaufnahme des Transpositionsschemas der Eingangstakte 1–7, also einer vollständigen ›Sinneinheit‹ des Plans. Die folgende, sieben Takte umfassende Einheit erscheint zunächst als Transposition des entsprechenden Abschnitts im A-Teil, weicht jedoch mit dem ›Transpositionssprung‹ (T7 nach T. 66) dann entscheidend vom Modell des A-Teils ab.
Beispiel 7: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, A’-Teil, ›Reprise‹
Das Reprisenplateau der Takte 53–56 (logischerweise auf Sais) weist gegenüber den Eingangstakten eine in ihrer Abstraktheit kuriose Modifikation auf, indem die taktweise sich ändernde Reihenfolge der Set-Töne im Verhältnis zu den Eingangstakten nun ›blockweise‹ krebsgängig angeordnet ist (siehe Bsp. 8).
Beispiel 8: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, krebsgängige Anordnung des Tonmaterials Sais in den Reprisentakten 53–56
Für den allerletzten Formteil (T. 67ff.) rechtfertigt sich die Bezeichnung Coda durch eine auffällige Anomalie in Anbetracht der bisher verfolgten Formprinzipien: Hier erfolgt zunächst für zwölf Takte eine Phase harmonischen Pendelns zwischen Sais (als Plateau) und Seisis (als ›Halbplateau‹ von zwei Takten Dauer). Dass das Set Seisis hier außerhalb der Norm hervorgehoben und durch das Pendeln direkt auf Sais bezogen wird, ist bereits ein Hinweis auf seine formbildende Bedeutung. Danach folgt bis zum Wiedererreichen des Schlussklanges (bestehend aus Sais) die längste Phase ohne Plateau, die man als Residuum tonaler Verfahren, als ›harmonische Verdichtung‹ im Sinne einer abschließenden Höhepunktbildung interpretieren könnte (siehe Bsp. 9). Dies wiederum korrespondiert mit dem äußerlich residual-tonal erscheinenden dreiteiligen Formbild (ideell A-B-A’+Coda).
Beispiel 9: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, Transpositionsschema der Coda
Von elf möglichen Transpositionsfortschreitungen werden im gesamten Stück lediglich fünf genutzt. Die für Skrjabins Klangtechnik so wichtige Tritonustransposition z.B. wird nicht ein einziges Mal verwendet. Sie fiele auch für den hier verwendeten Synthet-Akkord dadurch aus dem Rahmen, dass zwei Synthet-Akkorde bei T6 nur zwei gemeinsame Töne aufweisen, Roslawez aber offensichtlich die Vermittlung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sets durch mehr als zwei gemeinsame Töne vorzieht; Terztranspositionen sind quantitativ deutlich im Übergewicht (siehe Tab. 1).
Transposition | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
Häufigkeit des Auftretens in Etüde Nr. 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gemeinsame Töne bei T | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Tabelle 1: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, Transpositionsfortschreitungen des Synthetakkords, Merkmale
Obgleich Transpositionen auf allen chromatischen Stufen erscheinen[29], ist die Anzahl der Plateaustufen auf genau sieben begrenzt: ais, eisis, h, cisis, fisis, gisis und hisis. Überführt man diese Töne nun wiederum in ein Set, so offenbart sich der geheime Plan der Gesamtform wie das Herzstück einer Matrjoschka: Es ergibt sich abermals der Synthetakkord, hier nun in der Transposition auf eisis, der als punktsymmetrisches Zentrum den Ton ais enthält, den ›Grundton‹ des gesamten Stückes, wenn man so will.
Beispiel 10: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, Set mit ais als Zentrum (aus den ›Grundtönen‹ der Plateaustufen gebildet)
Nun erscheint auch die Gesamtform als verwickelte Symmetrie: Die Rahmenteile A und A’ werden durch ein Plateau auf Sais eröffnet, der Mittelteil B durch Seisis, das Set, das wiederum ais als ›Kern‹ oder ›Mittelpunkt‹ umschließt. Bezieht man die Oberflächenfaktur und die subkutanen Vorgänge aufeinander, so erscheint Symmetrie als übergeordnete sinnstiftende Idee: Auf Ebene der Großform wird eine ideelle Spiegelung durch die tonale Rahmung durch Sais erwirkt, außerdem durch die dreiteilige, reprisenartige Disposition der Formteile. In der Oberflächenstruktur sind Symmetrieaspekte greifbar durch das chiastische Imitationsschema sowie den vorgenommenen Stimmtausch im B-Teil. Halb fasslich an der Oberfläche gelegen, jedoch gleichzeitig auf einen materialen Permutationsvorgang im kompositorischen ›Hintergrund‹ rückführbar wäre außerdem die krebsläufige Konstellation zu Beginn der Reprise. Ein geometrischer Symmetrie ähnliches Verhältnis bilden darüber hinaus die beiden auf einander bezogenen Sets Sais und Seisis aus, indem der ›Grundton‹ des einen die Spiegelachse des anderen bildet. Das abstrakte Material der Substruktur tritt auf diese Weise zwingend zur Großform in Beziehung, gestiftet durch den Transpositionsplan der Plateaus, da auch dort ein Symmetrieaspekt die Beziehung der Sets zueinander definiert.
Spekulative Formtheorie – Kugel und Symmetrie
(Proto-)serielle Verfahren der Tonhöhenorganisation wie die hier aufgezeigten bestimmen den russischen Konzeptualismus der 1910er und 1920er Jahre.[30] Sie werden in Bereichen der zeitgenössischen russischen Formästhetik eigenwillig kontrastiert durch stark spekulative Denkbewegungen, wie sie z.B. Georgij E. Konjus’ (1862–1933) Theorie der ›Metrotektonik‹ auszeichnet.[31] Sie strebt an, die traditionelle Formenlehre des 19. Jahrhunderts und ihre hierarchisch der Größe nach geordneten Begriffe wie Motiv, Phrase, Satz, Periode etc. und deren bloß summarische Bestandsaufnahme zu überwinden durch eine ›höhere‹ interpretierende Formtheorie, die dominiert ist vom Prinzip symmetrischer Proportion. Auch ihre endgültige Formulierung erfolgte erst in den 1920er Jahren, jedoch kursierte sie in den Konservatoriumskreisen Moskaus nachweislich seit spätestens 1902.[32] Konjus’ Überlegungen sind, ohne dass sie hier im Detail ausgeführt werden können, charakterisiert durch ein Formverständnis, welches Musik weniger als Zeitkunst begreift, sondern stattdessen ihre statisch-architektonischen Eigenschaften hervorhebt und ihre »kristallähnliche Gesetzmäßigkeit« in eine »räumlich visuelle Symmetrie«[33] zu überführen trachtet. Trotz rationaler bzw. systematisierender und tatsächlich innovativer konstruktiver Bestrebungen weist die Metrotektonik eigentümliche esoterische Momente auf, die sie aufgrund ihrer fetischisierenden Fixierung auf Symmetrie- und Zahlenverhältnisse zwischen Taktgruppen als Instrument für die Analysepraxis fragwürdig erscheinen lassen. Wie Wehrmeier zeigt, verliert die Theorie ihre Triftigkeit in dem Moment, wo sie sich in ihrer konkreten Anwendung bewähren soll: »Als Analysemethode ist die Theorie der Metrotektonik unzulänglich und unbrauchbar, denn eine Anleitung zum planmäßigen, folgerichtigen Analysieren wird nicht gegeben. Auffällig ist der Bruch zwischen theoretischer Grundlegung und analytischem Resultat, insofern ein transformierender Nachvollzug prinzipiell verweigert wird.«[34] »Das Formverständnis Konjus’ idealisiert die Struktur der Proportionalität, deren Herstellung zur Analysepflicht wird.«[35] Die Problematik der Theorie besteht offenbar darin, dieses Ideal analytisch in traditionellen Werken (v.a. Beethovens Sinfonien und Klaviersonaten) in der angestrebten Reinheit aufzeigen und es aus ihnen herleiten zu wollen, weshalb die Metrotektonik als seriöses Analyseinstrument verworfen werden muss. Konjus’ Theorie kann aber verstanden werden als Index einer charakteristischen musikästhetischen Richtung: die Metrotektonik als Ausdruck des zeittypischen hohen Ansehens zyklischer Formkonzepte bzw. von Symmetriebildungen, die als höchstes Desiderat künstlerischen Gestaltens und Schöpfens überhaupt begriffen werden. »Die Qualität musiktheoretischer Konzepte bemisst sich nicht allein an ihrer umstandslosen analytischen Verwertbarkeit, gerade die Ohnmacht ihrer sich der Praxis widersetzenden Ideen könnte ihre reale Bedeutung sein.«[36] Dass Konjus’ Ideen offenbar auf das Musikdenken der russischen Avantgarde abgefärbt haben oder vielleicht selbst als Ausdrucksform bereits vorhandener kursierender Strömungen zu begreifen sind, belegt Leonid Sabanejews berühmtes Skrjabin-Zitat zur ›Kugelgestalt‹ der Form im Zusammenhang mit der 7. Sonate, in welchem ebenfalls ein emphatisches Verständnis von formaler Symmetrie zum Ausdruck kommt:
»Für die Form brauche ich hier genau zwei Takte«, sagte Skrjabin. »Genau zwei.« Und er erläuterte: »Es muss sich eine Form wie eine Kugel, so vollkommen wie ein Kristall bilden. Ich kann erst aufhören, wenn ich spüre, daß diese Kugel zustande gekommen ist. Jetzt fehlen daran noch zwei Takte«, dozierte er. »Ich habe stets anerkannt, daß die Mathematik bei der Komposition eine große Rolle zu spielen hat. Manchmal stelle ich beim Komponieren ausgiebige Berechnungen an, berechne die Form, den Plan der Modulationen. Hier darf es nichts Zufälliges geben. Das Ganze muß geometrisch sein, sonst entsteht keine Kristallform [...] Im Ergebnis muß sich die Form wie eine Kugel zeigen, damit der Eindruck des Abgerundeten und Vollkommenen tatsächlich zustande kommt. Die Kugel ist das geometrische Abbild höchster Vollkommenheit.«[37]
Die Verwandtschaft zu Konjus offenbart sich hier im spezifischen Wortlaut: »Kugel, so vollkommen wie ein Kristall«. Des Weiteren hebt diese Skrjabin zugeschriebene Äußerung das Moment kalkulatorischer materialer Prädisposition hervor.[38] Naturwissenschaftliche Methodik wird hier in ganz naiv positivistischer Form als Anwalt für ästhetische Stimmigkeit eingesetzt, wodurch Skrjabin, insofern das Zitat denn als authentisch gelten darf, sein eigenes Schaffen möglicherweise nachträglich zu nobilitieren trachtet. Deutlich wird jedenfalls die ästhetische Legitimität planvoller, auf symmetrische Proportionierung abzielender Formbildung hervorgehoben.
Imitatio et aemulatio
Roslawez’ Etüde Nr. 2 lässt sich insgesamt als Versuch interpretieren, das Vorbild Skrjabin auf allen Gestaltungsebenen nicht einfach epigonal zu imitieren, sondern auch zu übertreffen. Durch Analyse bildet die Musik eine Anschauungsform fraktaler Selbstähnlichkeit heraus, indem Makrostruktur und Detailstruktur sich gegenseitig spiegeln. Die spekulative Idealisierung formaler Symmetrie, die in Skrjabins Vorstellung der ›Kugelform‹ gerinnt, sowie Konjus’ Idee statischer Formarchitektonik werden in Roslawez’ Etüde durch quasi geometrisch angewendete Mittel der Tonhöhenorganisation kompositorisch verwirklicht. Lobanova verweist auf ein besonders interessantes Detail in der Manuskriptfassung der Etüde, die eine Streichung des ursprünglich vorgesehenen Widmungsträgers Skrjabin aufweist.[39] Die Widmungsstreichung im Manuskript darf ganz sicher interpretiert werden als Ausdruck der Einsicht in die erlangte künstlerische Autonomie des eigenen Schaffens, der Gewissheit einer im Vergleich gesteigerten systematischen Stringenz, der Einbildung höheren ästhetischen Gelingens, das nun nicht mehr auf Nennung künstlerischer Autoritäten angewiesen ist. Und doch bleibt die nachträgliche Streichung Ausdruck der zeittypischen Ambivalenz russischen Musikdenkens zwischen Rationalität und Esoterik, wie sie besonders mit Skrjabins Schaffen verbunden wird und bei welcher der Komponist Roslawez letztlich unschlüssig ist, welcher von beiden Neigungen er nachgeben soll. Er wählt beide: Trotz des hohen Grades an Rationalität, die das Stück bei seiner Zergliederung freigibt, wird das sphinxhafte Kreisen und Schimmern der Tonkomplexe von einer rätselhaften Aura umgeben, die durch die seltsame Orthografie des Komponisten offenbar intendiert ist. Dass in einem ganz offenkundig ›atonalen‹ Tonsatz nicht nur Doppelkreuze, sondern auch Tripelkreuze (das erste Mal ab T. 21) notwendig werden, muss jedem unbefangenen Betrachter, erst recht aber dem ausführenden Pianisten, absurd erscheinen. Man könnte diese Tatsache zunächst auf die Inszenierung von Exklusivität zurückführen, als ›Augenmusik‹ im Sinne einer neuen Musica reservata – ein Aspekt, der hier ganz sicher eine Rolle spielt, insofern avantgardistische Gruppierungen dazu neigen, sich als Zirkel von Eingeweihten zu begreifen. Andererseits deutet die absonderliche Akzidenziensetzung gleichzeitig auf ein bewahrendes Moment in Roslawez’ ›Neuem Tonsystem‹ hin, das noch einen Begriff von Tonalität und harmonischer Tiefendimension zu haben scheint. Es liegt nahe, die Transpositionsfolge des Eingangsteils als groß dimensionierte emporsteigende Terzensäule (vgl. Transpositionsschema oben, Bsp. 6) zu betrachten, die sich als logische Folge der Transpositionsrichtung in immer höhere Kreuzregionen begibt, welche ihrerseits orthografisch als harmonisch extrem entlegener Bereich angedeutet werden (vgl. Bsp. 11). Doch auch diese Auslegung zeitigt ein spekulatives Moment, da dieser Orthografie der hörend empirische Nachvollzug verweigert bleibt.
Beispiel 11: Nikolai Roslawez, Etüde Nr. 2, A-Teil, T. 21–23; Tripelkreuze im Plateau auf Shisis
Die Faktur der Komposition selbst erscheint, zumindest aus zeitgenössischer Sicht, in einem solchen Maße avanciert, dass man auf eine ›höhere Idee‹ im Hintergrund schließen darf. Das Verfahren des Transpositionsplans zeichnet sich an der Oberfläche durch die taktweise vor sich gehende ostentative Metamorphose des Materials (Wechsel der Vorzeichen!) in einer Weise ab, welche die ›subkutanen‹ Vorgänge schon auf dieser Ebene erahnen lässt. Hieran wird ein Doppelcharakter der Notation ersichtlich: Zwar handelt es sich oberflächlich um eine Ästhetik der Verrätselung, zum anderen gibt die Akzidenziensetzung erst den entscheidenden Hinweis auf das ›unter der Oberfläche‹ wirksame Verfahren.
Ist das Konzept einmal freigelegt, so erscheint es – vor dem Hintergrund zeitgenössischer theoretischer Ansätze und ästhetischer Ideen – als Demonstration plausibler Verfahrensprinzipien. Diese beweisen hier durch das vorgeführte ästhetische Gelingen in kompositorischer Praxis ihre scheinbar restlose Stimmigkeit: Ein Aspekt dabei wäre die Ausschöpfung der selbstauferlegten Materialbeschränkung. Das chromatische Total wird durch Benutzung aller zwölf Transpositionsstufen vollständig ausgeleuchtet. Zugleich wird durch die tonale Rahmung und die Identität des Basis-Sets Sais mit Seisis als übergeordnetem Formprinzip der plateaubildenden Transpositionsstufen tonale Logik vorgeführt. Es besteht zudem eine einleuchtende Beziehung zwischen Materialebene und Oberflächenfaktur durch die Bedeutung der Siebenzahl sowohl für das Set selbst als auch für die konkrete motivische Tongestalt innerhalb des Taktes. Nicht zuletzt ist die ostentative Verwirklichung mannigfaltiger Symmetriekonstellationen auf verschiedenen Ebenen als konsequente Verwirklichung zeitgenössischer formtheoretischer Desiderate zu verstehen.
Diese mustergültige Realisierung eröffnet jedoch gleichzeitig die Perspektive auf einen allgemeinen kompositorischen Umgang mit dem Material, die grundsätzlich auch andere stimmige Konstellationen und Lösungen der aufgeführten Verfahrensmodelle anbietet, wodurch das analysierte Stücke gewissermaßen einen ›lehrhaften Aspekt‹ erfüllt. Wohl kaum dürfte der Komponist aber mit den Etüden ein (kompositions-)didaktisches Ziel verfolgt haben, was dem gesteigerten, unbedingten Kunstanspruch dieser Epoche zuwiderliefe. ›L’art pour l’art‹-Ästhetik – und dieser Sphäre ist Roslawez zumindest in der Frühphase seines Schaffens unbedingt zuzuordnen – distanziert sich der Tendenz nach von didaktischer Vermittlung. An ihre Stelle setzt Roslawez die vom Rezipienten selbst zu vollziehende ästhetische Erfahrung als analytischen Nachvollzug:
Kunst ist nicht nur eine Tätigkeit des Künstlers, sondern auch desjenigen, an den sie sich wendet. So wie sich der Künstler bei der Bezwingung des Materials und seiner formalen Organisation abgemüht hat, so soll sich auch derjenige abmühen, der sie aufnehmen möchte.[40]
Damit wird die geistige Anstrengung der Analyse schließlich selbst in den Rang eines ästhetischen Vorgangs gehoben. Vor diesem Hintergrund erscheint die Deutung schlüssig, dass Roslawez seine theoretischen Errungenschaften sozusagen in ästhetisch-sublimierter Form in Umlauf bringt. In diesem Sinne wäre die bizarre Orthografie dann zu deuten als kryptische Botschaft, als verschlüsselter Hinweis auf die subkutanen Materialvorgänge, die als ästhetischer Überschuss, als ihr Geheimnis hinter der glitzernden Klangoberfläche verborgen liegen, und die nur derjenige entdecken kann, der dieser Aufforderung nachkommt und sich selbst tiefer in das Gewebe auf der Suche nach den Gründen dafür versenkt.
Anmerkungen
Dieser Beitrag wurde im Rahmen des Aufsatzwettbewerbs der GMTH 2015 mit einem Preis ausgezeichnet. | |
Gemäß der Vermutung Mendes ist es der Musikkritiker, Komponist und bedeutende Protagonist des musikalischen ›silbernen Zeitalters‹ Leonid Sabanejew, der hier Nikolai Roslawez selbst zitiert: L. [Autorenkürzel], »NA. Roslavec«, Sovremennaja Muzyka 1/2 (1924), 35–36 (hier: 36); Übersetzung nach Mende 2009, 371. | |
Vgl. dazu grundlegend Gojowy 1980, außerdem Sitsky 1994 sowie, die Vorgänge der systematischen Invektiven und Schikanen genau dokumentierend, Lobanova 1997. Als jüngste umfassende Publikation zu diesem Thema ist außerdem Mende 2009 zu nennen. | |
Gojowy 1980. | |
Eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Forschungsstands findet sich bei Mende 2009. | |
Hier sind u.a. zu nennen Marc-André Hamelins Kompletteinspielung von Roslawez’ Klaviermusik (Hyperion 1997), sowie Christophe Sirodeaus und Nikolaous Samaltanos’ gemeinsame Einspielung aller zwölf Klaviersonaten von Samuil Feinberg (BIS 2003, 2004), aber auch Jenny Lins Album mit zwischen 1905 und 1922 komponierten Russischen Klavierpréludes (Hänssler Classic 2005). | |
Vgl. dazu einen der frühesten Aufsätze von Lissa: 1935. | |
Skrjabins gewaltiger Einfluss auf die Generationen 1880–1905 und das daraus resultierende Epigonentum kann in seinem Ausmaß mit dem westeuropäischen Wagnerismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts verglichen werden. Vgl. dazu ausführlich Wehrmeyer 1991, 11–23. | |
Die Sphäre des russischen musikalischen Futurismus, auf den dieser Satz referiert, ist nach Gojowy (1984, 33) insgesamt weniger als »Stil« zu begreifen, denn als »Idee der ständigen musikalischen Erneuerung« (vgl. Mende 2009, 50). | |
Gojowy (1980, 97) nennt sieben Namen: Außer Roslawez sind das Arthur Lourié (1891–1966), Sergej V. Protopopov (1893–1954), Boris A. Alekssandrov (1905–1994) und die früh emigrierten Efim Golyscheff (1897–1970), Nikolai Obuchov (1892–1954) und Ivan A. Vyschnegradski (1893–1979). | |
Kein geringerer als Igor Strawinsky nannte ihn einst den »interessantesten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts« (vgl. Lobanova 1997, 11). Unabhängig von diesem Zitat scheint die Forschung darüber einig zu sein, dass es sich bei Roslawez’ System um das avancierteste handelt und Roslawez selbst eine der exponiertesten Figuren der damaligen betreffenden Musikszene war (vgl. Mende 2009, 370ff., sowie Ferenc 1992). | |
Der Systemcharakter wurde ganz offensichtlich auch von der zeitgenössischen Rezeption bereits erkannt und gewürdigt (vgl. Ferenc 1992). | |
Die eigentliche Formulierung erfolgt bei Roslawez in verstreuten Aufsätzen und Thesenpapieren der 1920er Jahre. Vgl. beispielsweise N.A. Roslawez, Das neue System der Tonorganisation und die neuen Unterrichtsmethoden der Komposition (datiert mit 3.12.1927), abgedruckt und ins Deutsche übersetzt bei Wehrmeier 1997, 317–322. Des Weiteren finden sich entsprechende Dokumente bei Gojowy 1980, 395ff. | |
Der Begriff ›Klangzentrum‹ stammt aus Lissa 1935, 18: »Die Grundlage einer jeden Komposition ist hier [in den späteren Werken Skrjabins] ein bestimmter Akkord, welcher aus einem stabilen Komplex, in ständiger Ordnung auftretender Töne zusammengesetzt ist. Diesen Akkord habe ich Klangzentrum genannt, denn er bildet hier das organisierte Tonmaterial, er ist der Ausgangs- und Beziehungspunkt aller, im gegebenen Stück auftretender Zusammenklänge. […] Das Klangzentrum bildet also die allgemeine Basis der Komposition, denn alle konstruktiven Elemente, sowohl der Harmonik, wie auch der Melodik lassen sich von ihm ableiten, auf ihn zurückführen.« | |
Was jedoch Skrjabins ›Mystischen Akkord‹ als Möglichkeit prinzipiell nicht ausschließt, tatsächlich ähneln etliche der von Roslawez verwendeten Sets einer der bei Skrjabin verwendeten Varianten. Bei Roslawez zeichnet sich erst ab 1919 eine eigenständige Kardinalvariante ab. | |
Zur Genese dieses Begriffs vgl. Lobanova 2001. | |
Eine umfassende Analyse der Etüde liegt bisher nicht vor. Lediglich bei Gojowy (1980, 140f.) werden das ihr zugrundeliegende Tonmaterial und das damit zusammenhängende Transpositionsschema auf wenigen Zeilen im Zusammenhang einer allgemeineren Erörterung der Roslawez’schen Kompositionsverfahren beschrieben. | |
Zu erwähnen sind hier die auf rhythmisch-metrischer Ebene stark ausdifferenzierten Etüden Nr. 1, 2, 6, 7 und 8 aus op. 42. Op. 65 ist geprägt durch die systematisch-konstruktive Beschränkung auf die Intervalle der kleinen None (Nr. 1), der großen Septime (Nr. 2) und der Quinte (Nr. 3), die sich selbstverständlich innerhalb des harmonischen Paradigmas der Klangzentrumstechnik verwirklicht. | |
Dies ist eine ästhetische Kategorie, die m.E. in der von Skrjabin geprägten Stilsphäre der russischen Avantgarde eine Schlüsselstellung hat, jedoch in der Regel bedauerlicherweise unkommentiert bleibt, obgleich zahlreiche Paradoxien und Eigenarten eine gewisse Rechtfertigung bzw. zumindest Besprechung regelrecht herausfordern. | |
Vgl. Schibli 1983, 90. | |
Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, das so auch in Chopins und Skrjabins Etüden nicht selten anzutreffen ist: pianistische Verkomplizierung des Ausgangsmusters zu Beginn eines neuen Formteils als zugleich musikalisches wie spieltechnisches Steigerungsmittel. | |
Eine solche die romantische Tonsprache übersteigernde, hypersensibel-nervöse Klanglichkeit wird in der Stilsphäre Skrjabins gespiegelt durch psychologisierende Vortragsbezeichnungen wie z.B. ›en délire‹, ›ailé‹ (»fliegend«), ›inaferando‹ (etwa: »nicht begreifend, nicht fassend«). Roslawez, der in der Regel auch auf solche Anweisungen zurückgreift, verzichtet in der vorliegenden Etüde auf Derartiges, vielleicht aufgrund einer konzeptuellen Askese, und zieht die etwas herkömmlichere Anweisung ›con dolce maniera‹ vor. | |
Zu Aspekten komplexer konfliktrhythmischer Oppositionen bei Skrjabin vgl. Schibli 1983, 153ff., außerdem, die Rhythmik der russischen Avantgardisten besprechend, Gojowy 1980, 64ff. | |
Eine umfassende und grundlegende Kritik bietet Perle 1990, 151–172. Vgl. auch, die gesamte kritische Debatte um die ›pc theory‹ pragmatisch zusammenfassend, Schuijer 2005, 23ff. | |
Roslawez notierte mitunter den jeweils gegenwärtig verwendeten oder einen Formteil global bestimmenden Synthet-Akkord am Rande seiner Partituren im Manuskript in engster skalarer Darstellung und bezeichnete diese Notate selbst gelegentlich als ›Leitern‹ (vgl. Lobanova 2001, 418). | |
Dies wäre seine ›Normalform‹; die nach 0 (=c) transponierte ›Primärform‹ (0134578) ist für diese Analyse unerheblich, da sich der Transpositionsplan auf Sais bezieht. Auch alle anderen Eigenschaften des Sets (›Z-Verwandtschaft‹ mit 7–z17, Intervallvektor 434541 und die ›Inversionsinvarianz‹ auf T4I) in irgendeiner Form zu thematisieren erscheint als entbehrlicher theoretischer Ballast. | |
Eine formale Strategie, die sich bereits bei Skrjabin als ein Standardverfahren der Spätphase in einigen Werken abzeichnet. So z.B. in Poème Nocturne op. 61, Étrangeté op. 63/2, den zwei Préludes op. 67, dem Poème op. 71/2, Flammes sombres op. 73/2, oder dem Prélude op. 74/4, um einige Beispiele für dieses Vorgehen zu nennen. | |
Das Transpositionsintervall wird in den folgenden Transpositionsschemata konsequent in Aufwärtsrichtung angegeben. | |
Roslawez deswegen als »frühen Zwölftonkomponisten« zu bezeichnen, wie Gojowy es tut, verstellt allerdings den Blick auf die bei aller Verwandtschaft tatsächlich vorhandenen substanziellen Unterschiede zwischen Schönbergs Zwölftontechnik und Roslawez’ Tonsystem (vgl. dazu Gojowy 1969, 22–38). | |
George Perle (1962, 41) spricht in diesem Zusammenhang von »nondodecaphonic serial composition«, bespricht diese aber eher als Vorform der Zwölftontechnik denn als eigenständiges und davon unabhängiges Verfahren. | |
Eine Einführung, Besprechung und Interpretation findet sich bei Wehrmeier 1991, 44–62. Ebenso findet sich dort eine Originalanalyse Konjus’ vom 1. Satz der Beethoven’schen Klaviersonate op. 27/2 ins Deutsche übersetzt (255–270). | |
Wehrmeyer (1991, 46) führt als wichtiges Dokument einen Brief Konjus’ an Sergej Tanejew auf, der eine metrotektonische Analyse des Beethoven’schen Adagio sostenuto aus op. 27/2 enthält. Die Verbindungen zu Skrjabin und Roslawez sind vielfältig: Konjus war Skrjabins Klavierlehrer in jungen Jahren, Prof. Sergej I. Tanejew (1856–1915) unterrichtete später am Konservatorium Skrjabin in Komposition, ebenso den späteren Moskauer Konservatoriumsprofessor Sergej N. Wassilenko, der wiederum Roslawez in Harmonielehre und Komposition unterrichten sollte. | |
Vgl. Konjus’ Beethoven-Analyse bei Wehrmeier 1991, 264. | |
Ebd., 58. | |
Ebd., 61. | |
Ebd., 60. | |
Sabanejew 2005, 131 (Hervorhebungen original). | |
Dies wird bei Sabanejew (ebd.) noch viel weiter ausgeführt und muss als wichtiger Hinweis verstanden werden dafür, dass kalkulatorische Materialdisposition und formale Konzeption vor der eigentlichen Komposition hier bereits eine Rolle gespielt haben müssen. | |
Vgl. Lobanova 1997, 104 und 246, Anm. 120. | |
Vgl. Fußnote 2. |
Literatur
Ferenc, Anna (1992), »Reclaiming Roslavets: The Troubled Life of a Russian Modernist«, Tempo 182, 6–9.
Gojowy, Detlef (1969), »Nikolaj Andreevič Roslavec, ein früher Zwölftonkomponist«, Die Musikforschung 22, 22–38.
Gojowy, Detlef (1980), Neue sowjetische Musik der 20er Jahre, Laaber: Laaber.
Gojowy, Detlef (1984), »Das konsequente Prinzip der Erneuerung. Zum musikalischen Futurismus in Rußland«, MusikTexte Nr. 4, 30–33.
Lissa, Zofja (1935), »Geschichtliche Vorform der Zwölftontechnik«, Acta Musicologica 7, 15–21.
Lobanova, Marina (1997), Nikolaj Andreevič Roslavec und die Kultur seiner Zeit., Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
Lobanova, Marina (2001), »Das neue System der Tonorganisation von Nikolaj Andreevič Roslavec«, Die Musikforschung 54, 400–428.
Mende, Wolfgang (2009), Musik und Kunst in der sowjetischen Revolutionskultur, Köln u.a.: Böhlau.
Perle, George (1962), Serial Composition and Atonality. An Introduction to the Music of Schoenberg, Berg and Webern, London: Faber and Faber.
Perle, George (1990), »Pitch-Class Set Analysis: An Evaluation«, The Journal of Musicology 8, 151–172.
Sabanejew, Leonid (2005), »Erinnerungen an Skrjabin« [1925] (= musik konkret. Quellentexte und Abhandlungen zur russischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts 14), hg. von Ernst Kuhn, Berlin: Kuhn.
Schibli, Sigfried (1983), Alexander Skrjabin und seine Musik. Grenzüberschreitungen eines prometheischen Geistes, München/Zürich: Piper.
Schuijer, Michiel (2005), Pitch-Class Set Theory and the Construction of Musical Competence, Diss., Utrecht.
Sitsky, Larry (1994), Music of the Repressed Russian Avant-garde, 1900–1929, Westport (CT): Greenwood Press.
Wehrmeyer, Andreas (1991), Studien zum russischen Musikdenken um 1920, Frankfurt a.M. u.a.: Lang.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.