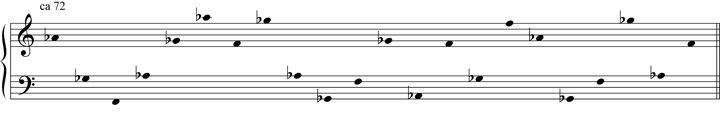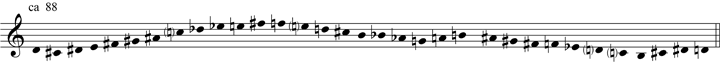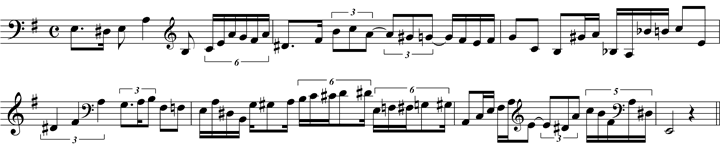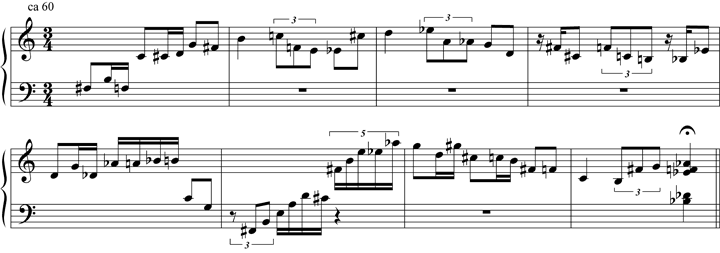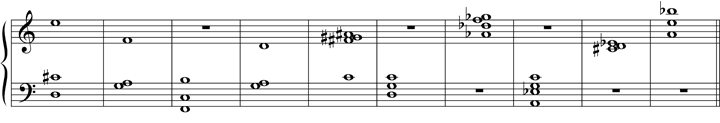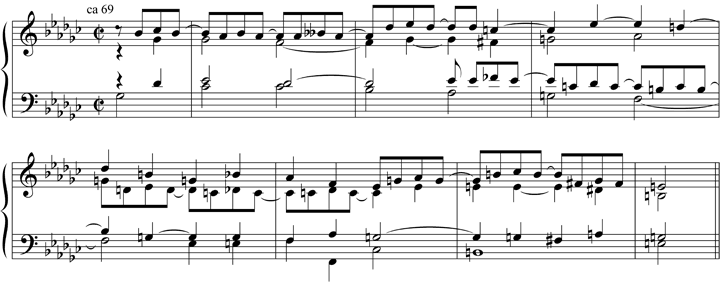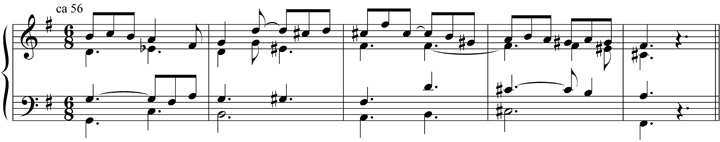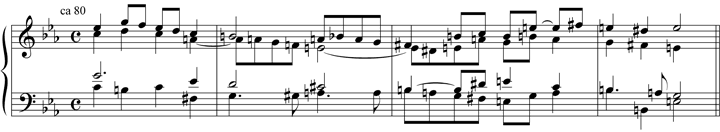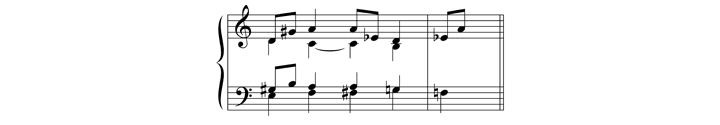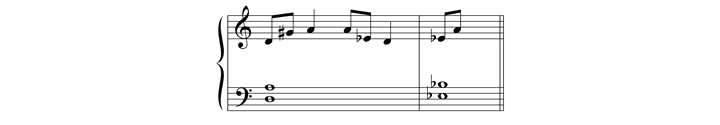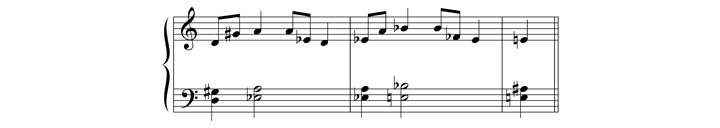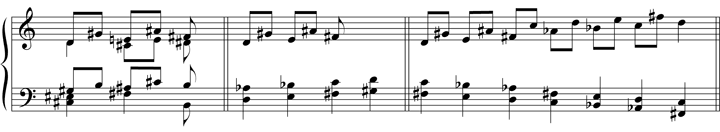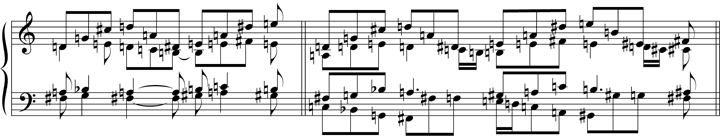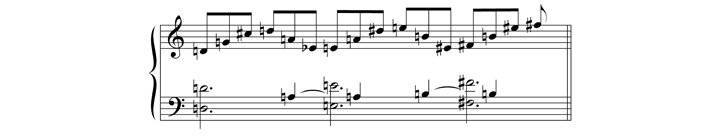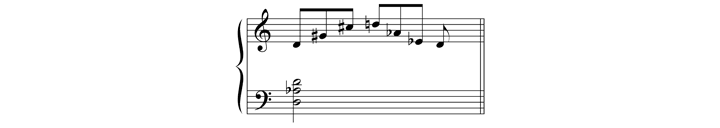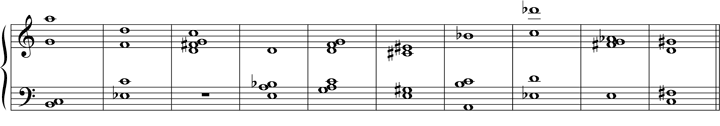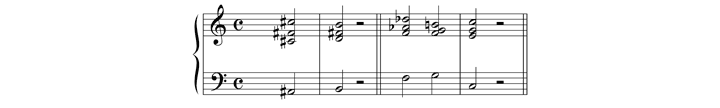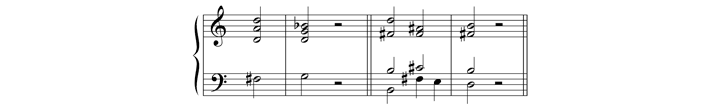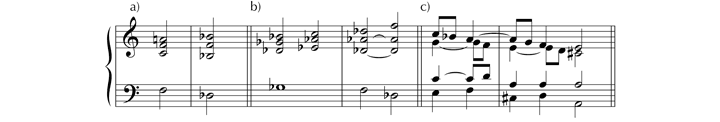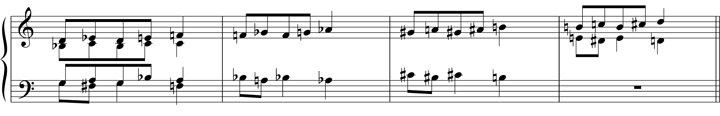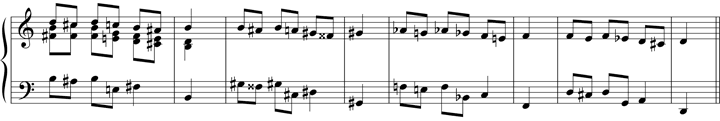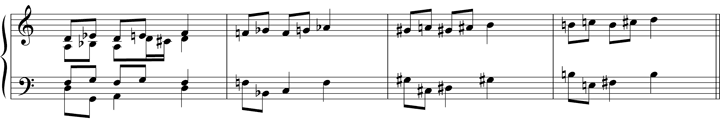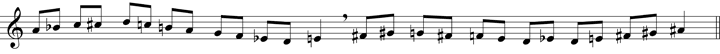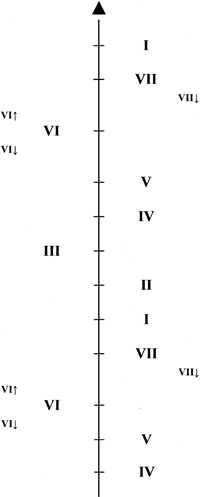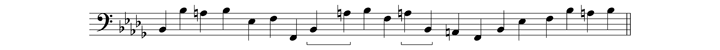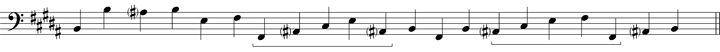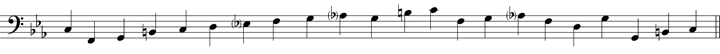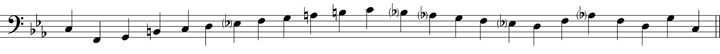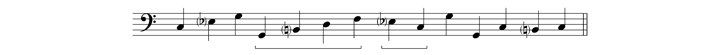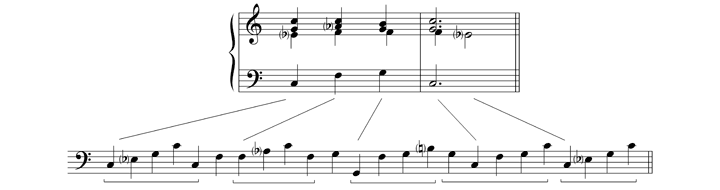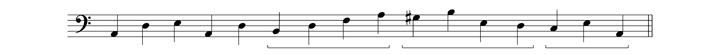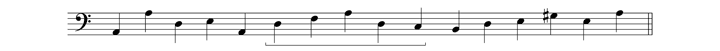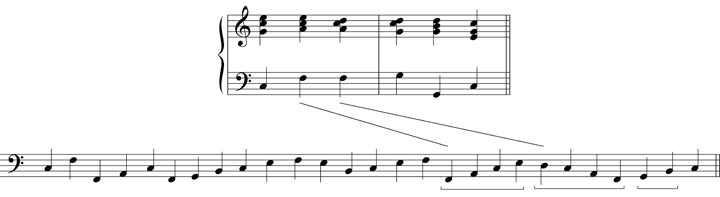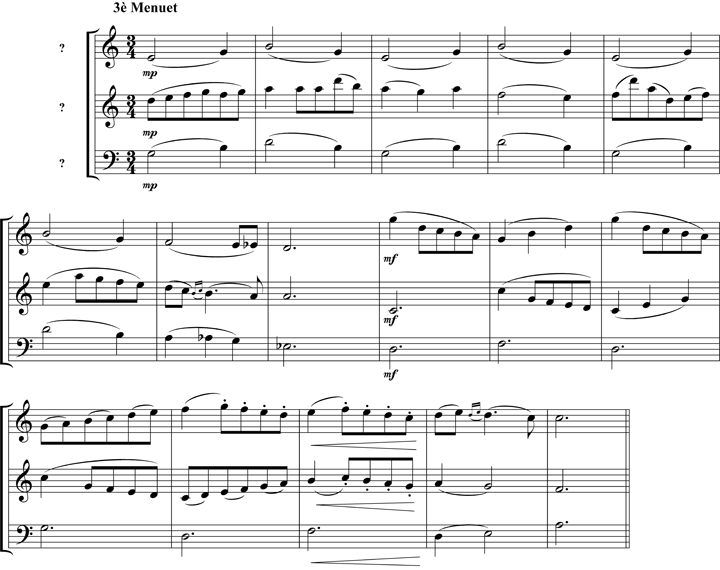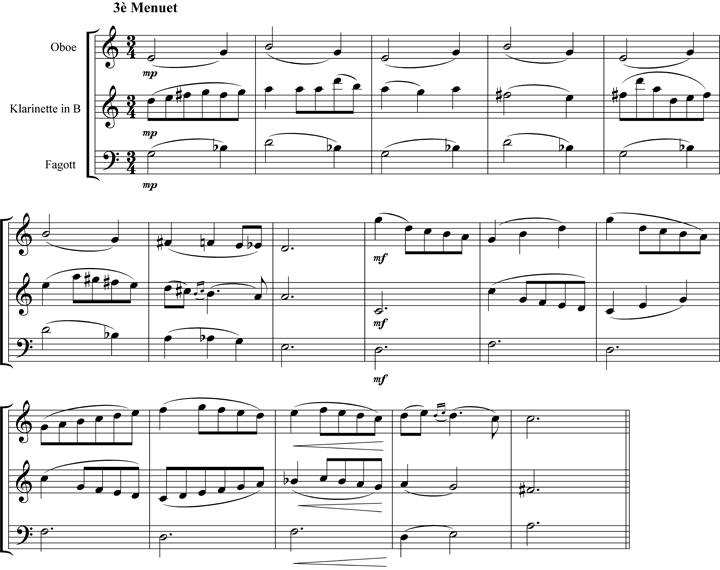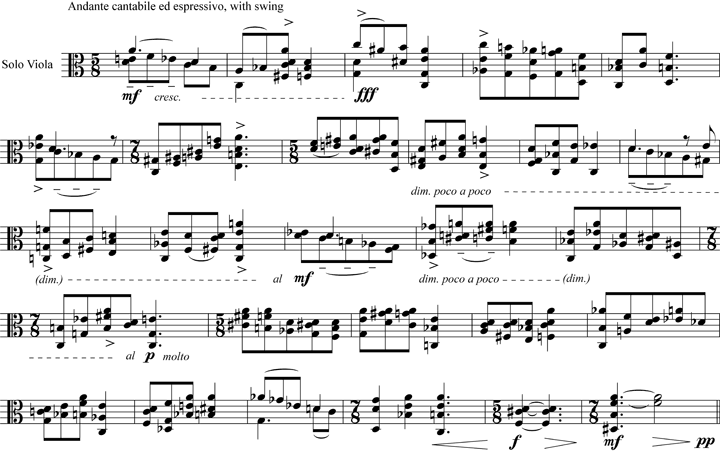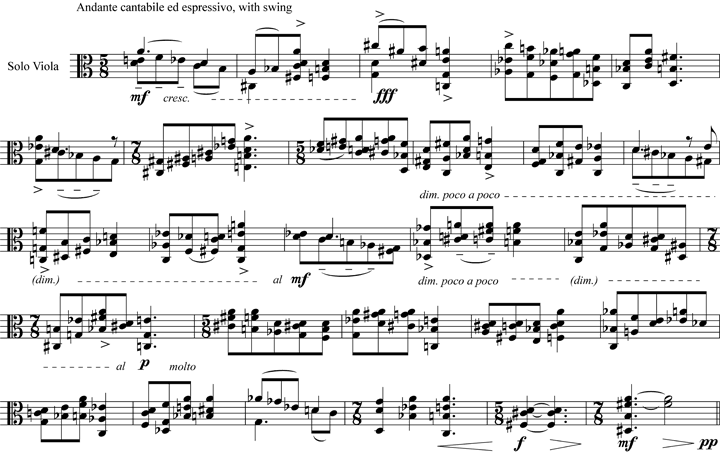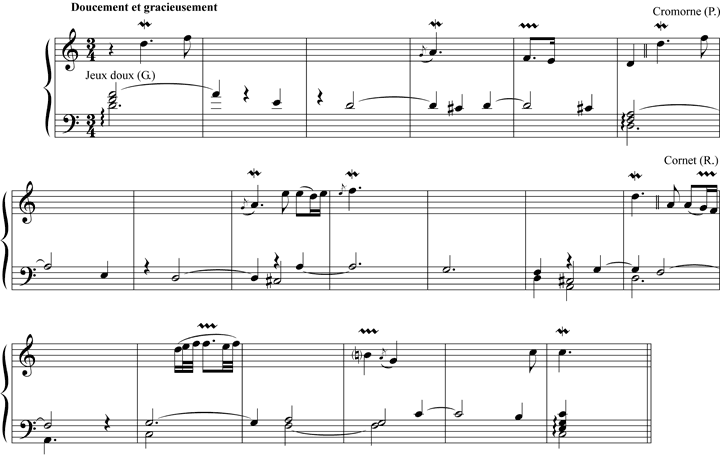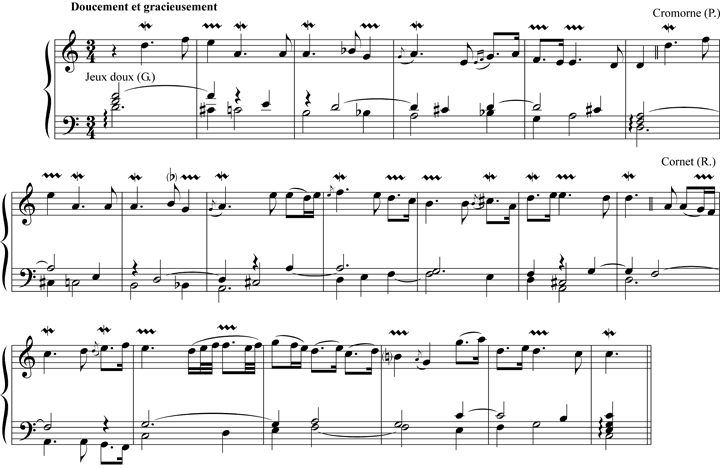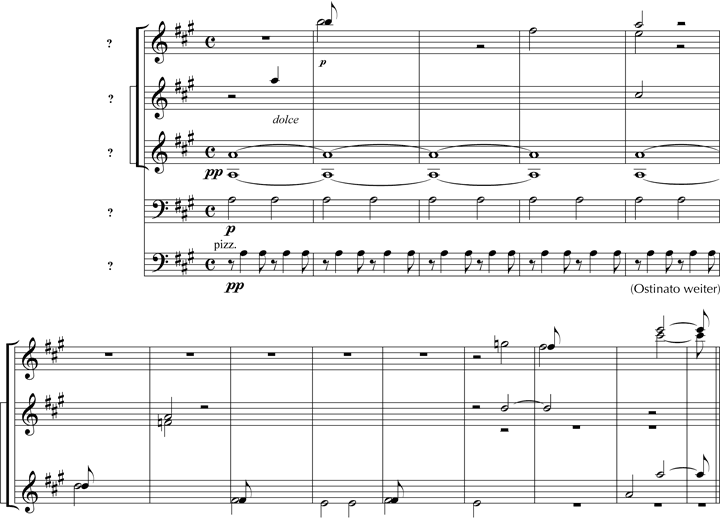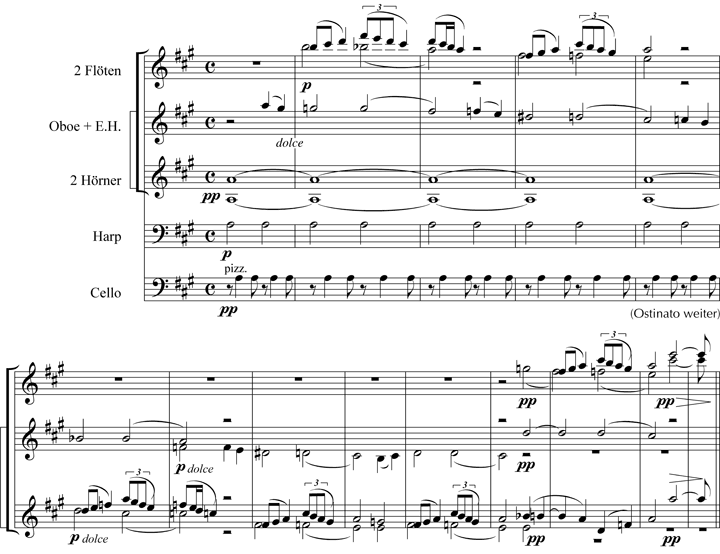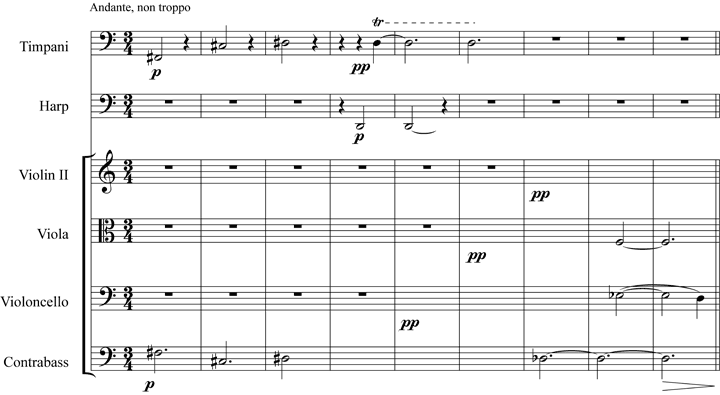Gehörbildung zwischen französischer und deutscher Tradition – Versuch einer Synthese
Violaine de Larminat
Vorgestellt wird ein Konzept der Gehörbildung als Versuch der Synthese zwischen der französischen Tradition, der die Autorin aufgrund ihrer eigenen Ausbildung entstammt, und der österreichisch-deutschen Tradition, mit der sie als Dozentin für Gehörbildung an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien konfrontiert wurde. Der Beitrag stellt damit nicht nur ein individuelles Unterrichtskonzept zur Diskussion, sondern liefert zugleich einen detailreichen Vergleich beider Ausbildungstraditionen.
Nach meiner musikalischen Grundausbildung am Conservatoire de Paris und einer kurzen pädagogischen Erfahrung in Frankreich studierte ich in Wien Kirchenmusik und Orgel (Konzertfach). Hier entwickelte sich im Anschluss auch mein berufliches Leben: Mir wurde die Hörausbildung der Studenten in den Studiengängen Komposition, Musiktheorie, Dirigieren, Korrepetition und Tonmeisterausbildung am ›Institut für Komposition und Elektroakustik‹ der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien anvertraut. Aufgrund meiner Abschlüsse in Frankreich besuchte ich als Studentin in Wien keinen weiteren Gehörbildungs- oder Theorieunterricht. Als ich zu unterrichten begann, waren mir daher die Besonderheiten der deutschsprachigen Lehrtradition in Gehörbildung zunächst fremd. Wesentliche Einblicke erhielt ich erst durch den Kontakt mit meinen deutschsprachigen Studenten (die in Wien allerdings nur etwa 30% meiner Klasse ausmachen) und die Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Fachliteratur. Diese Begegnung mit kulturell verschieden gefärbten Unterrichtsmethoden, Denkweisen und Hörstrategien wurde zum Ausgangspunkt einer systematischen Infragestellung dessen, was mir als Pädagogik und Zielsetzung des Fachs Gehörbildung von meiner eigenen Ausbildung her vertraut war. Mir wurde deutlich, dass sowohl der pädagogische Aufbau der Hörausbildung, als auch der generelle Stellenwert des Fachs Gehörbildung, angefangen von der Grundausbildung für Kinder bis zum akademischen Curriculum, in den romanischen und deutschsprachigen Ländern wesentliche Unterschiede aufweisen. In der folgenden Zeit machte ich es mir zur Aufgabe, in meinem eigenen Unterricht eine Synthese der beiden Traditionen zu versuchen, um ihre Vorzüge miteinander zu verbinden. Dabei hatte ich mich natürlich auf die in Wien vorgefundene Situation zu beziehen: Mein Unterricht musste sich in die dortigen curricularen und institutionellen Gegebenheiten einfügen.
Strukturelle Organisation der Gehörbildung in Frankreich und im deutschsprachigen Raum
I. Frankreich
Anfang der 80er Jahre wurde eine Reform des Gehörbildungsunterrichts, des so genannten ›solfège‹ durchgeführt. Allgemeine Dezentralisierungsbestrebungen führten im Bereich der Gehörbildung dazu, dass die Unterrichtsprogramme für die staatlichen Musikschulen und Konservatorien, von allgemeinen Richtlinien über die prinzipielle Zielsetzung des Faches abgesehen, nicht mehr vom Kulturministerium vorgegeben wurden. Seither verfügt jede Bildungseinrichtung über mehr curriculare und organisatorische Freiheiten. Der Konsens über die Dauer der gesamten Hörausbildung und die Anzahl der dafür vorgesehenen Unterrichtseinheiten blieb aber erhalten.
Zentrales Ziel der damaligen Reform war es, neben der bis dato zumeist rein ›technisch‹ verstandenen Ausbildung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung der Lese- und Hörfähigkeit, eine breitere kulturelle Orientierung zu ermöglichen. Insbesondere sollten den Schülern und Studenten verstärkt Repertoirekenntnisse und Grundkenntnisse der Musikgeschichte (einschließlich Jazz- und Popularmusik) vermittelt werden.[1]
Das Fach Gehörbildung (seit der Reform ›formation musicale‹ genannt, wörtlich also ›musikalische Ausbildung‹) ist in Frankreich bereits in den Musikschulen, dort sogar noch vor Beginn des Instrumentalunterrichts, vorgesehen, also für Kinder ab dem fünften oder sechsten Lebensjahr. Das hat entscheidende Konsequenzen:
Gehörbildung in Verbindung mit ›Theorie der Musik‹ bzw. Allgemeiner Musiklehre wird als Basis für alle Musizierenden angesehen, sowohl für Amateure als auch für zukünftige Berufsmusiker. Die Grundausbildung erstreckt sich mit zehn bis zwölf Jahren über einen sehr langen Zeitraum.
Es liegt sehr reichhaltige Unterrichtsliteratur für die Ausbildung an Musikschulen und Konservatorien vor. Schüler wie Studenten werden dazu aufgefordert, Jahr für Jahr ihrem eigenen Leistungsniveau entsprechende Lehrbücher zu erwerben. Lehrbücher für das Anfängerniveau wie für die höheren Jahrgänge enthalten gestaffelt nach zunehmender Schwierigkeit Rhythmusübungen, Übungen zum Blattsingen sowie theoretische Hinweise, Leseübungen und Diktate.
Der Unterricht findet in Gruppen von ca. zwölf bis fünfzehn Schülern statt. Diese sind damit zwar kleiner als eine reguläre Schulklasse, dennoch kann gesagt werden, dass sich der Unterricht am ›Kollektiv‹ und nicht am ›Individuum‹ orientiert. Die Unterrichtseinheiten changieren zwischen 60 bis 90 Minuten pro Woche für Anfänger und bis zu vier Stunden pro Woche (meist auf zwei Termine verteilt) für die Absolventen der letzten beiden Unterrichtsjahre. Dem Schulrhythmus entsprechend gibt es in Frankreich ca. 29 bis 30 Unterrichtswochen pro Schuljahr, und am Ende eines jeden Schuljahres findet eine (mündliche und schriftliche) Prüfung vor einer Kommission statt. Wer die Abschlussprüfung am Ende des gesamten Kurses nicht bestanden hat, erhält an der Musikschule oder am Conservatoire keinen weiteren Instrumentalunterricht.
Die Hörausbildung erfolgt überwiegend in der Kindheit bzw. im Schulalter. Die zukünftigen Berufsmusiker, die eine Hochschulausbildung in den zwei Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique in Paris und Lyon anstreben, erhalten in der Studienzeit kaum noch Gehörbildungsunterricht. Dabei sind jedoch die Instrumentalisten von den Komponisten, Dirigenten und Theoretikern zu unterscheiden. Nach der Zulassungsprüfung zum Konzertfachstudium am Pariser Conservatoire, die einen selektiven Hörtest enthält, entscheidet am Beginn des Studiums ein zweiter Test über eine mögliche Befreiung vom Gehörbildungsunterricht. Erzielen die aufgenommenen Studenten hier keine ausreichende Note, werden sie zu verschiedenen Unterrichtseinheiten in Diktat, Rhythmus oder Blattsingen verpflichtet, bis sie anhand einer Abschlussprüfung das geforderte Niveau in diesen Bereichen nachweisen können. Für alle anderen Studienzweige gibt es bei der Zulassungsprüfung eine Tonsatzprüfung, die als Ersatz für einen Hörtest angesehen wird, denn das innere Hören, das dabei geprüft werden soll, gilt als Nachweis eines guten Gehörs. Komponisten, Theoretiker und Dirigenten bekommen daher im Rahmen ihres Studiums überhaupt keinen Gehörbildungsunterricht mehr.
II. deutschsprachiger Raum
Die Hörausbildung beginnt in der Regel erst in der Studienzeit. Gehörbildung ist damit ein Fach, das nahezu ausschließlich für Berufsmusiker angeboten wird. Anders als in Frankreich gibt es in den deutschsprachigen Ländern keine Form des Zentralismus. Jedes Konservatorium, jede Musikhochschule oder Musikuniversität, unter Umständen sogar jede Abteilung innerhalb einer solchen Institution kann ihre eigenen Studienpläne einrichten. Jeder Lehrer an einer ›sekundären Bildungseinrichtung‹ entscheidet im Rahmen der Lehrfreiheit über Inhalte und Methoden seines eigenen Unterrichts. Daher gibt es auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum enorme Unterschiede, und es scheint kaum möglich, über die Gehörbildung schlechthin zu sprechen. An manchen Hochschulen werden die Theoriefächer einschließlich Gehörbildung, Hörschulung bzw. Hörerziehung (allein schon der Terminus für dieses Fach ist von Ort zu Ort anders) in allen Studienrichtungen ohne Ansehen des jeweiligen Studiengangs unterrichtet und Studenten verschiedener Studiengänge erhalten gemeinsam Unterricht, anderswo wird nach Leistungsgruppen und/oder Studienrichtung unterschieden.[2] Dies hat folgende Konsequenzen:
Die Hörausbildung ist relativ kurz, erfolgt aber parallel zu den theoretischen Fächern (Tonsatz, Analyse) und anderen Nebenfächern, die in näherer Beziehung zur Hörausbildung stehen, wie Stimmbildung, Chorsingen, Klavier als zweites Instrument und Partiturspiel.
Gehörbildung gilt nach meiner Beobachtung zumindest in Österreich bei den Studenten als ›Begabungssache‹. Dass es im Gegenteil eine Übungssache ist, für die Engagement, Regelmäßigkeit, Konzentration und Ausdauer benötigt werden, muss erst vermittelt werden.
Die Gehörbildungsliteratur ist relativ eingeschränkt. Man findet im Vergleich zu Frankreich nur wenige praktische Übungsbücher, die direkt für den Unterricht konzipiert sind. Etwas umfangreicher ist die Fachliteratur, die zumeist aus einer Mischung pädagogischer Überlegungen für Lehrende und praktischer Übungen für Studenten besteht und daher nicht immer im Unterricht unmittelbar einsetzbar ist.[3] Es ist nicht üblich, dass Studenten ein begleitendes Lehrbuch erwerben: Das Unterrichtsmaterial wird meistens von dem jeweiligen Lehrenden selbst hergestellt.
In Folge des fehlenden Zentralismus gibt es einheitliche Bestimmungen weder über die Dauer der Unterrichtseinheiten noch der gesamten Ausbildung. In Österreich findet der Unterricht zumeist in Kleingruppen von vier bis fünf Studenten statt. Die Unterrichtseinheiten betragen 45 Minuten pro Woche und höchstens vierundzwanzig Unterrichtswochen pro Jahr (einschließlich Prüfungswochen). Für die Zulassung zum Studiengang Dirigieren/Komposition sind Hör-, Theorie- und Tonsatzprüfungen vorgesehen, deren Bestehen Voraussetzung für die Teilnahme am praktischen Teil der Zulassungsprüfung ist. Viele Studenten können sich, weil sie vorher kaum oder nie Gehörbildungsunterricht erhalten haben, oft nur kurzfristig auf die entsprechenden Prüfungsteile vorbereiten.
Die Studenten sind von ihrem Hauptfach her an Einzelunterricht gewöhnt, ihr Bild vom Gruppenunterricht ist durch die Schulerfahrung geprägt: Zu selbstständiger Arbeit sind sie oft kaum fähig. Gruppendynamik und Arbeitsweise unterscheiden sich stark von den größeren schulähnlichen Gruppen im Gehörbildungsunterricht in Frankreich.
Verschiedene Zielsetzungen des Faches in den beiden vorgestellten Traditionen
Die Zielsetzung für das Fach Gehörbildung ist – nicht zuletzt bedingt durch diese erwähnte grundsätzlich verschiedene Auffassungen über die Strukturen und die Organisation der Musikausbildung – in den beiden vorgestellten Traditionen sehr unterschiedlich. Ebenso unterschiedlich werden die Hörsensibilität für die verschiedenen musikalischen Parameter (am evidentesten bei der Intonation) sowie die Denkweisen und Hörstrategien der betroffenen Musiker dadurch geprägt. Im Folgenden sind die Zielsetzungen der französischen und der österreichischen (deutschen) Gehörbildung zur Veranschaulichung tabellarisch gegenübergestellt.
FRANKREICH | ÖSTERREICH |
Absolute Solmisation und Entwicklung des absoluten Gehörs: | Deutsche Notennamen und relatives Hören: |
Das absolute Gehör ist das ›beste‹ Gehör. | Das absolute Gehör ist ein ›dummes‹ Gehör (Deutschland). Das absolute Gehör ist angeboren und ein Zeichen außergewöhnlicher Begabung (Österreich). |
Das Erkennen melodischer Strukturen ist unabhängig von der Intervallbestimmung. | Das Erkennen von Intervallen ist das Hauptmittel zum melodischen Hören. |
Harmonisch hören heißt Erkennen einzelner Töne inklusive Verdopplungen und führt auf diese Weise zur Bestimmung der Akkordart. | Globales harmonisches Hören: Akkorde sollen vor allem über ihre Funktion definiert werden. |
Das absolute Hören kann ein Mangel an Sensibilität für Intonationsunterschiede nach sich ziehen. | Viel Intonationsarbeit. |
Transponieren wird wenig geübt. |
|
| Enges Verhältnis zwischen Stimme und Gehör |
Blattsingen, verbunden mit Lesearbeit, ist Teil der Hörausbildung. | Singen und Blattsingen sind das Hauptziel der Hörausbildung. |
Diktate sind das beste Mittel, die Hörkompetenz eines Studenten zu beurteilen. | Das Hören wird durch Blattsingen beurteilt. |
| Eine perfekte Intonation ist das wichtigste Kriterium eines guten Gehörs. |
Das innere Hören |
|
Die Entwicklung des inneren Hörens ist Ziel der Hörausbildung und wird als Vorbereitung des Tonsatzunterrichts angesehen. | Die spät stattfindende Hörausbildung, die gleichlaufend mit der Tonsatzausbildung erfolgt, erschwert meist die Entwicklung des inneren Gehörs, welche oft vernachlässigt wird. |
Schwerpunkt Lese- und Schreibautomatismen | Schwerpunkt Gedächtnisfähigkeiten |
Die Entwicklung der Lesefertigkeit gilt als unersetzliche Voraussetzung für ein gutes Gehör. |
|
Hören besteht aus der Verbindung zwischen Klang und Notenbild. Die Verknüpfung von Ohr und Auge soll so eng wie möglich werden. | Das musikalische Gedächtnis gilt als Voraussetzung für die Diktatarbeit und wird dem Schreiben vorangestellt. Die Entwicklung des Gedächtnisses wird durch Memorierübungen trainiert. |
Bei Diktaten wird gleichzeitiges Hören und Schreiben verlangt sowie die Schnelligkeit der Schreibreflexe. |
|
Zu dem Gehörten sollen sofort Notennamen assoziiert werden, wie umgekehrt Klang zum gelesenen Notentext. | Blattsingen oder Blattspielen verlangen sensorische und motorische Reflexe mit der Stimme oder am Instrument, unabhängig vom Denken in Notennamen. |
Vorbereitung des Instrumentalunterrichts |
|
Das automatisierte Notenlesen ist beim Instrumentalspiel Bedingung für den Zugang zum Repertoire. Der Gehörbildungsunterricht soll darauf vorbereiten und für die Fähigkeit des Blattspiels sorgen. | Notenlesen wird ausschließlich im Rahmen des Instrumentalunterrichts gelernt. Blattspielen ist nur die Vorstufe der Arbeit am Instrument, ist aber kein Kompetenzkriterium für einen Instrumentalisten. |
Das rhythmische Training ist ebenso eine Voraussetzung für das Instrumentalspiel. Im Gehörbildungsunterricht erfolgt die sensorische und theoretische Vorbereitung im metrischen und rhythmischen Bereich. |
|
Zugang zu einem umfangreichen Repertoire |
|
Der Umgang mit Orchesterpartituren wird durch Lesearbeit und Höranalyse im Rahmen des Gehörbildungsunterrichts vorbereitet. | Den Zugang zu Orchesterpartituren übernimmt das Fach Partiturspiel. |
Spezifische schwierige atonale Diktate und rhythmische Übungen sollen den Zugang zur zeitgenössischen Musik erleichtern. | Das Hören sowohl des tonalen als auch des atonalen Repertoires erfolgt anhand von Intervallbestimmung. |
Seit der Reform werden alle Musikparameter in die Hörausbildung einbezogen: |
|
Form (Höranalyse) | (siehe das Fach Formanalyse) |
Klangfarbe (Instrumente erkennen und Diktate vom Tonträger) | (siehe das Fach Instrumentation) |
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Gehörbildungstraditionen in Frankreich und Österreich
Bevor ich daran ging, eine Synthese zu versuchen, war die erste und eher beängstigende Frage, die sich für mich mit Beginn meiner Unterrichtstätigkeit in Wien stellte: Wie kann ich mit einer Gruppe bei durchschnittlich 18 Stunden pro Jahr in vier Jahren dasselbe Ergebnis erzielen wie in Frankreich, wo 30 (Anfänger) bis 120 Stunden (Absolvent) pro Jahr über einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren zur Verfügung stehen?
Schnell lernte ich aber, folgendes mit in Betracht zu ziehen:
Gehörbildungstraining besteht daraus, eine Verbindung zwischen Gehör und Theorie herzustellen. Die Arbeit mit erwachsenen Studenten gestaltet sich in diesem Zusammenhang vollkommen anders als mit Kindern. Erwachsene gehen selbstverständlicher mit musiktheoretischen Begriffen um, Kinder hingegen sind für sensorische Arbeit zugänglicher.
(Wiener) Studenten beginnen ihre Hörausbildung nicht als ›musikalische Anfänger‹, denn sie verfügen schon über eine gute instrumentale Vorausbildung, wenn sie zur Aufnahmeprüfung an die Musikuniversität kommen. Studenten sind zudem ganztägig mit Musik beschäftigt, nicht nur hobbymäßig wie Schüler.
Einige fachliche Inhalte, die in Frankreich dem Gehörbildungsunterricht zugeteilt sind, werden im deutschsprachigen Raum von anderen Lehrveranstaltungen im Rahmen der Hochschulausbildung übernommen. Umgekehrt gilt, dass eine Reihe anderer Fächer, die in Frankreich nicht oder nur in geringem Ausmaß gesondert für die Kinder an den Musikschulen angeboten wird, im Rahmen des Studiums in Wien Haupt- oder Pflichtnebenfächer (Stimmbildung, Klavier als zweites Instrument, Partiturspiel, Tonsatz, Formanalyse, Musikgeschichte, usw.) sind.
Die konkreten Auswirkungen auf meinen Unterricht waren:
Die wöchentlichen Unterrichtseinheiten von nur 45 Minuten führten dazu, schriftliche und mündliche Arbeitsformen im wöchentlichen Rhythmus wechseln zu lassen. Die mündlichen Stunden sind vor allem als Impuls für die selbstständige Hausarbeit konzipiert: Übungen werden ausgegeben und Übungsmethoden sorgfältig erklärt, um den Studenten regelmäßiges Selbsttraining zu erlauben. Trotz der zeitlichen Distanz von 14 Tagen zwischen den schriftlichen Übungen, erweist sich das wöchentliche Alternieren als effizienter im Vergleich zur Mischung beider Arbeitsformen in jeder Unterrichtsstunde.
Die acht Unterrichtssemester der mir anvertrauten Studenten werden durch eine Vordiplomprüfung in zwei gleich lange Studienabschnitte geteilt. Das erlaubt mir eine inhaltliche Trennung zwischen einer ›technischen‹, eher traditionellen Arbeit (mit besonderem Schwerpunkt auf einer begleitenden Vorbereitung zur Tonsatzprüfung des Vordiploms) und literaturgebundenen Übungen im zweiten Studienabschnitt, die das Selbsteinschätzen der erworbenen Hörkompetenzen in einer der Berufausübung näher liegenden Situation ermöglichen. Intervallübungen werden allmählich durch das Blattsingen von Liedern mit Klavierbegleitung ersetzt. Den Abschluss bildet in den letzten beiden Semestern ausschließlich die Höranalyse – mit Schwerpunkt auf Formanalyse, d.h. Wahrnehmung der zeitlichen Organisation eines gesamten Satzes –, damit die Studenten mit der Notwendigkeit der Entwicklung von Hörreflexen einerseits und der Flexibilität ihrer Anwendung in der musikalischen Praxis anderseits konfrontiert werden.[4]
Den beiden nationalen Traditionen kommen nicht an sich Vorzüge oder Mängel zu. Einzelne Aspekte können sich sowohl positiv als auch negativ auswirken, je nach dem konkreten musikalischen Arbeitsgebiet, zu dessen Ausbildung sie Anwendung finden (für einen Opernsänger gelten andere Voraussetzungen als für einen Barockinstrumentalisten oder zeitgenössischen Komponisten).
Einerseits behielt ich einige typische französische Merkmale der Hörausbildung bei, wie z.B. die enge Verbindung zwischen Hören und Lesen. Die Frage, wie ich die Studenten zu diesem noch nicht automatisierten Denken und Assoziieren von Klang und Notennamen bringen könnte, führte mich zu der Entscheidung, die Intervallarbeit, die in der deutschen Unterrichtstradition so bedeutend ist, grundsätzlich beizubehalten und zu diesem Zweck zu adaptieren.
Andererseits habe ich mich auch von beiden Traditionen unabhängig gemacht, zum Beispiel von dem üblichen Verfahren, die Anzahl der Stimmen in Diktaten von eins bis vier progressiv zu steigern. Aufgrund der Tonsatzvorkenntnisse der Studenten füge ich zu den ein- und zweistimmigen kontrapunktischen Diktaten sofort Generalbassdiktate oder Kantionalsätze hinzu. Erst danach lasse ich dreistimmige polyphone Beispiele und endlich vierstimmige Bachchoräle oder andere aus dem Orchester- und Kammermusikrepertoire entnommene Literaturbeispiele aufschreiben. Das Üben des harmonischen (tonalen wie atonalen) Hörens wurde überhaupt zum Schwerpunkt meines Unterrichts. Übungen am Klavier, die die Studenten selbstständig durchführen und üben können, werden dafür als Hausaufgaben verteilt. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn die Studenten über ein entsprechendes Niveau im Klavierspiel verfügen.
Exkurs: Das besondere Problem des deutschen Buchstabensystems und des absoluten oder relativen Solmisationsystems[5]
Ob die Anwendung der Notennamen ›do-ré-mi-fa-sol-la-si‹ gegenüber dem Gebrauch der deutschen Notennamen ›ces-c-cis / des-d-dis / es-e-eis (usw.)‹ für ein schnelles Assoziieren von Klang und Notenbild Vorteile hat, ist ein Streitpunkt zwischen Gehörbildungspädagogen. Der unmittelbare Vorzug der Solmisationssilben besteht darin, dass sie auf Grund ihrer sehr einfachen Aussprache eine Geschwindigkeit beim Sprechen, Singen und Assoziieren erlauben, die mit den deutschen Silben nicht zu erreichen ist. Diese Praktikabilität der Solmisationssilben korreliert mit dem Schwerpunkt der französischen Unterrichtstradition auf Schnelligkeit bei Lesen, Blattsingen und Diktaten sowie auf der Fähigkeit zu unmittelbarer Assoziation von Notenbild und Klang. Die Verwendung der absoluten Solmisation[6] hat mit großer Sicherheit Einfluss auf die Entwicklung des Absoluthörens. Allerdings sind auch ein gewisser Mangel an Flexibilität der Absoluthörer (vor allem der Pianisten), was die Intonation betrifft (denn das absolute Hören ist meistens eng verknüpft mit der gleichschwebenden Temperatur), und eine demgegenüber oft besser entwickelte Anpassungsfähigkeit der Nicht-Absoluthörer an andere Stimmungssysteme festzustellen. Die reflexhafte, unmittelbare Assoziation der absoluten Tonhöhe mit der dazugehörigen Tonsilbe erwerben die mit dem deutschen System groß gewordenen Musiker nicht. Daher hat die deutsche Gehörbildungspädagogik Hörstrategien für ein globales Erkennen von Akkordtypen entwickelt. Das ›Denken mit Solmisationssilben‹ bringt dann Probleme mit sich, wenn ein ›simultanes Übersetzen‹ von Nöten ist, weil ein anderes ›muttersprachliches‹ System vorausgeht. Es kommt zu Sprachproblemen, die denjenigen eines Ausländers vergleichbar sind, der sich in einer Fremdsprache ausdrückt: Die Reflexe sind langsamer, die Konfusion zwischen ähnlichen Wörtern häufig, das Übersetzen dauert sehr lange, Stresssituationen oder Müdigkeit vergrößern die Probleme, Unsicherheit wächst. Notennamen sind sehr stark mit der kulturellen Identität eines jeden Musikers verbunden! Deshalb war es mein Anliegen, den Studenten solch schwierige und destabilisierende Gehirngymnastik zu ersparen und mich selber mit den verschiedenen Systemen so weit vertraut zu machen, dass ich die Studenten in ihren eigenen Notennamen-Sprachen verstehen und korrigieren konnte. Das übergeordnete Ziel des Gehörbildungsunterrichts, insbesondere für Komponisten und Dirigenten, blieb für mich jedoch die Entwicklung schneller Hörreflexe für ein gleichzeitiges ›Umsetzen des Gehörten in Notenbild‹: Alles, was die Geschwindigkeit bei diesem Prozess stören könnte, sollte vermieden werden. Daher musste ich versuchen, für das Erlernen dieses gleichzeitigen ›Hörens-Sehens‹ bzw. ›Klang-Notenbild-Assoziation‹, eine andere pädagogische Strategie für meine Studenten zu finden als die Benutzung der Solmisationssilben.[7]
Curriculum
I. Übersicht
Bevor ich einige der von mir im Unterricht verwendeten spezifischen Übungen im Detail präsentiere, scheint es mir notwendig, einen Überblick über den Aufbau der gesamten Hörausbildung, wie ich sie in Wien anbiete, zu geben. Einige Diktatbeispiele, die keiner besonderen Erklärung bedürfen, sollen hier ein besseres Bild von den Anforderungen vermitteln. Über andere Übungsformen werde ich anschließend ausführlicher sprechen. Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen, beschränke ich mich auf Beispiele für den Parameter Tonhöhe und werde weder über rhythmische Übungen noch über Lesearbeit ausführlich schreiben.
Erster Studienabschnitt
Um der schon angesprochenen Absicht gerecht zu werden, im ersten Studienabschnitt eine aufbauende technische Arbeit anzubieten, erweist es sich als effizienter und zeitsparender, vorwiegend selbst geschriebene und auf bestimmte Schwierigkeiten fokussierte Diktatübungen zu verwenden, wenngleich auch Literaturbeispiele dabei nicht ausgeschlossen sind. Alle Diktate werden infolgedessen am Klavier gespielt.
Gehörbildung 1. Semester
mündlich:
Leseübungen im Altschlüssel[8], dann mit Schlüsselwechseln.
Blattsingen alter Musik im Altschlüssel.
Systematisches Üben von Grundrhythmen mit Unterteilungswechseln (Achteltriole, Sechzehntelgruppen, Sechzehntelquintole, Sechzehntelsextole usw., und deren Variationen). Üben der ternären Taktarten ohne Unterteilung, Variationen von allen Grundrhythmen mit Zweiunddreißigstelwerten.[9]
Systematische Singübungen mit großen und kleinen Sekunden, im tonalen sowie im atonalen Zusammenhang, mit den Kirchentonarten und Messiaen-Modi (I, II, III), Beispiele 22–29.[10] Blattsingen von Themen aus der Literatur, die diese Intervalle verwenden (Messiaen, Bartok, Krenek u.a.).
Üben des inneren Gehörs (melodisch) anhand der Intervallübungen mit großen und kleinen Sekunden.
schriftlich:
Schreibübungen bzw. Diktate ›im Flug‹, d.h. im schnellen Tempo, mit folgenden Schwerpunkten:
a. transponierte Kirchentonarten und Messiaen-Modi,
b. Erkennen von Lagenwechseln mit drei verschiedenen Tönen (siehe Beispiel 1).
c. Vorbereitung des atonalen Hörens durch Diktate mit bestimmten Intervallen (ohne Rhythmus, den mündlichen Singübungen entsprechend, siehe Beispiel 2).Einfache tonale ein- und zweistimmige Diktate ohne Angabe von Tonart, Modus, Takt oder Metrum.
Rhythmische einstimmige Diktate ohne Angabe von Taktart und Metrum.
Beispiel 1
Beispiel 2
Gehörbildung 2. Semester
mündlich:
Leseübungen im Tenorschlüssel[11], dann mit Schlüsselwechseln (Tenor-, Alt-, Violin- und Bass-Schlüssel).
Fortsetzung der rhythmischen Arbeit des 1. Semesters. Leseübungen mit einfachen Taktwechseln, aber schweren Rhythmen, und mit allen Arten von Synkopen.
Systematische Singübungen mit großen und kleinen Terzen[12], im tonalen sowie atonalen Zusammenhang. Bewusstmachen der Problematik des ›puren Intervalldenkens‹ ohne Rücksicht auf die verwendete Tonsprache. Verwendung von tonalen Akkordfarben im atonalen Zusammenhang (Messiaen). Üben des inneren melodischen Gehörs anhand der Intervallübungen mit großen und kleinen Terzen.
Improvisations- und Singübungen mit der ›tonalen Leiter‹:[13] gleichzeitig Intervalle, harmonische Führung und harmonisches Gerüst der improvisierten Melodie, Notennamen, Stufen und Funktionen bewusst denken.
schriftlich:
Tonale ein- und zwei bis drei-stimmige Diktate ohne Angabe von Tonart, Modus, Takt oder Metrum. Beispiele in Tonarten mit zunehmender Anzahl an b oder #, mit mehr Modulationen und chromatischen Motiven bzw. chromatischem harmonischem Gerüst. Bei polyphonen Diktaten finden zunächst Doppelkontrapunkte und Fugatos Verwendung: Da thematische Stimmen leichter zu erkennen und zu verfolgen sind als freie, verringert sich die Angst vor dem Hören von Bass- und Mittelstimmen (siehe Beispiele 3a und 3b).
Rhythmische einstimmige Diktate ohne Angabe der Taktart und des Metrums, mit vielen Synkopen und Unterteilungswechseln.
Vierstimmige Sätze der Renaissance- und Barockzeit (z.B. von Cl. Goudimel, M. Praetorius, J. Crüger, M. Vulpius, S. Scheidt, J. Pachelbel, D. Buxtehude, G. Boehm u.a.) und einfache Generalbassdiktate (z.B. Beethoven- und Mendelssohn-Lieder, Concerti von Telemann, Corelli, Vivaldi etc.). Die Sätze sind vollständig aufzuschreiben, bei Generalbassdiktaten wird die Bassstimme entweder mit Generalbassbezifferung oder mit Funktionszeichen notiert.
Beispiel 3a
Beispiel 3b
Gehörbildung 3. Semester
mündlich:
Leseübungen im Sopranschlüssel[14], dann mit Schlüsselwechseln (Sopran-, Tenor-, Alt-, Violin- und Bass-Schlüssel).
Fortsetzung der rhythmischen Arbeit des ersten Jahrgangs. Systematisches Üben aller Taktarten (z.B. 9/16, 12/16, 6/4, 9/4, 3/2) einschließlich der ungeraden (5/4 und 7/4, 7/8 und 5/8, 8/8).
Systematische Singübungen mit reinen Quarten und Quinten[15], im tonalen sowie atonalen Zusammenhang.
Üben des inneren melodischen und harmonischen Gehörs anhand der Intervallübungen mit Quarten und Quinten sowie anhand von Chorälen und harmonischen Sequenzen.
Improvisations- und Singübungen mit der ›tonalen Leiter‹:[16] Fortführung der Arbeit des zweiten Semesters mit dem Üben aller Tonarten und aller harmonischen Funktionen inklusive alterierter Akkorde.
Blattsingen von Bach-Rezitativen.
Vokalimprovisation von einfachen Kadenzen und Modulationen.
Inneres Hören im tonalen Zusammenhang: Übungen mit ›polyphonen Chorälen‹ (von Scheidt, Pachelbel, Bach u.a.).
schriftlich:
Diktate ›im Flug‹, d.h. ohne Rhythmus und im schnellen Tempo, mit folgenden Schwerpunkten:
a. Lagenerkennen und Lagenwechsel mit vier Tönen (diatonisch und chromatisch).
b. Vorbereitung des atonalen Hörens mit Diktaten ohne Rhythmus, auf spezielle Intervalle (den mündlichen Singübungen entsprechend) bezogen.
c. Funktionsdiktate mit Lagenwechseln in schwierigen Tonarten.Dreistimmige tonale polyphone Diktate, in Tonarten mit vielen Vorzeichen (siehe Beispiel 4).
Generalbassdiktate: Wiener-Klassik und Lieder von Schubert oder Schumann.
Freitonale und ›leicht‹ atonale Diktate mit großem Ambitus (im Bass- und Violinschlüssel notiert), mit rhythmischen Schwierigkeiten, ohne Angabe von Takt oder Metrum (siehe Beispiele 5 und 6).
Beispiel 4
Beispiel 5
Beispiel 6
Gehörbildung 4. Semester
Da die Studenten unmittelbar vor der ersten Diplomprüfung stehen, wird im 4. Semester nur ein intensives schriftliches Training durchgeführt.
Schwierige einstimmige atonale Diktate mit großem Ambitus (in Bass- und Violinschlüssel notiert) und mit schwierigem Rhythmus (siehe Beispiel 7).
Vierstimmige Bachchoräle, am Klavier gespielt (z.B. Breitkopf & Härtel, 389 Choralgesänge, Choräle Nr. 203, 209, 226 228, 239 und 367).
Atonale Akkorddiktate von einzelnen Drei- und Vierklängen (siehe Beispiel 8).
Chromatische Modulationen: entweder von mir geschriebene Beispiele oder Literaturauszüge. Die Studenten können sie entweder vierstimmig aufschreiben, die Bassstimme mit Generalbassbezifferung notieren oder die Funktionsbezeichnungen verwenden (siehe Beispiele 9 bis 14).
Fehlererkennen in atonalen Übungen mit großem Ambitus und Lagenwechseln.[17]
Beispiel 7
Beispiel 8
Beispiel 9
Beispiel 10
Beispiel 11
Beispiel 12
Beispiel 13
Beispiel 14: Robert Schumann, 1. Streichquartett in a-Moll op. 41, I. Satz, Takte 117–-137
Zweiter Studienabschnitt
Gehörbildung 5. und 6. Semester
mündlich:
Fortsetzung der Leseübungen in fünf Schlüsseln.[18]
Systematische Singübungen mit übermäßigen Quarten und verminderten Quinten:[19]
a. Auflösung von Dominantseptakkorden und Nonenakkorden, Tristan-Akkord,
b. Tritoni im atonalen Zusammenhang (siehe Beispiele 15 bis 17).Entwicklung des inneren harmonischen Hörens im atonalen Zusammenhang: Arbeit mit Partituren von A. Pärt, A. Heiller, A. Schönberg, W. Lutoslawski, O. Messiaen u.a.
Blattsingen von schwierigen Übungen mit zahlreichen Schlüsselwechseln, mit Klavierbegleitung.[20]
Blattsingen mit Klavierbegleitung: Werke von ca. zwei Komponisten pro Semester aus folgenden Stilrichtungen (das Blattsingen wird systematisch mit Analyse – Harmonik und Tonsprache, Form, Ästhetik – verbunden):
a. ein deutscher Romantiker (Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt, Wolf),
b. ein französischer Komponist (Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc),
c. ein Komponist der Wiener Schule (Schönberg, Webern, Berg),
d. Werke von Schreker, Krenek, Messiaen, Mussorgsky, Britten.Rhythmische Übungen mit schwierigen Taktwechseln (vor allem mit komplexen Taktrelationen und Wechseln zwischen unverändertem Schlag oder unveränderter Schlagunterteilung) und unregelmäßigen Taktarten (Bartok, Strawinsky u.a.).[21] Die hinzugefügten Werte bei Messiaen.
Beispiel 15(a-d): Tonales Denken, der Dominantseptakkord
Beispiel 15a
Beispiel 15b
Beispiel 15c
Beispiel 15d
Beispiel 15(e-f): Atonales Denken: Zweistimmige Fortschreitungen, entweder mit Vorhalten zu reinen Quinten oder mit parallelen Tritoni
Beispiel 15e
Beispiel 15f
Beispiel 16(a-b): Der Dominantnonenakkord: tonale Auflösung, Tritoni in der Oktatonik (1. Modus von Olivier Messiaen)
Beispiel 16a
Beispiel 16b
Beispiel 17a: Verschiedene Auflösungen, Modulationskette, Doppeldominante und übermäßiger Sextakkord
Beispiel 17(b-c): Atonale Denkweise – Achsentöne und deren Umspielungen.
Beispiel 17b
Beispiel 17c
schriftlich:
›Technische‹ Arbeit
a. weitere Intervalldiktate ›im Flug‹, ohne Rhythmus.
b. atonale Akkorddiktate von einzelnen Vier- bis Fünfklängen (siehe Beispiel 18).
c. einstimmige atonale Diktate mit schwierigem Rhythmus.
d. Fehlererkennungsübungen mit Literaturbeispielen (Beispiele 35–37).Lückendiktate mit Beispielen aus der Literatur (Orchester-, Kammer- Chor- und Instrumentalmusik von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert). Schwerpunkt auf dem Repertoire des 20. Jahrhunderts (siehe Beispiele 38 bis 42).
Beispiel 18
Gehörbildung 7. und 8. Semester: Klangfarbenerkennen und Höranalyse
Systematische Hörübungen zum Parameter ›Klangfarbe‹ die im Curriculum bislang fehlen, werden im letzten Jahrgang durchgehend betrieben, insbesondere anhand des Repertoires vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (Strawinsky, Ravel, Debussy, Milhaud, Poulenc, Dutilleux, Borodin, Mussorgsky, Rimsky-Korssakow, Prokofieff, Mahler, Webern, Schönberg, Berg, Janacek, Bartok). Es wird mit oder ohne Zuhilfenahme eines Particells geübt.
Die Höranalyse dagegen wird mit Beispielen aus dem gesamten Repertoire der europäischen Musik bestritten. Die Studierenden sollen mit rhythmischen und formalen Strukturen, Klangphänomenen sowie Aspekten der Zeitbehandlung bzw. der Zeitwahrnehmung konfrontiert werden. Das Hören soll alle musikalischen Parameter einbeziehen: Besetzung und Behandlung der Instrumente bzw. Stimmen; Gattung; Charakter, Stil, geschichtliche und geographische Situation; Tonsprache; Agogik, Metrik und Rhythmik; Dynamik; Form. Ziel ist es, über eine reine Beschreibung der Abfolge der verschiedenen musikalischen Ereignisse zu einer tief greifenden Analyse zu gelangen. Diese sollte sich nicht auf die instinktive Wahrnehmung der Musik beschränken, sondern die Homogenität des musikalischen Materials und die Interaktion der einzelnen Elemente erfassen und die Einheitlichkeit des Stückes ans Licht bringen. Erst mit einem klaren und präzisen Verständnis der engen Verknüpfungen kann das globale Hören eines musikalischen Werkes zu einem Hör-Erlebnis werden. Schönberg formulierte es so: »Von einem Kunstwerk darf man nicht träumen, sondern man muss sich anstrengen, seine Bedeutung zu erfassen.«[22]
Zur Unterrichtspraxis. Einige Beispiele zur Hörschulung
Intervallarbeit
Wie bereits erwähnt, stellte ich gleich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit in Wien fest, wie wichtig das ›Intervallhören‹ in der deutschsprachigen Gehörbildung ist: Das bloße sensorische Üben der Intervalle scheint die Grundlagenarbeit im Fach Gehörbildung zu sein, während – für mich dazu im Widerspruch – das harmonische Hören vorwiegend im globalen Erkennen der tonalen Funktionen besteht.
Bei diesem sensorischen und globalen Hören fehlt grundsätzlich das bewusste Üben der ›schwierigen‹ Tonarten (mit mehr als drei Vorzeichen), und das Reduzieren auf ein chronologisches sukzessives Hören einzelner Intervalle erschwert und verlangsamt die Wahrnehmung eines breiteren Melodiebogens und dessen Strukturen im tonalen sowie im atonalen Zusammenhang. Anderseits erscheint mir die dadurch festgehaltene Trennung zwischen melodischem und harmonischem Hören musikalisch gesehen nicht sehr sinnvoll. Die Wahrnehmung eines jeden Intervalls ist für mich vom melodischen, kontrapunktischen oder harmonischen Zusammenhang abhängig: Ich bin überzeugt, dass jedes Intervall nur im Verhältnis zu einer bestimmten Umgebung als charakteristisch empfunden wird.
Betrachtet man – abgesehen von der Notation – die Sopranstimme des folgenden Beispiels: Wird das Intervall bei den hier angegebenen zwei möglichen Harmonisierungen gleich wahrgenommen – bzw. gleich gesungen oder gespielt? Wird in diesem Beispiel vorwiegend die Harmoniefolge oder das melodische Intervall der Sopranstimme wahrgenommen?
Beispiel 19
Natürlich lässt sich einwenden, es handle sich um den Unterschied zwischen enharmonisch verschiedenen, jedoch klanggleichen Intervallen. Genauso wäre es z.B. im Falle einer absteigenden großen Terz und einer absteigenden verminderte Quart:
Beispiel 20
Doch in der Bassstimme der folgenden Beispiele (a und b) geht es bei den zwei verschiedenen Harmoniefolgen um dieselbe absteigende große Terz. Wird diese wirklich als Intervall wahrgenommen, oder wird das Ohr eher auf einen Akkordwechsel (V-I), auf einen bloßen Positionswechsel (d.h. keine wesentliche klangliche Veränderung) – und im dritten Fall (c) auf eine Modulation reagieren? Im Beispiel a nehme ich weniger das Intervall der großen Terz wahr als vielmehr die Folge ›Dominant zur charakteristischen Mollterz der Tonart‹: Im Vordergrund steht die Wahrnehmung tonaler Funktionen und nicht die Wahrnehmung eines Intervalls.
Beispiel 21
Mir sind hauptsächlich zwei Autoren bekannt, die ein systematisches Intervalltraining entwickelt haben: Lars Edlund, dessen Modus Vetus – Modus Novus[23] auch im deutschsprachigen Raum als Schlüsselwerk betrachtet wird, und das speziell für Sänger konzipierte Lehrbuch von Marie-Claude Arbaretaz Lire la musique par la connaissance des intervalles.[24] In ihrer Einleitung schreibt Arbaretaz: »Die musikalische Ausbildung beruht in Frankreich ausschließlich auf dem Prinzip des absoluten Hörens, d.h. auf der Fähigkeit, einen Klang mit dem Notennamen, der ihn bezeichnet, unmittelbar zu assoziieren. Ist das absolute Hören aber wirklich notwendig?«[25] Und weiter: »Das relative Hören entspricht dem Sinn für die Intervalle und ist daher ein ziemlich sicheres Kriterium für die Musikalität. Die Ausbildung des relativen Hörens ist also Ziel dieses Lehrbuchs. Mehr als das Aufeinanderfolgen von isolierten Klängen entsteht die Musik durch die Beschaffenheit der Klangfolge.«[26] Diese Position entspricht der im deutschsprachigen Raum verbreiteten Definition des absoluten Hörens als einem Erkennen einzelner Töne ohne Berücksichtigung der Beziehung zwischen ihnen (ein ›dummes‹ Hören also), demgegenüber das relative Hören als Erkennen des Verhältnisses zwischen zwei Tönen verstanden wird. Dabei gilt aber die Intervallstruktur als ›die musikalische Struktur‹ schlechthin. Gegen dieses Klischee ist schwer anzukommen. Absoluthören kann manchmal eindeutig von Vorteil (z.B. im Umgang mit zeitgenössischer Musik), manchmal aber auch von Nachteil sein (z.B. für das Renaissance- oder Barockrepertoire). Solche globalen Vorurteile sollten fallen gelassen werden, da man dabei wesentliche Unterschiede zwischen Instrumenten, Stilepochen, beruflicher Tätigkeit usw. einfach ignoriert. Sowie jeder Absoluthörer unbedingt eine spezifische (meist kognitiv orientierte) Hörausbildung braucht, die auf das Verstehen der musikalischen Syntax zielt, sollte bei Nicht-Absoluthörern stärkeres Gewicht auf sensorielle Übungen für die Wahrnehmung der tonalen Funktionen gelegt werden. Der Versuch, bei meinen Studenten ein absolutes Gehör zu entwickeln, wäre – selbst wenn es tatsächlich realisierbar gewesen wäre – nicht in meinem Sinn gewesen. Mein Ziel war eher, bei ihnen ein relatives Hören mit unmittelbarem (deutschen) Notennamen-Denken zu entwickeln und sie zum richtigen Verstehen musikalischer Strukturen zu führen, was sich für mich aber auf keinen Fall auf das bloße Intervalldenken beschränken lässt.
Marie-Claude Arbaretaz bietet eine Reihe von systematischen Übungen für alle Intervalle an, hauptsächlich in Form von Sequenzen und Blattsingübungen, die für eine grundsätzliche sensorische melodische Arbeit (Transposition ohne Notennamen) und eine Entwicklung der Lesefähigkeiten sorgen sollen.
Beispiel 22: Arbaretaz 1979, Bd. 1, S. 10, Sequenz für die Arbeit mit kleinen und großen Sekunden und ihre Umkehrung
Das systematische Transponieren vorgegebener melodischer Muster bildet die Basis der Intervallarbeit – nicht nur als sensorielle Grundübung, sondern auch als Übung zum Notennamen-Denken. Zu diesen rein melodischen Singübungen füge ich für die Komponisten und Dirigenten (das Lehrbuch von Marie-Claude Arbaretaz ist für Sänger konzipiert worden) harmonische (tonale oder atonale) Spielübungen bestehend aus verschiedenen Harmonisierungen dieser Sequenzen hinzu.
Folgende Richtlinien gelten grundsätzlich für das Üben:
Die Sequenzen sollen beim Singen und Transponieren immer mit Notennamen in der eigenen Muttersprache geübt werden.
Das Tempo sollte beim Singen weder zu schnell noch zu langsam gewählt werden: Es sollen keine isolierten Intervalle gesungen werden, denn eine richtige Intonation wird nur erreicht, wenn ein musikalischer Zusammenhang spürbar bleibt.
Die Sequenzen werden unbegleitet und in Verbindung mit verschiedenen tonalen und atonalen Harmonisierungen am Klavier geübt. Die hier vorgeschlagenen Harmonisierungen sind lediglich als Beispiele gedacht, andere Möglichkeiten können erfunden werden.
Auf keinen Fall ›mit den Fingern‹ transponieren! Die Transposition ist am Anfang eine reine ›Denkarbeit‹, bevor dieses Denken mit dem Hören automatisch funktioniert.
Harmonisierungsbeispiele:
Für das oben angeführte Beispiel bietet sich eine Begleitung in Gegenbewegung an.
Beispiel 23
Weitere tonale Harmonisierungsmodelle sind vierstimmig am Klavier leicht realisierbar:
mit diatonischen Modulationen (Beispiele 24, 25 u. 26).
mit der neapolitanischen II. Stufe (Beispiele 27 u. 28).
Beispiel 24
Beispiel 25
Beispiel 26
Beispiel 27
Beispiel 28
Einstimmige Blattsingübungen von Marie-Claude Arbaretaz vergrößern die Vertrautheit mit den geübten Intervallen:
Beispiel 29: Marie-Claude Arbaretaz 1979, Bd. 1, S. 11 (Achtel = 69–72)
Dennoch bietet sich meiner Meinung nach auch hier eine Reihe von zusätzlichen atonalen Begleitungsmöglichkeiten an, die als Übung der Konzentration und der Stabilisierung der Intonation dienen können:
Im Kanon singen und spielen: mit der Stimme beginnen, mit dem Klavier im Achtel- oder Viertel-Abstand in der Oktave und/oder unisono einsetzen (dies entspricht dem Prinzip der Mikropolyphonie von Ligeti).
Singen mit improvisierter Klavierbegleitung colla parte eine große Sekunde oder große Terz tiefer oder höher, oder in zwei parallelen großen Terzen (Harmonien der Ganztonleiter).
Singen mit improvisierter Klavierbegleitung in Spiegelbewegung.
Singen mit frei improvisierter atonaler harmonischer Klavierbegleitung, scharf dissonant.
Singen mit frei improvisierter atonaler kontrapunktischer Klavierbegleitung zwei- oder dreistimmig.
Weiter sollte das innere Hören anhand dieser Übungen (in einem vorher gewählten, nicht übertrieben langsamen Tempo) geübt werden.
Tonales Hören: Übungen mit der ›tonalen Leiter‹ (›l’échelle tonale‹)
Bei den Singübungen mit der ›tonalen Leiter‹ wird ein bewusstes gleichzeitiges Denken/Hören von tonalen Funktionen, Intervallen und Notennamen erzielt. Es handelt sich prinzipiell um Improvisationsübungen, die sich als Hausaufgaben besonders gut eignen, wenn auch bestimmte Kadenzformeln und harmonische Sequenzen als Muster vorgelegt werden. Dabei sollten alle Dur- und Moll-Tonarten, einschließlich der Tonarten mit vielen Vorzeichen geübt werden, um die damit verbundenen Leseschwierigkeiten beim Blattsingen zu bewältigen. Die zu singenden Stufen werden auf der ›tonalen Leiter‹ vom Lehrer gezeigt und in der vorher ausgewählten Tonart von den Studenten mit Notennamen gesungen.
Abb. 1: Die ›tonale Leiter‹
Improvisation mit den Grundstufen I., IV., V. und dem Leitton (Üben leichter Kadenzformeln und der großen Sept I-VII, Beispiel 30).
Weitere Improvisation mit der I., IV., V. und II. Stufe. Das folgende Beispiel kann in Dur und auch in Moll gesungen werden. Mit den gewählten Stufen kann ein Dominantseptakkord gebildet werden (Üben des Tritonus und dessen Auflösung, Beispiel 31).
Melodische Kadenzen und Tonleitern singen, in Dur und in Moll: Die III. und VI. Stufe bestimmen das Tongeschlecht der gewählten Tonart. Bei Molltonleitern: die VI. und VII. Stufe (›bewegliche Stufen‹) sollen besonders geübt werden (Beispiele 32a u. 32b).
Weiteres Üben der Auflösung des Dominantseptakkords. Drei- und Vierklänge, die auf der I. und V. Stufe aufbauen (Beispiel 33a).
Jeweils vom Basston aus aufwärts die einzelnen Akkordtöne singen. Die gesamte Akkordfolge dann innerlich hören und am Klavier kontrollieren (Beispiel 33b).
II. und IV. Stufe als Vorbereitung des Dominantakkordes (Üben von Drei- und Vierklängen mit deren Umkehrungen und Auflösungen, Beispiele 34a, 34b u. 34c).
Harmonisches (inneren) Hören durch vertikales Singen von Kadenzen und Chorälen weiter üben.
Blattsingen von Bach-Rezitativen – die beste Blattsingschule, die es gibt!
Beispiel 30
Beispiel 31
Beispiel 32a
Beispiel 32b
Beispiel 33a
Beispiel 33b
Beispiel 34a
Beispiel 34b
Beispiel 34c
Fehlererkennen in Literaturbeispielen
Aus meiner eigenen Studienzeit in Frankreich kannte ich die selbst geschriebenen und am Klavier gespielten Übungen zum Fehlererkennen (Alterations- und Lagenfehler) von Odette Gartenlaub.[27] Später begann man ähnliche Übungen mit Literaturbeispielen zu verfassen, deren Fehler alle Parameter betreffen konnten: Besetzung, Tempo, Rhythmus, Tonhöhe, Artikulation, Dynamik und Agogik. Da die gehörte Version bei den Studenten meistens besser in Erinnerung bleibt als ein Notentext, der aus dem visuellen Gedächtnis schneller verschwindet, ziehe ich es vor, den Studenten einen fehlerhaften Notentext vorzulegen und eine korrekte Aufnahme abzuspielen. Da Interpretation und Tonqualität der Aufnahme für die Wahrnehmung absolut entscheidend sind, sind diese Übungen unbedingt anhand einer bestimmten ausgesuchten CD vorzubereiten und auszuführen.[28] Bei den folgenden Beispielen wird zuerst der gegebene Text (wobei die Instrumentalbesetzung manchmal fehlerhaft, manchmal zu ergänzen ist), dann die originale Version gezeigt.
Beispiel 35a: Darius Milhaud, Suite (d’après Corette), VII. Menuets, fehlerhafte Version
Beispiel 35b: Darius Milhaud, Suite (d’après Corette), VII. Menuets, Original
Beispiel 36a: Hanns Eisler, Kleine Sinfonie op. 29, III. Invention (Variationen 21–22), fehlerhafte Version
Beispiel 36b: Hanns Eisler, Kleine Sinfonie op. 29, III. Invention (Variationen 21–22), Original
Beispiel 37a: György Ligeti, Sonate für Solo Viola, III. Facsar, ab T. 70, fehlerhafte Version
Beispiel 37b: György Ligeti, Sonate für Solo Viola, III. Facsar, ab T. 70, Original
Lückendiktate (›dictées à trous‹) in verschiedenen Besetzungen und Schwierigkeitsgraden
Lückendiktate, eine weitere Übung, die durch die Reform der französischen Gehörbildung aufkam, biete ich im dritten Jahrgang an. Als Grundlage dienen Beispiele aus der Orchester-, Kammermusik oder eventuell Solo-Instrumentalmusik (außer Klavier). Die Lücken sind von den Studenten zu ergänzen. Zusätzlich zum Vorteil der Hörübungen mit anderen Klangfarben als dem Klavierklang und der direkten Konfrontation mit bestimmten Leseschwierigkeiten von Orchesterpartituren (z.B. transponierende Instrumente) bieten diese Übungen eine hervorragende Möglichkeit, folgende Schwierigkeiten gezielt anzugehen:
Eine Kombination von Schreibautomatismen und Gedächtnisarbeit ist wegen des Tempos der Literaturausschnitte erforderlich.
Beim Hören sind die Studenten mit allen agogischen Fluktuationen einer musikalischen Aufführung konfrontiert und müssen einem gewissen Rubato statt einem streng metronomisch gespielten Metrum folgen.
Die im Gehörbildungsunterricht notwendige Trennung zwischen kontrapunktischem und harmonischem Hören ist bei Lückendiktaten mit mehreren Instrumenten oft belanglos. Die zu ergänzenden Mittelstimmen, auf die die Aufmerksamkeit der Studenten sich fokussieren wird, können fallweise besser durch den harmonischen Gesamtklang wahrgenommen werden: Wenn sie keine thematische oder motivische Funktion enthalten und dadurch klanglich nicht hervorgehoben werden, ergibt sich ihre Bedeutung als Füllstimme durch den harmonischen und klanglichen Zusammenhang. Das Kombinieren beider Hörstrategien (›ganzheitliches‹ und ›fokussiertes Hören‹) ist daher eine sehr wichtige Erfahrung insbesondere für zukünftige Dirigenten und Tonmeister.
Beim Barockrepertoire werden bestimmte stilistische Merkmale dieser Epoche erarbeitet, z.B. Unterschiede der damaligen Temperierungssysteme, (meist) tiefere als die gewohnte Stimmung[29], Notationsprobleme der Ornamentik, insbesondere der französischen Barockmusik. Bei einer reich verzierten Melodie sollen die jeweiligen ›Skelette‹ bzw. die harmonisch bedeutenden Strukturtöne der Melodie und die Verzierungen als Ornamente notiert werden (Beispiel 38).
Lückendiktate aus dem Chorrepertoire bedeuten eine besondere Schwierigkeit, da der Chorklang homogener als der im Unterricht üblicherweise verwendete Klavierklang ist (ähnliche Schwierigkeiten bereiten Lückendiktate mit Blechbläserensemble, vgl. Beispiel 39). Die Silben des gesungenen Textes können auch das unmittelbare Notennamendenken bei Absoluthörern und insbesondere bei ›Solmisationsstudenten‹ eventuell stören. Das Problem der Konfrontation von unterschiedlichen Textsilben (insbesondere Vokalen) mit den Notennamensilben beim Hören kann auch bei Literatur für Solo-Sänger auftreten.
Cembalo- und Orgelklang erweisen sich oftmals als problematisch, da die Klangfarben einerseits sehr spezifisch und oft ungewohnt, anderseits besonders reich an Obertönen sind. Auch andere Aspekte der Instrumentation können anhand solcher Lückendiktate angesprochen werden, etwa die Verwendung von Streicherpizzicati oder extreme Orchesterregister (Beispiele 39 bis 41). Lückendiktate bieten insofern einen guten Einstieg in das Klangfarbenerkennen und in spezielle Instrumentationstechniken des 20. Jahrhunderts (Beispiel 42).
Beispiel 38a: Louis-Nicolas Clérambault, Suite du Premier Ton (für Orgel), Récits de cromorne et de cornet séparé en dialogue, Takte 1–19, Lückentext
Beispiel 38b: Louis-Nicolas Clérambault, Suite du Premier Ton (für Orgel), Récits de cromorne et de cornet séparé en dialogue, Takte 1–19, Original
Beispiel 39a: Bela Bártok, Concerto for Orchestra, II. Satz, Allegretto scherzando,Takte 123–158, Lückentext als Kombination eines Lückendiktats (Trompeten und Hörner, Takte 123–146, und Tuba, Takte 147–158) mit einer Fehlererkennungsübung (Hörner, selbe Stelle)
Beispiel 39b: Béla Bártok, Concerto for Orchestra, II. Satz, Allegretto scherzando, Takte 123–158, Original
Beispiel 40a: Alexander Borodin: »Polowetzer Tänze« aus Fürst Igor, Takte 1–14, Lückentext: In diesem Particell sind alle transponierenden Instrumente in C notiert; der Streicherakkord mit Flageolett-Tönen in Takt 14 wurde absichtlich weggelassen.
Beispiel 40b: Alexander Borodin: »Polowetzer Tänze« aus Fürst Igor, Takte 1–14, Original
Beispiel 41a: Béla Bártok, Concerto for Orchestra, III. Satz, Elegia, Takte 1–9, Lückentext
Beispiel 41b: Béla Bártok, Concerto for Orchestra, III. Satz, Elegia, Takte 1–9, Original
Beispiel 42a: Eliott Carter, Eight Etudes and a Fantasy for Woodwind Quartet (1950), V. Satz, Andante, Lückentext
Beispiel 42b: Eliott Carter, Eight Etudes and a Fantasy for Woodwind Quartet (1950), V. Satz, Andante, Original
Schluss
Die Präsentation meines Unterrichtskonzeptes mit einem Teil der in der Praxis erprobten Übungen sollte keinesfalls als Anleitung für ein geschlossenes methodisch-systematisches Vorgehen im Fach Gehörbildung missverstanden werden. Es ist vielmehr Anlass für eine Infragestellung der im Land der eigenen Ausbildung rezipierten und zur Identität gewordenen Hör- und Denkweisen. Eine sinnvolle Methode kann nicht in der Anwendung eines immer gleich funktionierenden Systems bestehen, sondern resultiert aus einem ständigen Anpassungsprozess an ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Situation, so wie es der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wortes ›methodos‹ entspricht.
Anmerkungen
Vgl. Marsyas 27, 1993. | |
In Wien wird die Gehörbildung für Komponisten, Musiktheoretiker, Dirigenten und Tonmeister separat unterrichtet. Die Gehörbildung an den Konzertfach- und Pädagogikinstituten der Wiener Musikuniversität unterscheidet sich sehr stark. | |
Vgl. Mackamul 1969, Kaiser 1998, Kühn 1983. | |
Vgl. de Larminat i.V. | |
Vgl. Laclau 2003. | |
Über die z.B. in Ungarn verwendete relative Solmisation der Kodaly-Methode kann ich im Rahmen dieses Artikels nicht ausführlich reden. | |
Diese Entscheidung wurde sicher auch von meinen eigenen stark ausgeprägten Synästhesien beeinflusst. Es bereitet mir Probleme, die deutschen Buchstaben statt der farbig differenzierteren Solmisationssilben der französischen absoluten Solmisation zu verwenden: mi sagen oder singen ist für mich ›Gelb sehen‹; e hören oder spielen dagegen ist leider ›Schwarz sehen‹. | |
Vgl. Dandelot 1928. | |
Vgl. Gervais 1967. | |
Über Intervallarbeit s.u. | |
Vgl. Dandelot 1928. | |
Über Intervallarbeit s.u. | |
Über die ›tonale Leiter‹ (›échelle tonale‹) s.u. | |
Vgl. Dandelot 1928. | |
Über Intervallarbeit s.u. | |
Über die ›tonale Leiter‹ (›échelle tonale‹) s.u. | |
Vgl. Gartenlaub 1978. | |
Z.B. mit Lehrbüchern von Odette Gartenlaub (1979, 1986). | |
Über Intervallarbeit s.u. | |
Siehe dazu Damase 1955 und 1971. | |
Siehe dazu Gartenlaub 1979, Deschamps-Villedieu 1973 und 1976, Bourdeaux 1975 sowie Forest 1985. | |
Schönberg 1995, Kap. 7 »Schulung des Ohrs durch Komponieren«, 140. | |
Edlund 1963. | |
Arbaretaz 1979. | |
Ebd., 3. | |
Ebd. | |
Siehe dazu Gartenlaub 1978. | |
Bei den folgenden Beispielen wird im Rahmen dieses Artikels auf eine Angabe der Referenzen der im Unterricht verwendeten CDs verzichtet. Bei weiterer Benutzung dieser Übungen sollte jedoch immer deren Realisierbarkeit mit anderen Aufnahmen geprüft werden; Anpassungen müssen fallweise vorgenommen werden. | |
Eine hervorragende Übung für Absoluthörer! |
Literatur
Arbaretaz, Marie-Claude (1979), Lire la musique par la connaissance des intervalles, Paris: Edition Chappell, CSA 14.273.
Bourdeaux, Marie-Jeanne (1975), 25 Leçons progressives de lecture de notes et de solfège rythmique, Volumes IVB et V, Paris: Edition Billaudot.
Damase, Jean-Michel (1955), Quinze leçons de solfège avec accompagnement de piano. Leçons à changements de clés sur toutes les clés, Paris: Edition Henry Lemoine.
––– (1971), Dix-huit leçons de solfège à changement de clés sur trois clés (sol, fa et ut 4è ligne) avec accompagnement de piano, Paris: Edition Henry Lemoine.
Deschamps-Villedieu, J. (1973), Entraînement progressif à la lecture rythmique. 24 exercices de rythme parlé, Paris: Edition Rideau Rouge.
––– (1976), Nouvel entraînement progressif à la lecture rythmique. 21 exercices de rythme parlé ou instrumental, Edition Rideau Rouge.
Dandelot, Georges (1928), Manuel Pratique pour l’étude des clés de sol, fa et ut, Paris: Editions Max Eschig.
Edlund, Lars (1963), Modus Vetus – Modus Novus, Lehrbuch in freitonaler Melodielesung, Edition Wilhelm Hansen/Chester Music, Stockholm/New York, 1963.
Forest, Bernard (1985), Entraînement aux équivalences rythmiques. Niveau Fin d’études, Paris: Edition Choudens.
Gartenlaub, Odette (1978), Dépistage de fautes. 130 Exercices de dictées musicales suivis de 22 fragments à mémoriser, Cahier A et cahier B., Paris: Edition Rideau Rouge.
––– (1979), Clés et Rythmes, Volume I: Clés (5 et 7 clés), Volume II: Rythmes, Paris: Editions Musicales Hortensia.
––– (1986), 40 Lectures de clés (2-3-4 clés), Paris: Editions Musicales Hortensia.
Gervais, Françoise (1967), 60 leçons de solfège rythmique, Paris: Edition Lemoine.
Kaiser, Ulrich (1998), Gehörbildung: Satzlehre – Improvisation – Höranalyse, ein Lehrbuch mit historischen Beispielen, 2 Bde., Kassel: Bärenreiter.
Kühn, Clemens (1983), Gehörbildung im Selbststudium, Kassel: Bärenreiter.
de Larminat, Violaine (i.V.), »Methodologie und Problematik der Höranalyse des Repertoires des 20. Jahrhunderts am Beispiel der ersten ›Offrande‹ von Edgar Varèse«, Bericht über den 2. Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie, München 2002.
Laclau, Hervé (2003), »Solfège – ein Fach für deutsche Musikhochschulen?«, Musiktheorie 18. Jg., Heft 4, 361–372.
Mackamul, Roland (1969), Lehrbuch der Gehörbildung (Bd. I: Elementare Gehörbildung; Bd. II: Hochschulausbildung), Kassel: Bärenreiter.
Schönberg, Arnold (1995), Stil und Gedanke, Frankfurt am Main: Fischer.
Marsyas (Revue de pédagogie musicale et chorégraphique) 27, Septembre 1993, Institut de Pédagogie musicale et chorégraphique, Cité de la Musique, Paris.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.