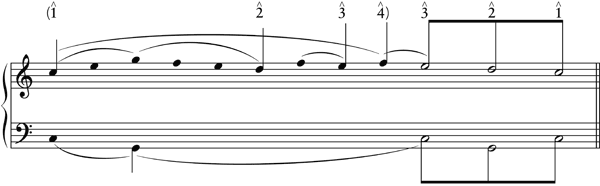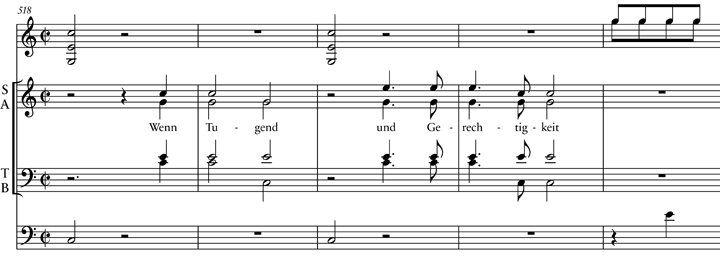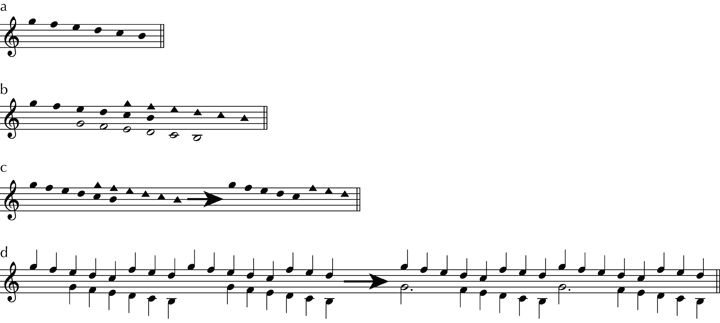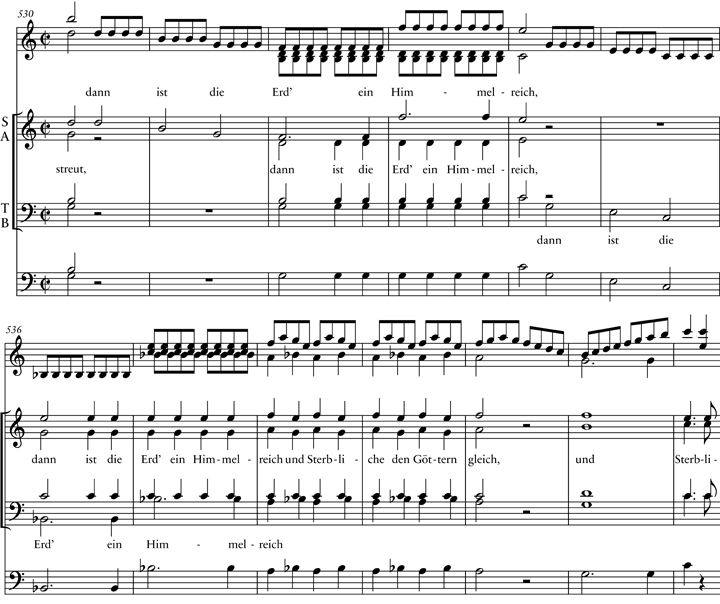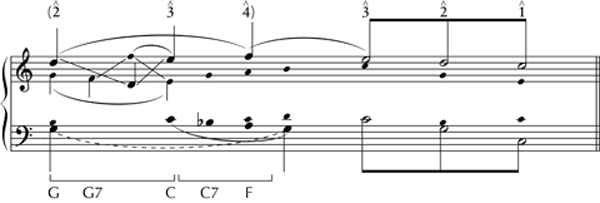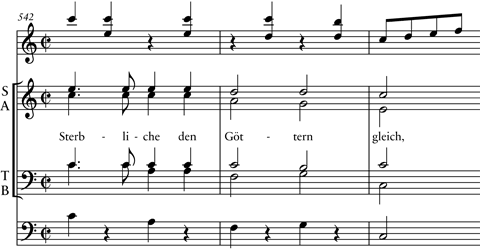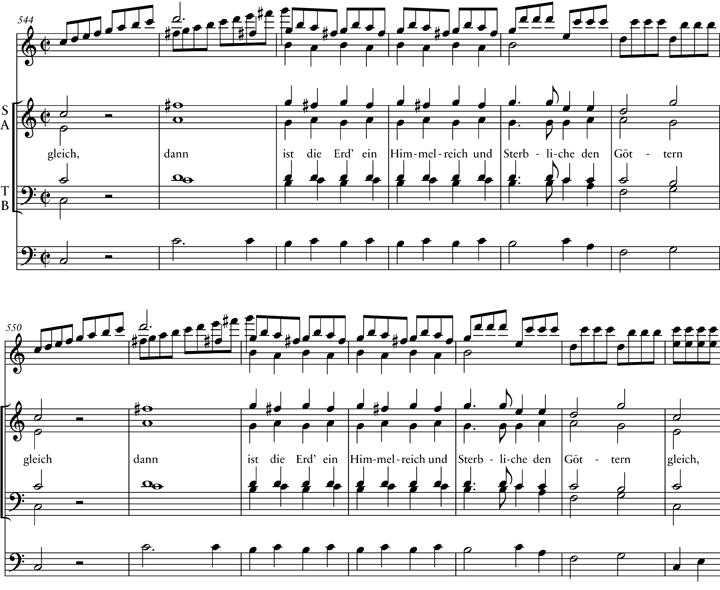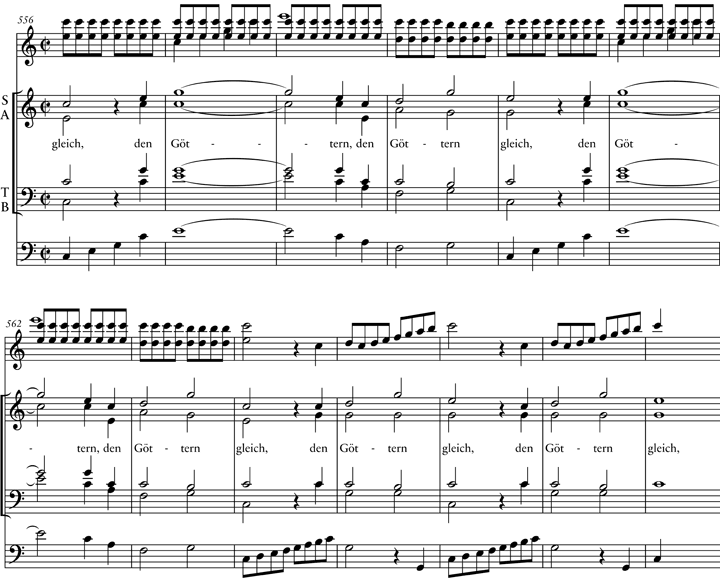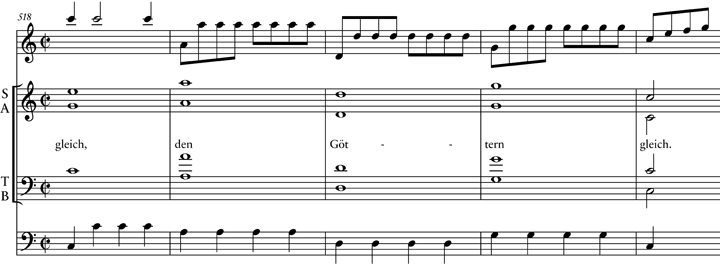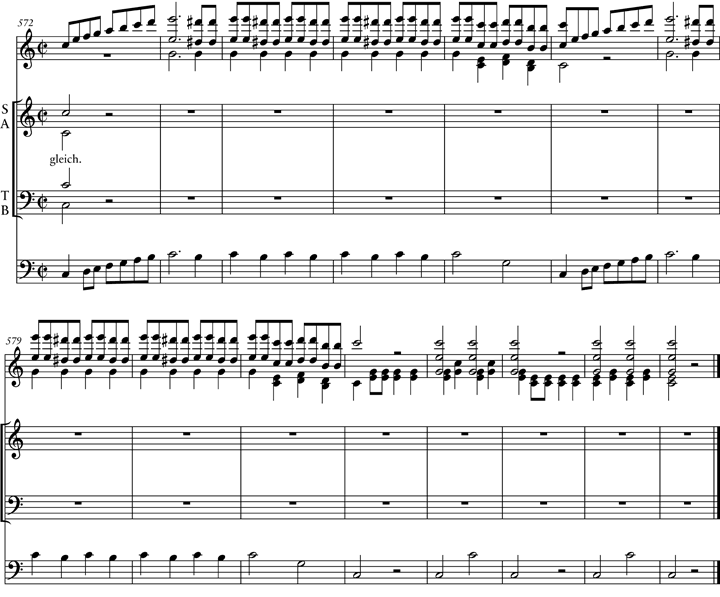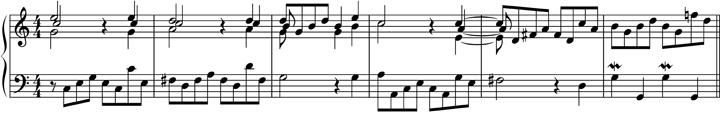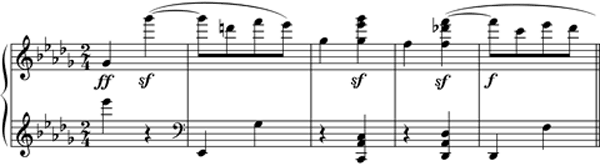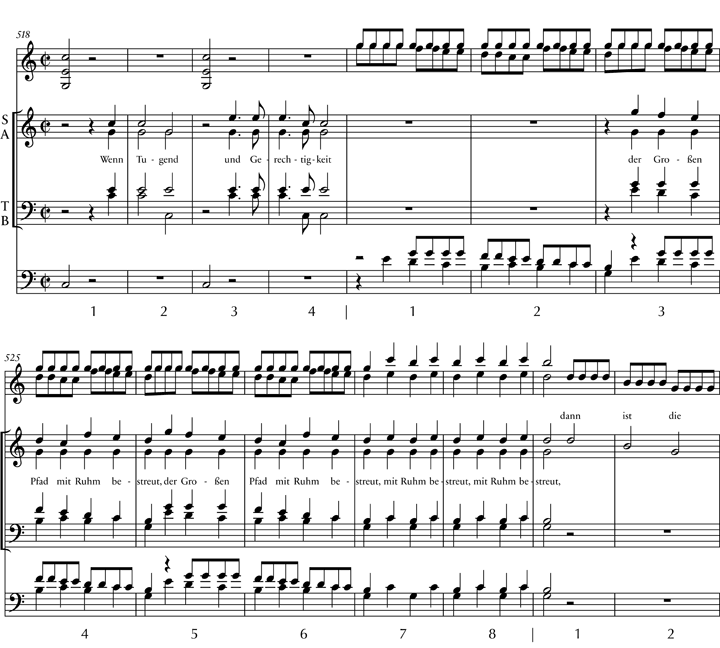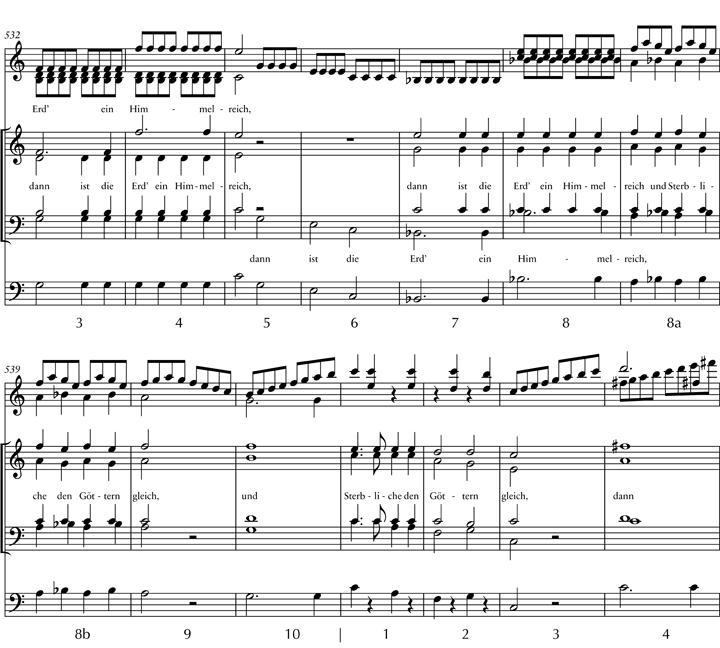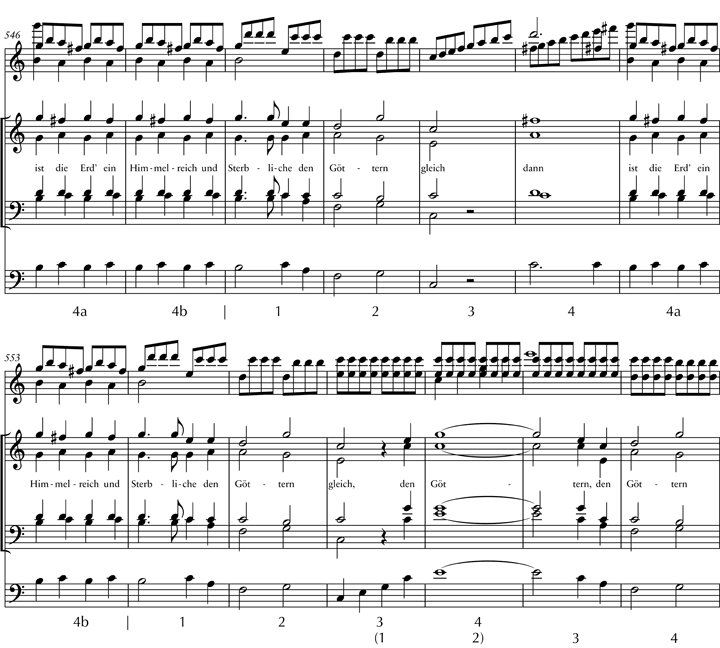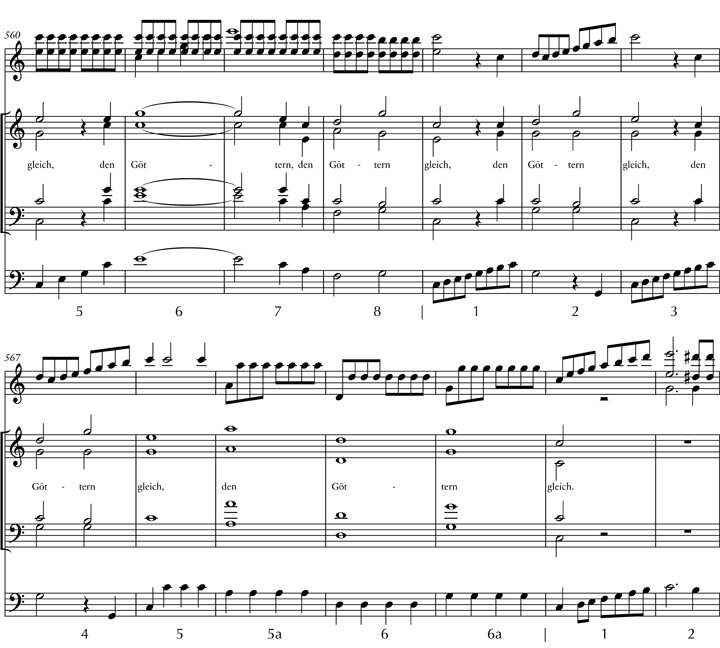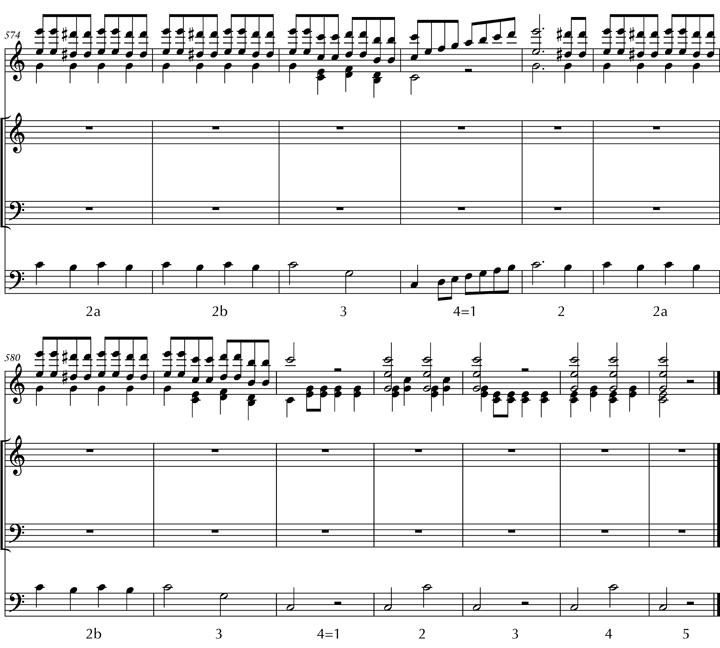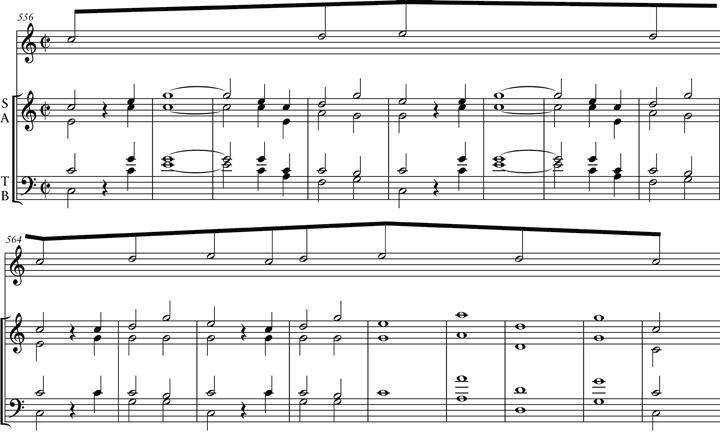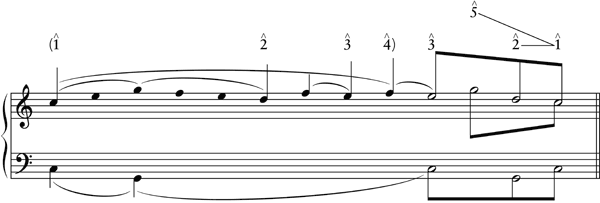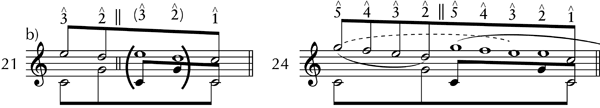Hierarchische und dynamische Einheit
Kontext-Eigenschaften und ›metrische Pfade‹ als Kategorien der Syntaxanalyse bei Mozart
Michael Polth
Die Einheit einer Komposition oder eines Formabschnitts gründet nach Theorien wie derjenigen von Heinrich Schenker darauf, dass sich die erklingenden Ereignisse auf Strukturen beziehen und diese Strukturen wiederum als Teilmomente eines hierarchischen Struktur-Gefüges verstehen lassen, dessen Ganzes durch eine einzige Struktur repräsentiert wird. Bereits in Kompositionen des späten 18. Jahrhunderts jedoch gibt es Formabschnitte, die zwar als einheitlich erfahren werden, deren Einheit aber offensichtlich nicht auf den Bezug zu einer einzigen umfassenden Struktur, sondern auf einen dynamischen ›Zug‹ gründet, der durch alle Ereignisse hindurch zu gehen scheint. Um eine derart ›dynamisch konstituierte Einheit‹ musiktheoretisch zu fassen, müssen die Eigenschaften, die musikalische Ereignisse dadurch besitzen, dass sie Teil einer durch Dynamik gegründeten Einheit sind, als Eigenschaften begriffen und analysiert werden, die allein im ›Kontext‹ entstehen, die sich dem Hörer mithin nur dann zeigen, wenn dieser dem musikalischen Verlauf folgt. Dieses Verfolgen des Verlaufs wiederum wird strukturiert durch das, was in diesem Text als ›metrischer Pfad‹ bezeichnet wird.
According to theories such as that of Heinrich Schenker, the unity of a composition or a formal section is founded on the assumption that its audible manifestation relates to structures. These may in turn be understood as parts of a hierarchically modelled structural framework, which as a whole can be represented by a single structure. However, as early as the late 18th century, one finds formal sections in compositions which, although experienced as an integral whole, obviously do not owe their coherence to a single, all-embracing structure but are based instead on a dynamic progression that seems to be propelled through all the events. In order to address such ‘dynamically constituted unity’ from a theoretical perspective, one must understand that the properties, which define a musical event as part of a dynamically expressed structure, can only be understood and analysed in ‘context’, and therefore only manifest themselves to the listener if he follows the course of the music. In turn, this tracking of the musical process is structured by what is referred to in this text as ‘metric trajectory’.
A. Einleitung
Für musiktheoretische Erklärungen sind die einfachen Beispiele mitunter die schwierigsten. So eines ist der Schlusschor aus dem ersten Akt der Zauberflöte von W.A. Mozart (Beispiel 14). Obwohl Mozart über insgesamt einundvierzig Takte (T. 542–582) Kadenzen aneinander reiht und die Harmonik größtenteils auf die Stufen I und V beschränkt, lässt sich die Musik als dynamisch und einheitlich hören. Beide Eindrücke sind zu unterscheiden (auch wenn sie auf gemeinsamen Voraussetzungen beruhen): Die Dynamik äußert sich im Eindruck von Stringenz oder einem ›Zug‹ auf ein Ende (auf einen Punkt der ›Erfüllung‹) hin. Die Einheit gründet darauf, dass sich die Ereignisse miteinander zu einem Formabschnitt verbinden, der eine einzige Funktion ausprägt. Fast möchte man sagen, am Ende habe man in der Vielzahl der Kadenzen nur eine einzige Schlussformel gehört.
Eindrücke solcher Art begegnen in der Musik des späten 18. Jahrhunderts nicht selten. In zahllosen Sinfonien, Konzerten, Streichquartetten und Sonaten enden Expositionen und Reprisen mit zahlreichen Kadenzen, ohne dass die Reihung gleicher satztechnischer Formeln in jedem Fall als mechanisch oder redundant erlebt würde. Musiktheoretisch stellen Formabschnitte dieser Art eine Herausforderung dar[1], weil die Begriffe Dynamik und Einheit einerseits auf eine Art des Zusammenschlusses zielen, der die funktionale Differenzierung der Teile (der musikalischen Ereignisse) vorauszusetzen scheint. Andererseits findet eine solche Differenziertheit kein unmittelbares Korrelat in der Satztechnik. Die Folge der Kadenzen zeigt sich satztechnisch als parataktische Reihung, obwohl sie dies ästhetisch nicht ist.
Zudem scheint der beschriebene Eindruck der gewohnten musiktheoretischen Betrachtungsweise zu widersprechen, nach der Kadenzen Gliederungspunkte oder Grenzen darstellen (nicht erst seit Koch werden ›Endigungsformeln‹ mit Satzzeichen verglichen), die Formabschnitte voneinander trennen.[2] Gereihte Kadenzen aber gliedern die Musik nicht in Abschnitte[3], sondern sind selbst Ereignisse von bestimmter Dauer, die sich zu einem Abschnitt zusammenschließen. Andernfalls hätte man es mit dem Paradox einer Folge von Gliederungspunkten zu tun, ohne dass es Etwas gäbe, was durch sie gegliedert würde.
Das musiktheoretische Problem wird außerdem deutlich, wenn man die Schwierigkeiten besichtigt, in die ein – ansonsten sehr flexibler und tragfähiger – analytischer Ansatz wie der von Heinrich Schenker gerät. Bei Schenker gründen sowohl die Dynamik als auch die Einheit eines Formabschnitts oder einer Komposition auf einer hinter- oder mittelgründigen Struktur, beispielsweise einem Terzzug. Das entscheidende Moment ist dabei der von Schenker postulierte Durchgangscharakter der ^2: Er garantiert sowohl die Dynamik (»Zwang […] fortzuschreiten«) als auch die Einheit des Zuges (und damit eines Formabschnitts oder der Komposition im Ganzen):
Also ist der Durchgang der Urlinie der erste Durchgang überhaupt, und gerade der ihm vom strengen Satz her anhaftende Zwang, in derselben Richtung fortzuschreiten, in der er begonnen hat, bedeutet Zusammenhang, macht ihn zum Anfang allen Zusammenhanges in einer musikalischen Komposition. Der Durchgang bringt zwangsläufig die Einheit und Unteilbarkeit des Urlinie-Zuges mit sich.[4]
Daher erscheint das Ende einer Linie, die ^1, nicht nur als Punkt der Vollendung, sondern auch als Ort der »Erfüllung«.[5]
Werden lineare Strukturen wiederholt, dann kann Schenker sie bequem als Teile einer einzigen übergeordneten Struktur begreifen, wenn sie satztechnische Differenzen aufweisen. Offensichtlich ist dies im Fall von ›Unterbrechungen‹ wegen des Unterschieds zwischen Halb- und Ganzschluss (s. dazu Kap. Cb). Auch wenn sich – beispielsweise im ersten Satz der Klaviersonate op. 10/2 von Ludwig van Beethoven – zwei gewichtige Kadenzen am Expositionsende finden (T. 41 und 55), so kann Schenker problemlos einen durchgehenden Quintzug annehmen, wenn sich wie hier die erreichten Tonikaklänge von ihrer Lage her unterscheiden (die erste Kadenz endet auf der ^3, die zweite auf der ^1).[6]
In ähnlicher Weise demonstriert Lauri Suurpää die Einheit der Exposition von Mozarts Prager Sinfonie (1. Satz), indem er die fünf Kadenzereignisse am Expositionsende anhand bestimmter Differenzen hierarchisch unterscheidet und unter eine einzige Struktur fasst. Interessant ist, dass Suurpää diese Differenzen primär an den metrischen Eigenschaften der Schluss-Takte festmacht. Von den Eigenschaften wird auf die strukturellen Verhältnisse geschlossen: Da Takte metrisch schwer sind, wenn sie einen Anfang darstellen, werden alle Kadenzen als untergeordnet interpretiert, deren Schluss-Tonika in einen leichten (letzten) Takt fällt (darin eingeschlossen sind Fälle, in denen dieser Takt ›eigentlich‹ ein letzter ist, jedoch durch Taktverschränkung zugleich als Anfang fungiert – in der Art: 8=1). Umgekehrt beobachtet Suurpää an der ›hintergründigen‹ Kadenz in Takt 129, dass ihre Schluss-Tonika auf einen genuin ersten Takt fällt.[7] (Auf eine an der Metrik ausgerichtete Differenzierung der Kadenzen wird zurückzukommen sein.)
Was aber geschieht, wenn derart signifikante Differenzen (hinsichtlich Lage und metrischer Position des Schlussakkordes) ausfallen, wenn also wie hier jede Kadenz auf einer schweren Takt-Eins und beinahe jede mit dem Grundton (der ^1) zu enden scheint? Da die Subsumption aller Kadenzen unter eine Struktur ausscheidet[8], könnte man den Primat der ersten Kadenz zur interpretativen Richtlinie nehmen. Nach Koch etwa ist die Wiederholung einer Kadenz ein »Hülfsmittel zur Verlängerung«, der Abschnitt nach der ersten Schlussformel sei als »Anhang« zu betrachten.[9] Auch wenn man Schenker’schen Interpretationsgepflogenheiten folgt, gilt im Falle einer Wiederholung von Strukturen (beispielsweise Terzzügen) nur eine einzige als strukturell relevant, während die übrigen als redundant betrachtet werden, weil sie den Inhalt nicht vermehren. Die Vorstellung jedoch, dass Mozart auf die erste Kadenz nur redundante »Anhänge« folgen lässt, scheint angesichts der Länge dieser vorgeblichen Anhänge und des beschriebenen Gesamteindrucks absurd.
Folgt man dem ästhetischen Eindruck, dann scheint man nicht umhin zu können, einen ›hierarchischen‹, in funktionaler Differenzierung gegründeten Zusammenschluss der Kadenzen zu behaupten, ohne dass auf den ersten Blick ersichtlich würde, wie der Tonsatz diesen Eindruck von Geschlossenheit fundiert. Doch wenn die Aspekte Dynamik und Einheit nicht als Phantasmagorien gelten sollen, muss es Momente im Tonsatz geben, die das ›Hineinhören‹ dieser Aspekte ›in‹ die Ereignisse gelingen lassen. Das Ziel der folgenden Analyse besteht also darin, die spezielle Art und Weise herauszuarbeiten, wie Komponisten des späten 18. Jahrhunderts in Formabschnitten wie dem gezeigten den Eindruck von Dynamik und Einheit durch den Tonsatz stützen und fundieren.[10]
Der Eindruck von Dynamik wird zwar durch Eigenschaften der Schlussformeln bedingt, aber diese Eigenschaften sind nicht unmittelbar von der Partitur ablesbar, weil sie erst im ›Kontext‹ entstehen, d.h. es geht um Klang-Eigenschaften, die den Ereignissen nur zukommen, sofern man sie als Teile eines Ablaufs hört. Das musiktheoretische Problem wird sein, diese ›dynamische Konstitution‹ nachzuvollziehen.
Davon ableiten lässt sich die besondere Einheit des Formabschnitts. Sie wird deutlich, wenn man nach der Stelle fragt, an der die Schlusstonika eintritt.[11] Hierfür finden sich zwar prominente Kandidaten, insbesondere die erste Kadenz (T. 542–544) und die letzte vor dem Orchesternachspiel (T. 568–572), aber keiner überzeugt: Die Tonika am Ende der ersten Kadenz stellt zwar das Vorbild für alle folgenden dar, besitzt aber nicht die Kraft, den Formabschnitt zu beschließen – der ›eigentliche‹ Schluss muss demnach noch kommen. Wenn jedoch die Tonika der vierten Kadenz zu Beginn des Nachspiels erklingt, dann ist diese Kraft des endgültigen Abschlusses zwar gegeben[12], aber nicht mehr neu. Es scheint, als sei zuletzt eine Tonikawirkung bekräftigt worden, die als solche bereits seit einiger Zeit ›im Raum gestanden‹ hat – der ›eigentliche‹ Schluss muss demnach bereits stattgefunden haben. Mit anderen Worten: Keine einzige Kadenz ›vollzieht‹ den Schluss. Vielmehr ›wächst‹ oder ›reift‹ die Schlusstonika in Mozarts Musik heran, und die Wiederholung von Kadenzen scheint notwendig zu sein, damit dieser Effekt entstehen kann.
B. Satztechnische Eigenschaften
Der Schlusschor aus dem ersten Akt der Zauberflöte gliedert sich in drei Unterabschnitte:
Derjenige Unterabschnitt, der die Formfunktion des gesamten Schlusschores begründet, weil er den (wie immer gearteten) ›Vollzug des Schlusses‹ enthält, ist der mittlere (T. 542–572), der ausschließlich aus den erwähnten Kadenzen besteht.
Diesen Kadenzen geht voraus ein Abschnitt der ›Vorbereitung‹ auf das Kadenzieren (T. 518–541).
Dem mittleren Unterabschnitt folgt das Orchesternachspiel, ein Epilog, der satztechnisch zunächst die Reihe der Kadenzen fortsetzt (T. 572–Ende).
Diagramm 1: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, Hintergrund
Den strukturellen Hintergrund des gesamten Formabschnitts könnte man – zumindest auf den ersten Blick (s. Kap. C2a) – wie in Diagramm 1 angeben.
Der ›Vorbereitung‹ entsprechen sämtliche Ereignisse, die auf den Terzzug führen: Übergeordnet erscheint ein Anstieg ^1-^2-^3-^4, der auf den Beginn des Terzzugs leitet. Intern wird dieser Anstieg portionsweise auskomponiert: Der Weg ^1-^2 gliedert sich in eine Brechung ^1-^3-^5 und einem Übergreifzug ^5-^4-^3-^2. Der Weg ^2-^3 wiederum wird durch einen übergreifenden 4. Ton auskomponiert.
Der ›Terzzug‹ ^3-^2-^1 stellt die zentrale Struktur des mittleren Abschnitts und des Epilogs dar. Weil er (vielleicht mit einer Ausnahme) allen Kadenzen zugrunde liegt, wird er hier nur einmal als abstrakter Strukturtyp ›Terzzug‹ notiert, dem gegenüber die Kadenzen als ›Vorkommnisse‹ erscheinen. Mit dieser ›Schenker’schen‹ Vereinfachung (die Wiederholungen erscheinen hier redundant) wird dem geschilderten Problem der Analyse nicht aus dem Weg gegangen, im Gegenteil ermöglicht die momentane interpretative Zurückhaltung, das Problem später mit einem anderen, tragfähigeren Ansatz anzugehen.
1. Vorbereitung
Beispiel 1: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 518–522[13]
Die Brechung ^1-^3-^5 zu Beginn des Diagramms bezieht sich auf den unmittelbaren Beginn des Schlusschors, auf die beiden ersten zweitaktigen Phrasen sowie den Beginn des Liegetons in Takt 5. Die Töne sind jeweils als Spitzentöne zu erkennen.
Beispiel 2: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 522–530
Einen Großteil der Vorbereitung stellt der Übergreifzug ^5-^4-^3-^2 dar, der über sechs Takte hinweg auskomponiert und mit einem kurzen halbschlussartigen Pendel abgeschlossen wird. Auskomponiert wird die lineare Struktur durch eine Wiederholung, bei der mehrere Stimmen (vor allem Sopran und Tenor) kanonartig ineinander greifen. Durch den Kanon wirkt die Wiederholung stehend und in sich kreisend.
Beispiel 3: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 522–527, Schema der Kanonbildung
Beispiel 3a zeigt eine Linie g2-f2-e2-d2-c2-h1, die sich zweifach – jeweils um zwei Dauerneinheiten versetzt – selbst begleiten kann (Beispiel 3b). Tatsächlich gewinnt Mozart die Stimme des Soprans durch Synthese des ersten Einsatzes mit dem (verkürzten) dritten (Beispiel 3c). Das erlaubt, die Tonfolge als die strukturelle Bewegung ^5-^4-^3-^2 zu begreifen. Da Sopran- und Tenorstimme wegen des Textes über dieselbe Anzahl von Tönen verfügen müssen, erfordert der gleichzeitige Beginn der Sopran- und Tenorversion unterschiedliche rhythmische Einrichtungen des Kopftons (Beispiel 3d).
Beispiel 4: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 530–542
Zwölf Takte setzen den Anstieg vom 2. Ton an fort (^2-^3-^4) und verbinden das Ende des Übergreifzugs (T. 530) mit dem Eintritt des Terzzugs auf dem 3. Ton (T. 542).
Die beiden Teilstücke ^2-^3 (d2-e2) und ^3-^4 (e2-f2) lassen sich von den Spitzentönen der Oberstimme ablesen. Dabei wird deutlich, dass die hintergründige Bewegung ^2-^3 im Mittelgrund durch einen ›Übergreifton‹ verlängert wird: ^2-(^4)-^3 (d2-f2-e2).[14]
Die beiden Teilstücke werden in zwei analogen Taktgruppen dargestellt, die mit analogen Harmoniefolgen einhergehen: G-G7-C und C-C7-F. Der 4. Ton am Ende des Anstiegs erscheint dadurch zunächst als Grundton von F-Dur, hernach als Septime von G-Dur (man wird sehen, dass dieser Wechsel für die Dynamik der Taktgruppen von Bedeutung ist).
Diagramm 2 zeigt eine ausführlichere Zusammenfassung der melodisch-harmonischen Verhältnisse (vom Rest des Anstiegs an).[15]
Diagramm 2: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, Takt 530–544, melodisch-harmonische Verhältnisse
2. Die Kadenzen (Mittelteil und Epilog)
Von den fünf Kadenzen (einschließlich deren Wiederholungen), die der Vorbereitung folgen, bilden mindestens vier die ›Vorkommnisse‹ des Strukturtyps ›Terzzug‹.
a. Kadenz 1
Beispiel 5: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 542–544
Die erste Kadenz, obwohl von ihrer Ausdehnung her nur kurz, wird wegen ihrer Position als Ereignis mit großem Einfluss auf die folgenden Kadenzen wahrgenommen (s.u.). Überdies besitzt sie mehrere ›Alleinstellungsmerkmale‹: Sie ist sie die einzige, bei der die Violinen die auffälligen synkopischen Begleitakkorde spielen und die den Terzzug unverschnörkelt, ohne Integration weiterer Töne darstellt. Im Gegensatz zur melodischen Einfachheit erscheint die Harmonik relativ reichhaltig (man vergleiche diese mit derjenigen der fünften Kadenz).
b. Kadenz 2
Beispiel 6: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 544–556
Anders als die erste verbindet die zweite Kadenz den Terzzug mit dem 5. Ton, der als vormaliger Liegeton im Gedächtnis verblieben ist. Der 5. Ton steht einerseits am Anfang (analog zur Herbeiführung des Tons f wird auch er durch einen Wechsel D-T erreicht), andererseits wird er in den folgenden Terzzug als vorletzter Ton implementiert, wodurch am Ende der Kadenz ein Quintfall entsteht. Dabei werden die beiden melodischen Wendungen auf eine Weise synthetisiert, die es dem Hörer schwer macht, einer von ihnen den Vorrang einzuräumen. Die Kadenz ist tatsächlich beides: lineare Tenorklausel und Quintfall (›Bassklausel‹).
c. Kadenz 3
Beispiel 7: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 556–568
Die dritte Kadenz ähnelt der zweiten, insofern auch sie den Quintfall g-c mit dem Terzzug verbindet. Von der zweiten Kadenz unterscheidet sich die dritte im Wesentlichen durch drei Momente:
durch die geringere Ausführlichkeit, mit der zu Beginn der 5. Ton exponiert wird: Der Ton g wird lediglich als synkopierter Ton hervorgehoben. Mit dieser (gegenüber Kadenz 2 zu beobachtenden) Veränderung zu Beginn gehen in der Folge weitere melodische und rhythmische Veränderungen einher.
durch die Unterscheidung der Schlusstöne: Anders als die zweite Kadenz mündet die dritte zunächst auf dem 3. Ton und erst in der Wiederholung auf dem 1. Ton.
durch die Abspaltung: Mozart hängt an die Wiederholung zwei auf die Hälfte verkürzte Kadenzen. Die Tatsache, dass beide Kurzformen auf dem 3. Ton enden, lässt deutlich werden, dass sie mit der vierten Kadenz eine (im traditionellen Sinne) syntaktische Untereinheit von acht Takten bilden (einen ›Satz‹ nach Ratz).
d. Kadenz 4
Beispiel 8: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 568–572
Die vierte Kadenz ist von allen anderen als Unisonobewegung in ganzen Noten unterschieden. Inhalt des Unisonos ist primär die Quintenreihe e-a-d-g-c. Die Kadenz stellt somit weniger einen Terzzug als vielmehr einen ›potenzierten Quintfall‹ dar (allerdings ergibt sich indirekt, wenn auch deswegen nicht weniger bedeutsam, ein Terzzug zwischen den tieferen Töne). Durch die Tonfolge d-g-c am Ende lässt sich die vierte Kadenz als rhythmische Augmentation der Abspaltungen zuvor verstehen.
e. Kadenz 5
Beispiel 9: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 572–586
Die fünfte Kadenz ist diejenige des Orchesternachspiels. Wie die erste ist ihre melodische Formel ausschließlich der Terzzug. Prägend für sie sind die harmonische Reduktion auf die Stufen I und V sowie der anfängliche melodische Wechsel zwischen e und dis, der an die – mit Akkordwechseln verbundenen – Bewegungen e-f in der Vorbereitung und fis-g in der zweiten Kadenz erinnert (die beteiligten Klänge stehen hier an der Grenze zwischen Akkord und Stimmführungsresultat). Überdies sorgt die Wechselnotenbewegung für eine Dehnung der Kadenz auf fünf Takte. Als reiner Terzzug bildet die fünfte Kadenz das Gegenstück zur vierten, die primär aus Quintfällen bestand.
Zusammenfassend seien die Differenzen zwischen den Kadenzen in einer Tabelle festgehalten, die überdies angibt, welche von ihnen unmittelbar wiederholt werden.
Kadenz | Terzzug | Quintfall | Wiederholung |
1 | X |
|
|
2 | X | X | X |
3 | X | X | X + Abspaltung |
4 |
| X |
|
5 | X |
| X |
C. Kontextbedingte Eigenschaften
1. Dynamik
Die beschriebenen Differenzen zwischen den Kadenzen machen partiell verständlich, warum man innerhalb des Formabschnitts einen dynamischen Zug beobachten kann: Die Folge der Ereignisse lässt sich nämlich als stufenweiser Übergang des Terzzuges in den Quintfall lesen, wobei der einfache, aber starke Quintfall wie ein zusammenfassender Aphorismus nach einem stetigen Prozess der Reduktion und Verkürzung erscheint.
Die erste Kadenz, die den ›Vollzug des Schlusses‹ eröffnet, und die vierte, die ihn beschließt, erscheinen als einzige Schlussformeln ohne unmittelbare Wiederholung, und ihre Figurationen repräsentieren die basalen Schlussformeln: den einfachen Terzzug und den Quintfall. Dem gegenüber sind die Kadenzen 2 und 3 wegen der Vermischung der Schlussformeln als mittlere oder vermittelnde Stationen ausgewiesen.
Eine ähnliche Besonderheit von Anfang und Ende lässt sich hinsichtlich des Tonvorrats beobachten. Die Oberstimme verwendet im gesamten Schlussabschnitt im Wesentlichen die Töne des ›Hexatons‹ f-c-g-d-a-e. Dabei erscheint der quinttiefste Ton f allein in der ›Vorbereitung‹ – dort einmal an prominenter Stelle vor Eintritt der ersten Kadenz –, während der Ton a nur an einer einzigen Stelle, nämlich innerhalb der vierten Unisono-Kadenz erklingt (die übrigen Töne c-g-d + e bilden den neutralen Bestand fast aller Kadenzen).
Bis Takt 572 ist über alle Kadenz-Ereignisse (samt ihren vorbereitenden Takten) hinweg eine Tendenz zur Reduktion zu beobachten: Gehen der ersten Schlussformel (T. 542–544) noch die Wechselnotenbewegung (T. 538f.) und der auffallende Zweitakter (T. 540f.) voraus, über den noch zu sprechen sein wird (s. ›Einschnürung‹), so fällt bereits vor der zweiten Kadenz der charakteristische Zweitakter zwischen Wechselnotenbewegung und Schlussformel aus. Die dritte Kadenz lässt von der Wechselnotenbewegung nur das pointierte Erreichen des 5. Tons übrig, und die abgespaltenen Kadenzen sowie die vierte Kadenz bestehen schließlich aus nichts anderem als der Schlussformel selbst.[16]
Der Reduktion der Ereignisse entspricht weitgehend eine sich verdichtende Folge der Schlusstöne. Wenn wir zunächst von der Gliederung in metrische Einheiten absehen (s. Kap. C1b) und neutral nach dem Abstand der Schlussakkorde fragen, dann lässt sich eine Folge von 27+6+6+4+4+2+2+4 erkennen. Dabei ist der letzte Viertakter, der die Tendenz zur Verkürzung umzukehren scheint, nur rechnerisch doppelt so lang wie die beiden vorangehenden Taktgruppen. Syntaktisch stellt er eine Augmentation der Abspaltung zuvor dar, also einen gestreckten Zweitakter.[17]
Die detaillierte Beschreibung der Ereignisse und ihrer Unterschiede kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass das zuvor exponierte Problem einer ›dynamischen Konstitution‹ noch nicht gelöst ist, das zentrale Moment, dass eine Fundierung der Dynamik durch den Tonsatz allererst verständlich macht, fand noch keine Erwähnung. Der Eindruck von Dynamik beruht nämlich wesentlich darauf, dass frühere Ereignisse durch ihr Erscheinen einen jeweils bestimmten (und bestimmbaren) Einfluss auf das Verständnis der späteren Ereignisse ausüben. Es genügt also nicht, die Unterschiede zwischen den Ereignissen und die proportionalen Verhältnisse ihrer Dauern zu beschreiben, sondern es gilt aufzuzeigen, in welcher Weise sich welche Eigenschaften einer Kadenz auf das Verständnis einer nächsten Kadenz auswirken. Hier wird nun, wie bereits bei Suurpää angesprochen, die Metrik ins Spiel kommen.
a. ›Einschnürung‹
Bei der Suche nach einem frühen zentralen Ereignis, das den ›Grundstein legt‹ für die Auffassung aller folgenden Takte, fällt der Blick auf die letzten beiden Takte der Vorbereitung, in denen der Liegeton f nacheinander mit den Stufen IV und V harmonisiert wird (T. 540/541).[18] Eine solche satztechnische Konstellation (aus 4. Ton und Harmoniewechsel IV-V bzw. II-V) nenne ich ›Einschnürung‹, wenn sie wie hier mit einer bestimmten syntaktischen Funktion einhergeht: Eine ›Einschnürung‹ markiert das Nahen einer neuen Taktgruppe, sie ist eine Stelle, der kurze Zeit später der Anfang einer neuen Taktgruppe (und damit ein erster schwerer Takt) folgt.[19] Da die Markierung durch einen Bewegungswechsel (im ersten oder zweiten Takt) geschieht, kommt es bei der Bestimmung eines Ereignisses als ›Einschnürung‹ – neben den beschriebenen satztechnischen Voraussetzungen – auf die rhythmischen Eigenschaften an. Dabei ist sogleich anzumerken, dass es sich bei diesen rhythmischen Eigenschaften um ›Kontext-Eigenschaften‹ handelt, nicht also um dasjenige am Rhythmus, das sich bereits von den Noten ablesen lässt, sondern um Eigenschaften, die Dauernfolgen erfahren, wenn sie im Verlauf einer Komposition gehört werden.
Die ›Einschnürung‹ ist hier als letzte (untergeordnete) Taktgruppe der ›Vorbereitung‹ hervorgehoben. Die Hervorhebung geschieht dadurch, dass dem F-Dur-Akkord zu Beginn eine auffallende zweitaktige Wechselnotenbewegung in Vierteln (harmonisch D-T) vorausgeht. In Relation zur raschen Viertelbewegung stellt die Einschnürung eine ganztaktige Bewegung dar. Entscheidend ist dabei nicht, dass sie ganztaktig ist, sondern dass sich ihre Ganztaktigkeit vom Vorherigen abhebt und dass so innerhalb des Kontextes auf sie verwiesen wird.
Auch die beiden Takte der ›Einschnürung‹ verweisen hinsichtlich ihrer Bedeutung aufeinander: Mozarts (Detail-)Entscheidung, die Töne des F-Dur-Akkords (in den Chor- und den meisten Orchesterstimmen) nur einen halben Takt andauern zu lassen (und dadurch eine Zäsur zum folgenden Takt zu erzeugen), hat ihren Grund in der so generierten Wirkung des folgenden Taktes. Der ausgehaltene G-Dur-Septakkord, auf den es ankommt, erscheint – bedingt durch seinen Gegensatz zum ›zäsurierten‹ Takt vorher – kontinuierlich und gerichtet.[20]
Die Violinen beschreiben in der ›Einschnürung‹ (erstmals in diesem Formabschnitt) eine lineare Achtelbewegung, die nichts weniger leistet, als die beschriebenen Eigenschaften der Takte in Töne zu fassen. Das Fließende des G-Dur-Taktes findet seinen Ausdruck in der glatten aufsteigenden Linie, der Zäsur im F-Dur-Takt aber entspricht der synkopische Akzent auf der Zwei des Taktes (ein letzter Reflex der Figurationen zuvor). Entscheidend ist auch hier, dass die Achtelbewegungen der ›Einschnürung‹ im Vergleich zu den melodisch engen Umspielungsachteln zuvor raumgreifend erscheinen.
* * *
Die ›Einschnürung‹ ist ein geschichtsmächtiger Topos gewesen, aus dessen Vielzahl von möglichen Erscheinungsformen einige wenige Beispiele herausgegriffen seien.
Beispiel 10: Arcangelo Corelli, Sonata F-Dur op. 1/1, 1. Satz, T. 3–6
In Arcangelo Corellis erster Triosonate bildet die Einschnürung diejenige Stelle, an der die Sequenz in die Kadenz übergeht (markiert durch den synkopierten Ton f). Anders als bei Mozart ist die ›Einschnürung‹ bei Corelli keine eigenständige Zweitaktgruppe. Mit dem Eintritt der V. Stufe beginnt bereits eine neue Bewegung (und nicht etwa am Ende der Kadenz im nächsten Takt). Diese Art der ›Einschnürung‹ scheint für die drei Jahrzehnte vor und nach 1700 typisch gewesen zu sein und findet sich auch bei J.S. Bach.
Beispiel 11: J.S. Bach, Präludium C-Dur BWV 939, T. 4–9
In J.S. Bachs Präludium BWV 939 führt der zentrale Modulationsweg (von der Tonika C-Dur in Takt 4 zur Dominante G-Dur in Takt 9) über die Gerüsttöne e2-d2-c2-h1 in der Oberstimme. Mit Erreichen der Dominante in Takt 9 beginnt ein Orgelpunkt. Zuvor erscheinen zwei Takte mit den Harmonien a-Moll und D-Dur (als Dominantseptakkord), die als ›Einschnürung‹ ausgestaltet sind: Erstens ist der hier erklingende Gerüstton c der einzige, der – ähnlich wie bei Corelli – synkopisch eingebettet ist und den Harmoniewechsel II-V (in G-Dur) überbrückt. Zweitens beginnt hier und nicht erst mit dem Eintritt von G-Dur eine Achtelbewegung in der rechten Hand, die über dem Orgelpunkt fortgesetzt wird.[21]
Beispiel 12: W.A. Mozart, Klavierkonzert A-Dur KV 488, 2. Satz, T. 1–4
Auf kleinstem Raum – innerhalb eines Periodenvordersatzes – dynamisiert die ›Einschnürung‹ im langsamen Satz des Klavierkonzertes KV 488 (dort in Takt 2) den Gang auf den Halbschluss in Takt 4. Strukturelle Grundlage der Takte 1–4 bilden die Gerüsttöne cis-h-a-gis-fis-eis.[22] Die ›Einschnürung‹ findet beim Ton h statt, der – zwar nicht tatsächlich, aber strukturell – während des gesamten zweiten Taktes liegenbleibt. Anlass zur Interpretation der Konstellation als ›Einschnürung‹ bietet die Inszenierung:
Erstens ist der Ton h der einzige Strukturton, der substanziell wiederholt wird (die Wiederholung der anderen Töne geschieht – wenn überhaupt – innerhalb von Ornamenten).
Zweitens ist der Ton h beim zweiten Erscheinen synkopiert (die Synkopierung stellt hier – wie auch bei Corelli und Bach – ein Mittel der Markierung dar).
Drittens erklingt allein zum Ton h ein tiefer Basston.
Viertens beschleunigen sich in Takt 3 der harmonische Rhythmus und die Folge der Gerüsttöne (die ›Einschnürung‹ wird wesentlich durch die Ereignisse definiert, die ihr folgen: Nur der Beginn einer veränderten Bewegung gibt der Konstellation zuvor ihre Bestimmung als Markierung eines nahenden Anfangs).
Beispiel 13: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate As-Dur op. 110, 2. Satz, Trio, T. 72–76
Manchmal wirkt die ›Einschnürung‹ auch auf übergeordneter Ebene formbildend. Im klanglich befremdlichen Trio des Scherzos aus Beethovens Klaviersonate op. 110 steht die ›Einschnürung‹ am Punkt der Peripetie (T. 73–75). Sie selbst ist ein dreitaktiges Ereignis inmitten von Achttaktgruppen.[23] Obwohl in sich verwirrend komplex angelegt, stehen alle Achttaktgruppen für je einen Akkord oder einen Akkordwechsel:
Des | DesGes | Ges | Geses | [Einschnürung:] esAs7Des | Des | Des
Der harmonische Verlauf führt von der Tonika Des-Dur über die Subdominante Ges-Dur zu deren Parallelakkord es-Moll, mit dem zugleich der 4. Ton melodisch erreicht wird. Es beginnt die Einschnürung, die auffällt, weil die bisherige Textur der Achtelläufe zugunsten eines rhythmisch aufreizenden Akkordsatzes verlassen wird. Nach der Einschnürung ›verliert‹ sich das Trio in scheinbar ziellosen Umspielungen des Des-Dur-Akkordes.
Bemerkenswert ist, dass der merkwürdige Charakter des Schlusses auch eine Funktion der Einschnürung darstellt: Das Trio wird weder durch eine Kadenz noch durch einen kräftigen Akkordwechsel beschlossen. Der Übergang von der harmonischen Entwicklungsphase (Des | Ges | es) in die Schlussphase wird von der ›Einschnürung‹ geleistet. Sie allein trennt das finale Des-Dur von dem Geschehen zuvor und generiert, indem sie Neues herbeiführt, ohne Früheres nach Art einer Kadenz abzuschließen, jene ambige Wirkung des Des-Dur-Akkordes: Er überzeugt weder als Schluss-Tonika noch als Beginn eines neuen Abschnitts (beispielsweise eines ›A’-Teils‹). Folgerichtig verläuft das Trio im Sande – und eben dies ist die syntaktische Pointe des Abschnitts.
b. Eine Grundfrage der Metrik: Ordnung der Taktgruppen – ›schwere Takte‹
Über die Art und Weise, wie Takte zu gruppieren sind (und – damit einhergehend – welche Takte metrisch schwer sind), gibt es bekanntlich differierende Vorstellungen.[24] Wahrscheinlich hängt die Tatsache, dass unterschiedliche Theorien der Metrik angesichts identischer satztechnischer Sachverhalte zu diametral entgegen gesetzten Interpretationen gelangen, damit zusammen, dass der Gegenstand der Metrik an der Grenze zwischen Werkstruktur und Interpretation angesiedelt ist: Metrische Schwerpunkte müssen zwar auch durch Momente des Tonsatzes fundiert werden, aber ihr wesentlicher ›Existenzgrund‹ liegt darin, dass sie von einer bestimmten Interpretation des musikalischen Zusammenhangs ›verlangt‹ werden. Da eine jede Interpretation immer auch dadurch realisiert wird, dass sie eine bestimmte Disposition metrischer Schwerpunkte ›setzt‹, haben metrische Entscheidungen einen präskriptiven Charakter.[25] Mit anderen Worten: Bei Fragen nach Gruppierung und Metrik geht es nicht darum, welche Takte schwer sind, sondern darum, welche Takte schwer gespielt werden sollten, damit eine bestimmte Auffassung des musikalischen Zusammenhangs deutlich werden kann.[26]
Wir werden uns, um die Bedingungen von Dynamik und Einheit im Schlusschor aufzeigen zu können, der verbreiteten (formalen) Auffassung anschließen, nach der solche Takte als metrisch schwer aufgefasst und gespielt werden sollten, die einen ›Anfang‹ darstellen. Dabei ist ›Anfang‹ als Bestimmung eines musikalischen Ereignisses hinsichtlich seiner Funktion im ›Kontext‹ zu verstehen:[27]
Es wäre verfehlt, ›metrische Schwerpunkte‹ mit Betonungen gleichzusetzen. Ein metrischer Schwerpunkt konstituiert sich nicht durch den Nachdruck, den ein Spieler einem Ton oder Klang angedeihen lässt, sondern systemisch, er ist ein Epiphänomen des musikalischen Zusammenhangs (was nicht ausschließt, dass er darüber hinaus durch Betonungen affirmiert werden kann).[28]
Dass ein metrischer ›Anfang‹ schwer ist, bedeutet, dass er »in dem Gehör […] zu verweilen«[29] scheint, was sich als Umschreibung für die Tatsache verstehen lässt, dass er weiterwirkt, d.h. das Ereignis, das auf einen metrischen Schwerpunkt fällt, bildet den Bezugspunkt, von dem her die folgenden Ereignisse auf eine bestimmte (gewünschte) Weise verständlich werden (welche das sind, zeigt die Analyse im Einzelfall). Die Schwere des ›Anfangs‹ ist die sinnliche Außenseite einer syntaktischen Funktion.
Es wäre ein Missverständnis, die ›Anfänge‹, als die metrische Schwerpunkte fungieren, mit syntaktischen Anfängen (im Sinne der Formenlehre) gleich zu setzen. Ein ›Anfang‹ (im Sinne einer metrischen Kategorie) kann womöglich inmitten eines melodisch ungegliederten Ablaufs vorkommen. Gerade deswegen ist die Metrik für die Lebendigkeit eines musikalischen Ablaufs bedeutsam, weil sie einen ›Kontrapunkt‹ zur Syntax (im geläufigen Sinne) bilden kann.[30]
Aus den Bestimmungen folgt, dass eine Entscheidung über die Lokalisierung eines metrischen Schwerpunkts von dem erkennbaren Einfluss her gelenkt wird, den sie auf die Eigenschaften der folgenden Ereignisse ausübt. Zwei Beispiele:
Zu Beginn des Schlusschors fallen metrischer und syntaktischer Anfang zusammen. Die metrischen Schwerpunkte werden in Takt 518 und 520 durch isolierte Akkorde verkörpert, sie eröffnen einen zeitlichen Bereich, innerhalb dessen sie in der Art eines Basstons fortwirken (und den sie durch ihr Fortwirken definieren). Die Chor-Phrasen, die in ihrem Schatten stehen, wirken eingebettet[31], d.h. wie auf einen ›Basston‹ aufgesetzt, dessen Einsatz (und Wiedereinsatz) den Ablauf gliedert. Der Charakter der Phrasen ist durch diese Einbettung weniger massiv, als er es wäre, wenn sie – um einen Takt vorgezogen – auftaktig begännen und mit den Akkorden zusammenfielen. Die relative Leichtigkeit der Phrasen verleiht ihnen wiederum einen ›Zug‹ nach vorne.[32]
Takt 572 ist durch den Kontext ein ganz schwerer Takt (s. die folgende Analyse) und damit der metrische Anfang für den Epilog. Unabhängig davon, ob man den Beginn der Epilogfiguren mit dem Schlusston und den Läufen, die aus ihm hervorgehen, oder erst mit dem Ton e3 im folgenden Takt ansetzt, nehmen die epilogischen Takte ihren strukturellen Ausgangspunkt vom Schlusston. Sinnvoll ist diese Interpretation, weil durch sie der Akkord in Takt 573 einen synkopischen Charakter erhält. Dass er betont erscheint, aber in einem zweiten leichten Takt steht, begegnet der Gefahr von Plumpheit, wie sie mit einem Spiel gegeben wäre, das den Takt als metrischen Anfang darstellte.
c. ›Metrische Pfade‹
Eine zentrale Funktion der ›Einschnürung‹ besteht darin, den Eintritt in die Kette der Kadenzen metrisch zu lenken, d.h. den Hörer auf einen bestimmten Pfad von metrischen ›Anfängen‹ zu setzen (was die Behauptung einschließt, dass die Disposition der schweren Takte eine andere sein könnte, wenn der Abschnitt der ›Vorbereitung‹ anders komponiert worden wäre). Wie dieser ›metrische Pfad‹ genau aussieht, wird im Anschluss an Beispiel 14 beschrieben. Das Beispiel selbst gibt lediglich die vorgeschlagene Zählung der Takte wieder. Wer einen ersten Anhaltspunkt für die hiesigen Entscheidungen sucht, sei auf die Spielfiguren (vor allem der ersten Violine) von Takt 542 an verwiesen: An den Anfängen einiger Taktgruppen (wo die Zählung mit einer 1 beginnt) findet sich ein Doppeltakt, der mit einer singulären Spielfigur ausgestaltet ist.[33]
Beispiel 14: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, Takt 518–586, metrische Analyse
1. Kadenz: ›Vorbild‹
Entscheidend scheint mir, dass die Einschnürung uns den Beginn des ersten Terzzugs als Beginn einer neuen Taktgruppe erleben lässt. Die Taktgruppe beginnt mit einem metrisch schweren Doppeltakt auf dem 3. Ton, der durch synkopische Spielfiguren in den Violinen aus der Umgebung herausgehoben ist (der 1. Ton am Ende der Kadenz fällt auf den Beginn eines leichten Doppeltaktes).[34]
2. Kadenz: ›Imitation‹
Die metrische Interpretation des ersten Terzzugs sorgt wiederum dafür, dass man auch kurz vor dem Ende der zweiten Kadenz (in beiden ›Vorkommnissen‹) einen schweren ›ersten‹ Doppeltakt ausmacht.[35] Die Takte 548 und 554 treten als Anfänge einer neuen Taktgruppe hervor: nicht nur wegen ihrer analogen Position zum ersten Terzzug, sondern auch wegen der erwähnten Figuren in den Violinen.[36]
3. Kadenz: metrische ›Umdeutung‹
Die Situation ändert sich mit der dritten Kadenz und ihren (teils verkürzten) Wiederholungen. Dadurch, dass die ersten Taktgruppen lediglich vier statt sechs Takte umfassen und in ihrer Mitte von einem synkopischen 5. Ton ausgefüllt werden, kann sich vor dem Ende der Kadenzen ein Doppeltakt, der als Eröffnung einer neuen Taktgruppe fungiert, nicht oder nicht derart deutlich wie bisher etablieren (unterstützt wird die veränderte metrische Situation durch die Spielfiguren der Violinen, die jetzt über mehr als einen Doppeltakt hinweg einheitlich verlaufen).[37] Daher beginnen von nun an die Takte mit den Schlusstönen, als metrische Attraktionspunkte hervorzutreten.
Aus dem Verlauf heraus gehört, klärt sich die Verlagerung des metrischen Schwerpunkts auf die Schlusstöne allerdings nicht so schnell (eine Nachwirkung der ›Einschnürung‹). Die doppelte metrische Zählung der Takte 556–557 (Bsp. 14) ist als provisorische Darstellung einer nachträglichen Uminterpretation zu verstehen: Von ›vorne‹ kommend, handelt es sich um Takte mit den syntaktischen Funktionen 3 und 4. Erst im Nachhinein wird deutlich (an den Eigenschaften der Takte 559–560), dass sich der metrische Bezugspunkt (der ›erste Takt‹) verschoben haben muss, dass das momentane Geschehen seinen strukturellen Ausgang von Takt 556 nimmt, ohne dass die Bedeutung dieses Taktes sinnfällig geworden wäre, als er tatsächlich erklang.
3. Kadenz: strukturelle ›Umdeutung‹
Beispiel 15: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, T. 556–572, Struktur der Oberstimme
Bezeichnenderweise bringt Mozart von dem Augenblick an, in dem die metrischen Anfänge auf die Schlusstöne zu fallen beginnen, den 3. Ton als alternativen Schlusston ins Spiel. Nach gängiger Syntaxlehre wird ein Schluss auf dem 3. Ton als ›imperfekter Ganzschluss‹ interpretiert, der sich mit einem nachfolgenden perfekten zu einer Einheit ergänzen kann, weil dieser einlöst, was jener ›offenließ‹. Zu einer Erklärung für die funktionale Einheit beider Kadenzen wird dieser Hinweis allerdings erst dann, wenn man hinzufügt, dass der Unterschied der Schlusstöne zu einer veränderten Auffassung der Strukturen führt: Aus zwei Terzzügen (inklusive Quintfall) wird eine Bogenstruktur ^1-^2-^3-^2-^1, die im Gegensatz zu den Terzzügen zwei Kadenzen umspannt. Ebenso fügen sich – wie bereits gesagt – die beiden abgespaltenen zweitaktigen Kadenzen mit der vierten Kadenz, der Augmentation der Abspaltung, zu einer einzigen Kadenz zusammen (weshalb es hier sinnvoll ist, von einem ›Satz‹ zu sprechen).
3. Kadenz: der Schluss in Takt 564
Der Akkord in Takt 564 ist der erste, der den typischen Charakter einer finalen Tonika erkennen lässt (hier erklingt die erste Tonika in Oktavlage auf einem metrisch ersten und damit schweren Takt[38]). Damit eröffnet Takt 564 eine neue Phase des Kadenzierens, in der es darum geht, den etablierten Schluss-Charakter festzuhalten und weiter ›anzureichern‹. Der Bestimmungsprozess, der nun folgt, lässt sich am besten ermessen, wenn man die klangliche Differenz zwischen den Schlussklängen in Takt 564 und 572 in den Blick nimmt.
3. Kadenz: Abspaltung
Die Abspaltung ist offensichtlich wichtig, um die Differenz zwischen den genannten Schlussklängen zu begründen. Man erkennt dies daran, dass die Differenz deutlich geringer wäre, wenn man die Taktgruppe vor der vierten Kadenz änderte, wenn also der vierten Kadenz eine weitere (unverkürzte) Wiederholung der dritten vorausginge. Die Abspaltung hat die Funktion, den Ton e wieder zum Ausgangspunkt der finalen Taktgruppe von Takt 568 bis 571 zu machen. Es handelt sich um einen untergeordneten Anfang in einem ›fünften Takt‹ in der Mitte der Struktur ^1-^2-^3-^2-^1. Gerade die Funktionalisierung des 3. Tons als Binnenanfang ermöglicht es, die abschließende Bewegung ^3-^2-^1, die durch die Quinten gestreckt wird, als zusammenfassenden Aphorismus aufzufassen.
4. Kadenz: Bedeutung der Augmentation
An der ›Einschnürung‹ war bereits zu beobachten, dass ihr Hervortreten auch mit dem Umstand zu tun hatte, dass eine zuvor melodisch enge und rhythmisch kleingliedrige Achtelbewegung von einer melodisch ausgreifenden und rhythmisch ganztaktigen abgelöst wird. Die Verkettung der beiden verkürzten dritten Kadenzen mit der abschließenden augmentierten vierten folgt demselben Prinzip. Prägend für die vierte Kadenz ist der Umstand, dass sie die ganztaktige Bewegung, wie sie von ›Einschnürung‹ und erster Kadenz her bekannt ist, wiedergewinnt. Die ganzen Noten werden innerhalb des Kontextes daher nicht als Retardation, sondern als befreites Fortströmen verstanden.
2. Einheit
Die Einheit des Schlusschors ist eine Funktion der beschriebenen Dynamik, sie gründet auf der ›dynamischen Konstitution‹ der ›Schluss-Tonika‹. Die Einheit der ›Schluss-Tonika‹ lässt sich an dem speziellen Effekt erkennen, der die wiederholte Herbeiführung des Schlussakkordes begleitet: ›Schluss-Tonika‹ ist hier eine Bestimmung, die von Anfang an in allen Schlussakkorden anwesend und zugleich nicht-anwesend ist. Anwesend ist sie, weil jeder Schlussakkord als ›Vorkommnis‹ einer ›virtuellen‹ Schluss-Tonika erscheint, nicht-anwesend ist sie, weil kein einziger Schlussakkord als eigentliches ›Vorkommnis‹ der ›Schluss-Tonika‹ fungiert (auch nicht der letzte vor dem Epilog). Die ›eine‹ Schluss-Tonika erklingt nicht, sie gibt es nur, insofern sie eine Folge mehrerer ›Vorkommnisse‹ einigt, d.h. deren Einheit ist.[39] Fundiert wird diese Auffassung durch die beschriebenen satztechnischen Differenzierungen, die das ›Hineinhören‹ oder Verfolgen des ›metrischen Pfades‹ erlauben.
a. Doppelung der Strukturen
Die Tatsache, dass die Reihe der Schlussformeln zwei Grundformen kennt: den linearen Terzzug (Tenorklausel) und den Quintfall (eine Art Bassklausel), ist in diesem Beispiel kein Zufall, sondern eine Voraussetzung für das Gelingen der ›dynamischen Einheit‹. Die Einheit, die im Formprozess deutlich wird, geht hier aus der wechselseitigen Beleuchtung der beiden Strukturen hervor.[40] Die abschließende Kraft des letzten Quintfalls hängt ebenso vom Terzzug zuvor ab, wie die Funktion des Terzzugs, die Schlusstonika erklingen zu lassen, ohne auf ihr anzukommen, vom Quintfall her zu verstehen ist. Selbstverständlich könnten beide Schlussformeln für sich genommen – etwa in einer anderen Komposition – einen befriedigenden Schluss hervorbringen. Aber im Kontext dieses Schlusschors erscheinen beide aufeinander angewiesen und dadurch beschränkt: Der Terzzug vollendet das Schließen nicht, der Quintfall allein könnte es nicht einfädeln. Die Beschränktheit ist das Signum einer wechselseitigen Abhängigkeit.
Wenn man diesen Interpretationsvorschlag gelten lässt, dann hätte das allerdings gewichtige Konsequenzen:
Wenn die Einheit einer Komposition oder eines Formabschnitts aus dem Verhältnis zweier Strukturen hervorgeht, dann begründet keine der beteiligten Strukturen diese Einheit für sich. Folglich gehören die Strukturen nicht in einen (Schenker’schen) Hintergrund der Komposition.
Die Einheit, die aus der Wechselwirkung der beiden beteiligten Strukturen hervorgeht, lässt keine neue übergeordnete Struktur hervorgehen. Sie ›existiert‹ in nichts anderem als in eben dieser Wechselwirkung.
Eine dynamische Einheit, die auf Wechselwirkung beruht, kann durch kein Strukturdiagramm adäquat dargestellt werden.
Das folgende Diagramm hat daher nur einen suggestiven Wert. Es notiert die beiden führenden Strukturen als miteinander verschränkt und deutet dadurch den Prozess der wechselseitigen Beleuchtung zwischen Terzzug und Quintfall, wie er im Verlauf des Schlussabschnitts stattfindet, lediglich an.
Diagramm 3: W.A. Mozart, Die Zauberflöte, 1. Akt, Schlusschor, Verschränkung der beiden führenden Strukturen
b. Die ›Unterbrechung‹ bei Schenker als ›dynamische Einheit‹
Die ›dynamische Konstitution‹ von Einheit durch die wechselseitige Abhängigkeit mehrerer Strukturen oder Strukturteile, die nur im Verfolgen des Verlaufs der Ereignisse (auf einem bestimmten ›metrischen Pfad‹) stattfinden kann, könnte ein Gedanke sein, der in vagen Ansätzen bereits in Heinrich Schenkers Freiem Satz, dort in seinen Ausführungen zur ›Unterbrechung‹, zu finden ist.[41] Ein unterbrochener Terz- oder Quintzug besteht bekanntlich aus zwei Teilstücken, einem ersten unvollständigen (ohne den 1. Ton) und einem zweiten vollständigen. Die erste ^2 ist ein Teiler, der die Linie unterbricht.
Diagramm 4: Heinrich Schenker, Der freie Satz, Anh. Figurentafel, Fig. 21 b und 24
In jüngerer Zeit hat Nicolas Marston[42] gezeigt, dass Schenker hinsichtlich der Frage, welches der beiden Teilstücke die eigentliche Urliniebewegung repräsentiere, widersprechende Aussagen getroffen hat. So suggerieren die Bilder im Freien Satz (Diagramm 4), dass es der erste Weg zur ^2 sei, in dem die Urlinie selbst sich fortbewege. Hingegen legen einige Textstellen aus den Schriften Der Freie Satz und Das Meisterwerk nahe, dass die Hintergrundstruktur erst mit dem zweiten Teilstück, also nach der ›Unterbrechung‹, in Bewegung gerate. Akribisch vollzieht Marston anhand der Skizzen zum Freien Satz die Entstehung dieser Widersprüche nach (diese sehr interessante Rekonstruktion ist für unsere Ausführungen allerdings sekundär).
Aus den vorangegangenen Überlegungen heraus drängt sich ein Verdacht auf: Vielleicht resultieren die Widersprüche, die Marston herausgearbeitet hat, aus der (von Schenker verkannten) Tatsache, dass die Frage nach der Priorität eines der beiden Teilstücke gar nicht zu klären ist, weil die Einheit ›unterbrochener Züge‹ nicht hierarchisch, sondern im dargestellten Sinne ›dynamisch‹ hervorgebracht wird. Das hieße: Der ›eine‹ dreitönige Terz- oder fünftönige Quintzug, der die Urlinie einer Komposition (eines Formabschnitts oder einer Taktgruppe) bildet, erklingt nicht – in dem Sinne, dass drei der insgesamt fünf Töne des unterbrochenen Terzzugs (resp. fünf der insgesamt neun Töne des unterbrochenen Quintzugs) die ›eigentliche‹ Struktur repräsentieren. Vielmehr stellt die Urlinie mit ihren drei oder fünf Tönen eine ›Idee‹ dar, auf die man die beiden erklingenden Strukturteile wie gleichberechtigte ›Abbilder‹ beziehen darf.
Die Einheit der Taktgruppe geht aus der wechselseitigen Bezugnahme der Teilstücke hervor.[43] Das erste Teilstück ist weder die ›eigentliche‹ Repräsentation des Hintergrundes noch ein ›Gang in die Mittelstimme‹, sondern ebenso ›Abbild‹ des Hintergrundes wie das zweite Teilstück, von dem es sich durch die geringere Schlusskraft unterscheidet. Dass erst das Teilstück nach der Unterbrechung den Formabschnitt oder die Taktgruppe beschließen kann, bedeutet (für uns, nicht für Schenker) nicht, dass es deswegen für den Repräsentanten des Hintergrundes gelten darf; denn seine Schlusskraft ist eine Funktion des ersten Teilstücks: Sie käme ohne diese nicht zustande. Dadurch wiederum erhellt sich, dass der Zug bereits mit dem ersten ›Abbild‹ beginnt und dass in den fünf oder neun Tönen eines unterbrochenen Terz- oder Quintzugs keine Ton-Funktion doppelt vorkommt, obwohl zwei oder vier der beteiligten Töne dieselbe Tonhöhenklasse wie andere aufweisen.
Anmerkungen
Diese Herausforderung haben in der Vergangenheit bereits verschiedene Autoren angenommen, so Markus Jans (i.V.) und Lauri Suurpää (2006). | |
So beispielsweise Suurpää 2006, 164. | |
Ansonsten wäre jede Kadenz ein eigener Abschnitt. | |
Schenker 1956, 41. Man könnte entgegnen, dass sich der Ausdruck »Zwang« allein auf die ›Selbigkeit‹ der Richtung bezieht, in die ein Durchgang fortschreiten muss, nicht aber auf das Fortschreiten überhaupt. Dieser Einwand verfängt jedoch nicht, weil mit dem Zwang, in eine bestimmte Richtung fortzuschreiten, immer auch ein Zwang zum Fortschreiten überhaupt einhergeht. Überdies wäre anzumerken, dass sich ein etwaiger ›Zwang‹ immer mit dem Fortschreiten selbst und nicht mit einer bestimmten Richtung des Fortschreitens verbindet. | |
Ebd., 72. Der Durchgangscharakter der ^2 wird besonders im Zusammenhang mit der Unterbrechung des Terzzugs hervorgehoben: Dieser Charakter präge den Terzzug auch dann, wenn die erste ^2 als Teiler erscheine (ebd.): »Die Unterbrechung schafft […] auch die Wirkung einer Aufhaltung, Retardation. Die Unterbrechung vermag diese Wirkung zu erzielen, nur weil sie den Ursatz in sich trägt, der auch Umwegen doch zu seiner Erfüllung gelangt. […] Erst am Ziele ^1I durchschauen wir das Spiel, das die Unterbrechung mit uns getrieben, und wir sehen ein, daß im Sinne der Einheit des Ursatzes gerade der erste Stand ^2V wesentlicher als der zweite ist, eine Erkenntnis, die für die Ausgestaltung und Wirkung größerer Formen entscheidend wird. […] Auf Grund der Fühlungsnahme mit dem Ursatz bleibt die erste ^2 dem Gesetz des Durchgangs im Terzraum treu.« Das dynamische Moment der Unterbrechung wird mehr als von Schenker von Cadwallader und Gagné betont (1998, 167): »It is important to stress that the sense of completion is fulfilled only after the structure begins again, that is, after the second phrase retraces its path from ^3 over I, moves through ^2 over V, and this time attains the ^1 over I that is the goal of an Urlinie and bass arpeggiation. In short, the second part of an interrupted structure resolves the tensions created by the interruption of the first part.« | |
Vgl. Schenker 1956, Anh. Figurentafeln 101,4. | |
Suupää 2006, 169. | |
Der Versuch, alle Kadenzen unter eine einzige Struktur zu fassen (beispielsweise unter einen Terzzug), wäre technisch zwar möglich, bliebe aber angesichts der fehlenden Differenzierungen unglaubwürdig. Man müsste die erste sich bietende ^3 (diejenige der ersten Kadenz) und die letzte sich bietende ^1 (vor dem ›Epilog‹) als Ecktöne der Struktur festsetzen und sich zudem für eine ^2 entscheiden. Schwierig erscheint, eine ^2 zu finden, die sich als Repräsentantin des Hintergrundes begründen lässt. | |
Koch 1793, 191. | |
Das Beispiel des Schlusschors eignet sich für die Aufgabe, dieser Fundierung nachzugehen, aus mehreren Gründen: 1. Die Abfolge der Ereignisse zwingt zu einer autonomen Betrachtung der syntaktischen Verhältnisse, weil die einschlägigen Begriffe ›Periode‹ und ›Satz‹ nur eine geringe oder keine explikative Bedeutung besitzen. Selbstverständlich lassen sich zwei- oder viertaktige Gebilde unter den Namen Satz und Periode zu achttaktischen Taktgruppen zusammenzufassen (und im Falle der Takte 564–571 ist dies auch sinnvoll), doch führt von den Begriffen nicht bereits durch ihre Applizierung ein Weg zur Fundierung von Dynamik und Einheit (vielmehr ist erklärungsbedürftig, wie die syntaktischen Verhältnisse, die mit den Ausdrücken Periode und Satz bezeichnet werden, zum Zustandekommen von Dynamik und Einheit beitragen können). 2. Eine Bestimmung syntaktischer Funktionen, die von den ›Inhalten‹, den satztechnischen Konstellationen, ausgeht, wird erleichtert, wenn die Gesamtfunktion eines Formabschnitts feststeht. Dass der Aktschluss ein Schluss ist, dürfte unstrittig sein. Darüber hinaus steht fest, dass der Schluss in der Musik des späten 18. Jahrhunderts durch Kadenzen ›vollzogen‹ wird, so dass auch ein Ansatzpunkt für die Erklärung einer Fundierung syntaktischer Funktionen durch satztechnische Konstellationen gegeben ist. | |
Für die Schenker’sche Lehre ist die Möglichkeit der Bestimmung einer solchen Stelle essentiell. | |
Gleichwohl erlaubt auch diese Kadenz eine Fortsetzung (die allerdings wegen der Bedeutung der Kadenz lediglich wie ein Nachspiel klingt). | |
Alle Partiturausschnitte des Schlusschors aus der Zauberflöte werden auf vier Systemen dargestellt. Dabei zeigen die mittleren den originalen Chorsatz, die äußeren hingegen eine Auswahl der Orchesterstimmen. Die Strukturtöne, die in den Diagrammen 1–3 angegeben sind, finden sich ausschließlich in den Chorstimmen (dort in den Außenstimmen). | |
Das erste f ist als Übergreifton vom zweiten f als Nebennote zu unterscheiden. Bei Schenker heißt es im Zusammenhang mit dem »Unterschied zwischen einer höhergelegten Sept und der echten höheren Nebennote: die echte Nebennote erscheint bei einem plagalen Satz oder einem Satz der Brechung meist als Oktave, die über der V. Stufe schließlich zur Sept wird: IV8-V7.« (1956, 73) | |
Der Gang der Oberstimme in Takt 530–34 (d2-h1-g1-f1-f2-e2) wird auf einen vorübergehenden Stimmtausch im Mittelgrund zurückgeführt. | |
Im Epilog wird der Schlussformel wieder eine Wechselnotenbewegung vorangestellt. | |
Der Reduktion der musikalischen Konstellationen entspricht sinnfällig eine des Textes. | |
Zwar ist auch die Bedeutung dieser beiden Takte von den vorhergehenden Ereignissen abhängig, aber methodisch kann man von dieser Stelle ausgehen. | |
Zu den ›Einschnürungen‹ der Barockzeit siehe die folgenden Ausführungen. | |
Überdies ermöglicht die Konstellation aus Zäsur und Kontinuität, den G-Dur-Septakkord als betont zu hören. Durch seine Platzierung in einem leichten Takt macht er überdies einen ›quasi-synkopischen‹ Eindruck. | |
Diese letzte Beobachtung gibt Anlass zu der These, dass möglicherweise bereits in Takt 8 eine neue Taktgruppe beginnt. Vgl. dazu die Analyse in Haas/Diederen i.V. | |
Aus Sicht von Heinrich Schenker betrachtet, handelt es sich um einen unterbrochenen Quintzug (cis2-h1-a1-gis1), an den sich am Ende ein Gang in die Mittelstimme anschließt (gis1-fis1-eis1). | |
Vgl. hierzu die Ausführungen von Frank Samarotto (1999, 231–238), der vor allem die Dreitaktigkeit der Einschnürung hervorhebt (den Ausdruck ›Einschnürung‹ verwendet er nicht), um damit auf Probleme der »Rhythmic Reduction« hinzuweisen. | |
Zu den Problemen der metrischen Bestimmung vgl. Schachter 1999 und Dahlhaus 1974. | |
Dieser Umstand bedeutet nicht, dass die Metrik keiner wissenschaftlichen Theoriebildung zugänglich wäre, sondern dass eine Form von Wissenschaftlichkeit gefunden werden muss, die den Phänomenen der Metrik gerecht wird. | |
Dem Einwand, die Behauptung impliziere, dass dem Interpret jede denkbare Deutung offen stünde, wäre mit dem Hinweis zu begegnen, dass Entscheidungen über die metrische Qualität einzelner Takte nicht beliebig ausfallen können, weil eine Verpflichtung zur Kohärenz aller getroffenen Entscheidungen besteht. Gerade weil metrische Entscheidungen Teilentscheidungen über strukturelle Verhältnisse sind, die mindestens einen ganzen Formabschnitt betreffen, sind der Willkür Grenzen gesetzt. | |
Vgl. hierzu auch Schachter 1999 und Polth 2000, 107ff. | |
Vgl. zur Differenz zwischen metrischen Schwerpunkten und melodischen Betonungen auch den Unterschied zwischen ›Hypermeasure‹ und ›Phrase Structure‹, wie ihn William Rothstein näher ausführt (1989, 10–13). | |
Kolneder 1990, 82. | |
Der metrische Schwerpunkt lässt sich nicht aus bestimmten Merkmalen im Tonsatz herleiten oder auf diese reduzieren (auch die Bestimmung ›Anfang‹ ist kein Kriterium, das als solches erkannt würde, sondern beruht auf ›Kontext‹), er ist aber auch nicht unabhängig von den Ereignissen im Tonsatz. Vielmehr entspringt er einer Auffassung über die Gruppierung der Ereignisse. Weil die syntaktischen Grenzen dabei kein zwingendes Kriterium sind, kann die Metrik zu ihr einen Kontrapunkt darstellen. | |
Zum Ausdruck ›eingebettete Takte‹ siehe Schenker 1956, 191. | |
Vgl. Polth 2000, Haas 2008. William Rothstein (1995, 168f.) würde hier vielleicht von einem »Shadow Meter« sprechen. | |
Zählungen mit a oder b (beispielsweise 8a und 8b) deuten an, dass die vorherige Taktfunktion (beispielsweise 8) im nächsten Takt oder in den nächsten Takten immer noch gilt, also wiederholt oder gedehnt wird. | |
Der synkopische Sekundakkord der Doppeldominante (T. 545 und 551) erfährt als vierter Takt der Taktgruppe einen weniger massiven Charakter denn als zweiter. | |
Auch hier sei noch einmal daran erinnert, dass die metrischen Bestimmungen aus dem ›Kontext‹ heraus vorgenommen werden. Betrachtet man die Kadenzen in Takt 542–556 isoliert, blendet man also den Einfluss der ›Einschnürung‹ aus, dann hindert nichts daran, die Schlusstakte als metrisch schwer (also als Eröffnung der folgenden Kadenz) zu hören. | |
Die Schlussformel führt diesmal von einem 5. Ton auf einen 1. Ton. Dass Mozart die Herbeiführung des 5. Tons in den Takten 546–547 und 552–553 durch ein Abwechseln zwischen den Akkorden auf G und D hinauszögert (wodurch die Kadenzen auf sechs Takte erweitert werden), gibt Gelegenheit dazu, die genannten Takte 548 und 554 als erste einer neuen Taktgruppe zu hören. | |
Diejenigen Stellen, an denen dies theoretisch geschehen sollte (T. 558 und 562), befinden sich mitten in der Überbindung (auch wenn sie durch das Ende der Dreiklangsbrechung in den Bläsern markiert sind). | |
Der Neubeginn der Taktgruppe wird durch den Beginn der Achtelläufe in den Bässen markiert. | |
Daraus ergibt sich, dass man die Reihe der Kadenzen nicht als Prolongation einer einzigen Kadenz im Schenker’schen Sinne betrachten darf. | |
Die wechselseitige Beleuchtung ist eine wechselseitige Abhängigkeit: Die Funktion der einen Schlussformel kann es nur geben, weil es zugleich die Funktion der anderen gibt. Fiele eine der beiden Formeln aus (ohne dass eine anderweitige Kompensation einträte), dann ginge mit ihr nicht nur deren Funktion verloren, sondern auch diejenige der anderen Formel. | |
Schenker 1956, 71–76. | |
Marston 2013. | |
Hervorzuheben wäre, dass die Annahme ›dialektischer Beziehungen‹ bereits für Musik deutlich vor Beethoven von Relevanz ist, auch wenn diese Art von Beziehungen offensichtlich erst bei Beethoven durchbricht (vgl. hierzu Schmalfeld 1995). |
Literatur
Cadwallader, Allen und David Gagné (1998), Analysis of Tonal Music, New York: Oxford University Press.
Dahlhaus, Carl (1974), »Zur Kritik des Riemannschen Systems«, in: Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen Rhythmik und Metrik, hg. von Ernst Apfel und Carl Dahlhaus, München: Katzbichler, 184–203.
Haas, Bernhard / Diederen, Veronika (2008), Die zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach, Hildesheim u.a.: Olms.
––– (i.V.), »Bach, Präludium C-Dur BWV 939«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Hartmut Fladt und Michael Polth, Hildesheim u.a.: Olms.
Jans, Markus (i.V.), »Die Idee und ihre formale Anlage. Über die Bedeutung der Multiplikation«, in: Mozart. Stationen – Wandlungen – Brüche, ZGMTH-Sonderband.
Koch, Heinrich Christoph (1793), Versuch einer Anleitung zur Composition. Dritter und lezter Theil, Leipzig: Böhme.
Kolneder, Walter (1990), Georg Muffat zur Aufführungspraxis, 2. Aufl. Baden-Baden: Valentin Koerner.
Marston, Nicholas (2013), »The Development of Schenker’s Concept of Interruption«, Music Analysis 32, 332–362.
Polth, Michael (2000), Sinfonieexpositionen des 18. Jahrhunderts, Kassel u.a.: Bärenreiter.
Rothstein, William (1989), Phrase Rhythm in Tonal Music, New York und London: Schirmer.
––– (1995), »Beethoven with and without ›Kunstgepräng’‹: Metrical Ambiguity Reconsidered«, Beethoven Forum 4, 165–193.
Samarotto, Frank (1999), »Strange Dimensions: Regularity and Irregularity in Deep Levels of Rhythmic Reduction«, in: Schenker Studies 2, hg. von Carl Schachter und Hedi Siegel, Cambridge: Cambridge University Press, 222–238.
Schachter, Carl (1999), »Aspects of Meter«, in: Unfoldings, New York, Oxford: Oxford University Press, 79–117.
Schenker, Heinrich (1956), Neue musikalische Theorien und Phantasien, III: Der freie Satz, hg. und bearb. von Oswald Jonas, 2. Aufl. Wien: Universal Edition.
Schmalfeld, Janet (1995), »Form as the Process of Becoming: The Beethoven-Hegelian Tradition and the ›Tempest‹ Sonata«, in: Beethoven Forum 4, 37–71.
Suurpää, Lauri (2006), »The First-Movement Exposition of Mozart’s ‘Prague’ Symphony: Cadences, Form, and Voice-Leading Structure«, Dutch Journal of Music Theory 11, 164–177.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.