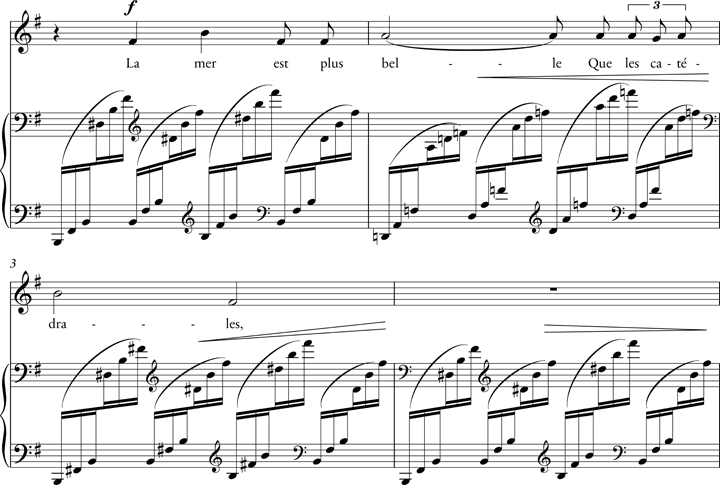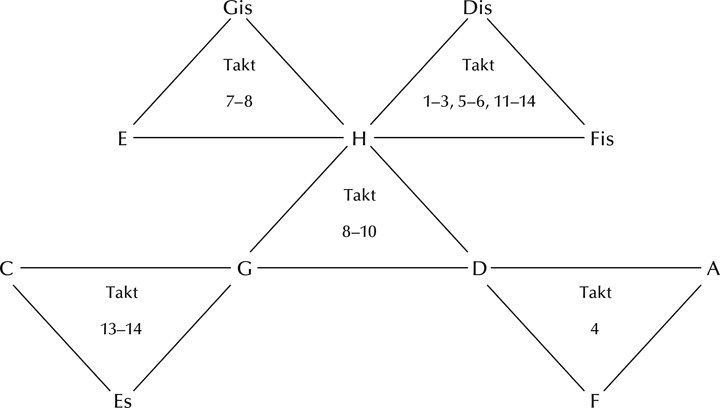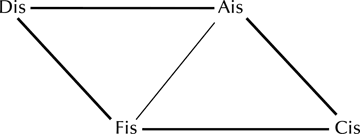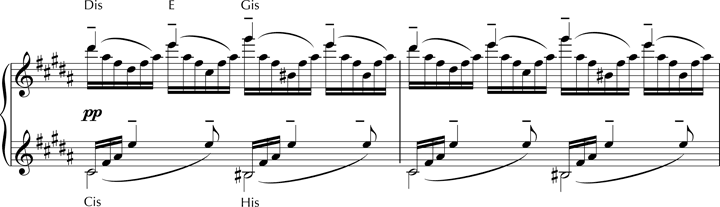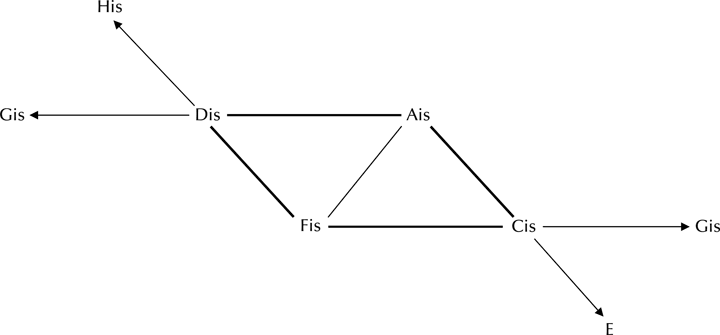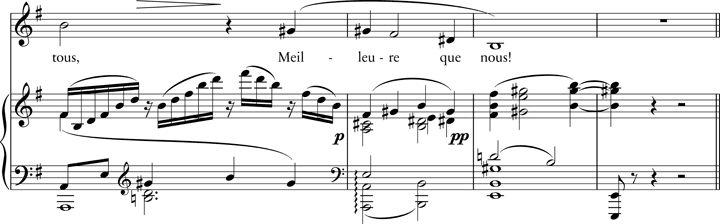Elle a des airs bleus, roses, gris et verts
Das Farbenspiel in Debussys La mer est plus belle
Matthias Ningel
Die folgende Analyse von La mer est plus belle verfolgt eine multiperspektivische Strategie, um vorrangig die einheitsstiftenden Elemente der Komposition aufzuzeigen. Zentral hierbei erscheinen die Analyseparadigmen des ›klanglichen Dreitakts‹, der ›Zentralklangkomposition‹, der Tonnetzanalyse und der Funktionsharmonik.
Debussys Musikauffassung
Claude Debussy schätzte jegliche Kompositionslehre gering. Sein gesamtes Leben hindurch untermauern Selbstzeugnisse seine negative Einstellung gegenüber musikalischen Regeln, denen er eine korsetthafte Wirkung auf den Musikschaffenden nachsagte. Im Jahre 1902 bekundet Debussy in der Zeitschrift Musica:
Was der französischen Musik am dringlichsten zu wünschen wäre, ist die Abschaffung des Studiums der Harmonielehre, wie man es an den Hochschulen betreibt. Eine pompösere und lächerlichere Art, Klänge zusammenzufügen, läßt sich nicht denken.
Und auch in einem 1911 geführten Interview formuliert er es direkt und unmissverständlich:
Ich kann die Doktrinäre und ihre Impertinenz auf den Tod nicht leiden.[1]
Debussy muss als Komponist in einem sehr hohen Maße seiner Intuition gefolgt sein. Nicht das bewusste Befolgen einer Regel, sondern schlicht sein eigenes Gefühl von Stimmigkeit ist Debussys Maßstab. Jede Analyse sollte versuchen, dem gerecht zu werden. Albert Jakobik bringt diese Prämisse auf den Punkt, wenn er vorschlägt »einen Debussy ›von Debussy aus‹ zu entwerfen«.[2]
Debussys kompositorisches Denken ist geprägt durch den Glauben an ein intuitives und ewiges Wissen über Harmonie, das in der Natur zu finden sei. Mit Debussys eigenen Worten:
Für den, der mit dem Herzen schaut und lauscht, ist das die beste Entwicklungslehre, geschrieben in jenes Buch, das von den Musikern nur wenig gelesen wird: das der Natur.
Musik soll demnach ›natürlich‹ sein. Sie soll Ihre Logik in sich selbst tragen und nicht von einem übergeordneten Regelwerk empfangen. Sie soll in ihrer Komplexität ebenso unergründlich sein wie die Natur selbst. Noch einmal Debussy:
Wer wird das Geheimnis der musikalischen Komposition ergründen? Das Rauschen des Meeres, der Bogen des Horizonts, der Wind in den Blättern, ein Vogelruf hinterlassen in uns vielfältige Eindrücke. Und plötzlich, ohne dass man das mindeste dazutut, steigt eine dieser Erinnerungen in uns auf und wird zur musikalischen Sprache. Sie trägt ihre Harmonie in sich selbst.[3]
Diese Hochachtung vor dem Zusammenwirken aller natürlicher Kräfte, einem Spiel, das die Fähigkeit menschlichen Verstehens transzendiert, erinnert an den Glauben an die Sphärenharmonie und trägt Züge eines ehrfürchtigen Pantheismus in sich, der sich auch in der folgenden Äußerung Debussys als Monsieur Croche manifestiert:[4]
Die Musik […] ist eine Summe unterschiedlicher Kräfte. […] Mir sind ein paar Noten lieber, die ein ägyptischer Hirte auf seiner Flöte bläst – er ist eins mit der Landschaft und hört Harmonien, von denen sich eure Schulweisheit nichts träumen lässt.[5]
Die Begriffe des ›Stationären‹ und ›Zuständlichen‹ haben sich im Beschreibungsvokabular für den Stil Debussys etabliert. Tatsächlich aber sind sie irreführend, insofern sie suggerieren, der Musik Debussys mangele es an Beweglichkeit; sie verzichtet nur häufig auf Zäsuren und allzu scharfe Kontraste.[6] Auch beim Wechsel der Tonart geht Debussys Bemühen dahin, einen Übergang zu schaffen, der ohne alle Gewalt ist.[7]
Die Vermutung liegt nahe, dass Debussy den Gegensatz von ›stationär‹ versus ›beweglich‹ dadurch löst, dass Neues immer als Variante von etwas Vorherigem in Erscheinung tritt. Wie Debussy es versteht, ohne jähe Kontraste zu komponieren, soll die folgende Analyse des Liedes La mer est plus belle demonstrieren.
Analyse von La mer est plus belle
La mer est plus belle ist das erste Lied aus den 1891 komponierten und 1901 erschienenen Trois Mélodies de Paul Verlaine. Der Rückgriff auf Verlaine ist naheliegend: Das Gedicht formuliert die gleiche Auffassung von der Naturschönheit, der allumfassenden Weltharmonie und der menschlichen Stellung darin, wie sie auch Debussy vertritt. So wird die Schönheit des Meeres als nicht mehr steigerungsfähig beschrieben: »plus belle que tous, meilleure que nous!« Das Meer wird in die Nähe des Religiösen gerückt, wenn Verlaine in diesem Kontext die Heilige Jungfrau Maria nennt: »la mer qui prie la vierge Marie!« Und auch die einheitsstiftende Funktion der Natur begegnet in Verlaines Gedicht: Alle unterschiedlichen Eigenschaften, die schrecklichen wie die zarten, werden zu einem harmonischen Ganzen vereint: »Elle a tous les dons, terribles et doux«. In der letzten Strophe wird zusätzlich der Himmel beschrieben und die harmonische Verbindung von Himmel und Meer in ihrer Farbenpracht dargestellt: »Elle a des airs bleus, roses, gris et verts«. Das den Text kennzeichnende Spannungsverhältnis zwischen Einheit und Vielfalt der Erscheinungsformen soll auch den Leitfaden der Analyse bilden.
Ein Gefühl von Einheitlichkeit entsteht in Debussys Komposition durch die konstante Motorik der Sechzehnteltriolen im Klavierpart. Das fortlaufende Arpeggieren und ein stetes organisches Steigen und Sinken der Lautstärke wirken ebenfalls einheitsstiftend. Rhythmische Änderungen im Klavier, wie etwa bei der Zwei-gegen-drei-Rhythmik in Takt 26, sind so beschaffen, dass der zugrundeliegende Viertelpuls deutlich erhalten bleibt. Auch die letzten drei Takte mit ihrer klaren Setzweise in Vierteln ohne Arpeggios sind durch die Verlangsamung der Sechzehnteltriolen zu duolischen Sechzehnteln in Takt 37 organisch herbeigeführt.
Die Rhythmik der Singstimme ist insofern einheitsstiftend, als sie durchgehend dem gesprochenen Vortrag des Textes nahekommt. Die betonten Silben sind tendenziell länger und etwas exponierter: »La mer est plus belle que les catédrales.« (Die markierten Silben befinden sich jeweils auf einer ersten Zählzeit und haben den Notenwert einer halben Note.)
Ferner entstammen nahezu alle Melodietöne dem begleitenden Klaviersatz. Ausnahmen sind meist unmittelbar vor Harmoniewechseln auszumachen. Dann vitalisieren melodische Wendungen das harmonische Geschehen. Hierbei handelt es sich fast immer um Sekundschritte auf kurzer Zählzeit, so etwa in Takt 4 das g1 in der Gesangsstimme, welches vom akkordeigenen a1 abweicht und den Ausgangspunkt der aufsteigenden Linie g1-a1-h1 bildet, die den Harmoniewechsel zu H-Dur in Verbindung mit dem h1 vorbereitet.
Kennzeichnend für Debussys Melodik sind also einerseits der hohe Grad an Einbettung in die Harmonik, andererseits die subtilen richtungsweisenden Momente, die Harmoniewechsel herbeiführen bzw. unterstützen.
Beispiel 1: Claude Debussy, La mer est plus belle, T. 3–6
Die harmoniebeeinflussenden Momente der Melodik wiederum richten sich stark am gesprochenen Text aus. Es sind die betonten Worte, die mit den melodisch vorbereiteten Harmoniewechseln zusammen fallen. Auch im obigen Beispiel (»La mer est plus belle que les catédrales«) wechseln die Harmonien unabhängig von der Position im Takt jeweils auf betonter Silbe. So erfolgt der Harmoniewechsel beispielsweise in Takt 8 erst auf der zweiten Zählzeit.
Festzuhalten ist also, dass sich Text und Melodik der Singstimme zusammen mit dem Klaviersatz zu einer organischen Einheit verbinden. Entwicklungen werden also immer vom gesamten Organismus vollzogen: Die Melodik ist gekoppelt an die Harmonik; die Harmoniewechsel sind gekoppelt an die Melodik; der Rhythmus ist ein Teil der Melodik und wiederum gekoppelt an die Textbetonungen.
Zur Darstellung des Verlaufs der harmonischen Felder eignet sich das Eulersche Tonnetz. Diese durch die Neoriemannian- bzw. Pantriadic Theory wieder stärker in den Fokus gerückte Darstellungsweise von tonaler Nähe bringt Klarheit in das harmonische Geschehen.[8] Das Tonnetz bildet sämtliche Dur- und Molldreiklänge als Dreiecke ab. Die nach oben ausgerichteten Dreiecke repräsentieren Durdreiklänge, während die nach unten gerichteten Dreiecke das Tongeschlecht Moll darstellen. Tonale Nähe von Akkorden entsteht durch gemeinsame Töne. In La mer est plus belle ist in den ersten Takten eine deutliche, sogar symmetrische Gruppierung um den Akkord G-Dur zu erkennen.
Abbildung 1: Claude Debussy, La mer est plus belle, Takt 1–14, Diagramm der verwendeten Harmonien
Ginge man von der zugrundeliegenden Skala aus, wären die einzelnen Akkorde voneinander tonal weit entfernt. Dass allen umliegenden Akkorden ein zu G-Dur gehöriger Dreiklangston zu eigen ist, stellt hier die Verbindung her.
Diese Nähe aller Akkorde zu G-Dur findet sich nicht im gesamten Stück. In diesem Zusammenhang sollte kurz auf eine fundamentale Eigenschaft sämtlicher Kompositionen Debussys eingegangen werden, die Albert Jakobik erstmals benannt hat. Anknüpfend an Debussys Selbstverständnis als ›Tonmaler‹ entwickelte Jakobik ein Analyseverfahren, das die Farbverläufe im Werk nachzuvollziehen versucht. Demnach verfügt jedes Stück über eine »Grundfarbe«, die vor allem an dessen Anfang und am Ende auftritt. Im Verlaufe des Stückes kommt es zu Mischprozessen, bei denen eine »Gegenfarbe« zur Geltung kommt. Diese ergänzt den Tonvorrat des Stückes zur Vollchromatik. Eine verbindende Funktion kommt einer offenen »Vermittlungsfarbe« zu, die zwischen Grundfarbe und Gegenfarbe steht. Dieses Farbspiel nennt Jakobik den »klanglichen Dreitakt«.[9]
Bereits die Vorzeichen in La mer est plus belle machen einen ›klanglichen Dreitakt‹ plausibel: Beginnend und endend mit einer G-Dur-Vorzeichnung sind im Mittelteil fünf Kreuze vorgezeichnet. Der Mischprozess wird nach Takt 14 eingeleitet. Eine Vermittlungsfarbe lässt sich gleichwohl nicht ausmachen, vielmehr ist der Farbwechsel durch eine Sequenz herbeigeführt. Die im Klavier identischen Takte 13 und 14 setzen zweimal die Farben H-Dur und c-Moll gegenüber. Im gleichen Verhältnis stehen die folgenden zwei Farben D-Dur und dis-Moll, die ebenfalls zweimal in exakt gleicher Setzweise in den Folgetakten 15 und 16 erklingen. Sämtliche Parameter bis auf die Tonhöhe sind also in diesen Takten beibehalten – genug Gleichbleibendes, um den Richtungswechsel in andere tonale Gefilde gewaltlos durchzuführen. Von dis-Moll ausgehend ist das Erreichen der Gegenfarbe in Takt 17 nicht mehr weit. Sie ist durch die Töne fis und ais bestimmt, und auch der Ton cis erklingt erstmalig im Stück, wodurch die Vollchromatik realisiert ist. Hervorgehoben ist dieser Moment dadurch, dass hier zum ersten Mal kein Dreiklang sondern ein Vierklang im Klavier erklingt. Dieser ist ein Hybrid aus den Akkorden Fis-Dur und dis-Moll. Dem entspricht folgende Darstellung im Tonnetz:
Abbildung 2: Claude Debussy, La mer est plus belle, T. 17, Diagramm mit den Tönen der ›Gegenfarbe‹
Die Lautstärke, die während des Lied stets im Auf- und Absteigen begriffen ist, befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Forte. Die ostinate Akkordbrechung im Klaviersatz wird ab Takt 17 doppelläufig. Passend zum gesungenen Wort »immensité« wird hier ein Höhepunkt erreicht, ähnlich dem Entstehen einer Welle aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher Strömungskräfte im Wasser.
Die Gegenfarbe dominiert bis in Takt 25, wo sich fast keine Versetzungszeichen finden und sich die Musik in der tonleitereigenen Klanglichkeit bewegt. Vor allem in den Takten 19–20 treten fis und ais als die Gegenfarbe bestimmende Klänge sehr gehäuft auf.
Zudem realisiert Debussy an dieser Stelle eine Kompositionsweise, die Christoph Wünsch als »Zentralklangkomposition« bezeichnet.[10] Gemeint ist die allmähliche Verdichtung eines Tonvorrates um einen zugrundeliegenden Zentralklang. Dieser Verdichtungsprozess führt zu einer Sättigung des Farbwertes. Der oben dargestellte Hybridklang aus dis-Moll und Fis-Dur wird als Zentralklang durch ein schrittweises Erschließen weiterer Töne – deutlich sichtbar im äußeren Klaviersatz – zur Klanglichkeit der vollständigen Diatonik ausgebaut.
Beispiel 2: Claude Debussy, La mer est plus belle, T. 19–20, Erweiterung des Zentralklanges
Das Tonnetz zeigt die Erweiterung des Klangraumes und lässt eine gewisse Systematik erkennen:
Abbildung 3: Claude Debussy, La mer est plus belle, T. 17ff., Erweiterung des Tonvorrats vom Zentralklang ausgehend
Die Tonverbindung von Fis und Ais wirkt wie ein Anker, von dem aus in beide Richtungen achsensymmetrisch neue Klänge erschlossen werden. E-Dur ab Takt 23 bildet eine Schnittstelle mit jenem Klangraum, der sich eingangs um den Akkord G-Dur gruppierte (dort T. 7–8). Auf E-Dur folgt in Takt 25 ein C-Dur, das ebenfalls zum Klangraum der Grundfarbe gehört. Ab Takt 30 folgt dann ein expliziter Rückgriff auf den Anfang:[11] Die Takte 30–32 sind musikalisch identisch mit den Takten 3–5 und stellen somit die klangliche Grundfarbe wieder her. Es ist jedoch E-Dur, das auch zum Ende hin dominiert und den Schlussklang bildet.[12] Es wird durch eine für Debussy verblüffend konventionelle Kadenz erreicht:[13]
Beispiel 3: Claude Debussy, La mer est plus belle, Kadenz
Fazit
La mer est plus belle ist eine relativ frühe Komposition von Debussy. Nicht alle genannten Aspekte sind auch repräsentativ für seine späteren Werke. In seinen Etüden beispielsweise sucht Debussy bewusst die Beschränkung und unterwirft sich selbstauferlegten Regeln wie etwa dem konsequenten Gebrauch nur eines Intervalls. Bei den von solchen Beschränkungen freien Kompositionen des Frühwerks hingegen ist von einem stark intuitiv gelenkten Komponieren auszugehen. Die zahlreichen Selbstzeugnisse Debussys stützen diese Annahme.
Die Analyse des Liedes hat vor allem gezeigt, wie sämtliche musikalischen Parameter ineinander greifen. Einzelne Parameter isoliert zu betrachten, würde dem Gedanken der Werkeinheit nicht gerecht. Eine Aussage über die Gesangsmelodik ist beispielsweise zwangsläufig mit einer Aussage über Harmonik und Textrhythmus verbunden. Die Melodie empfängt ihre rhythmische Gestaltung von der Textvorlage. Betonungen des Sprechrhythmus werden durch längere Notenwerte in der Musik abgebildet. Die Melodietöne sind häufig dem Tonvorrat der begleitenden Akkorde entnommen. Wenn dies nicht der Fall ist, führen die akkordfremden Töne häufig schrittweise einen Harmoniewechsel herbei. Somit ist auch umgekehrt die Harmonik von der Melodik abhängig.
Die einzelnen Harmonien sind dadurch miteinander verbunden, dass sie gemeinsame harmonische Bezugspunkte teilen. Der harmonische Bezugspunkt der ersten Takte ist der G-Dur Akkord, wie die Tonnetzanalyse zeigte. In der Sequenz liegt dieser Bezugspunkt in dem gleichen Spannungsverhältnis der Akkordverbindung innerhalb eines Sequenzgliedes. Auch die ›Zentralklangkomposition‹ zeichnet sich gerade durch eine harmonische Verankerung aus.
Die Gesamtform entspricht am ehesten der ABA’ Form und folgt tendenziell Jakobiks Ansatz des ›Dreitakts‹. Allerding widerspricht das Fehlen der Grundfarbe am Ende des Stückes dieser Theorie.
Hieran wird deutlich, wie wertvoll die Einnahme vielerlei Blickpunkte für die Analyse sein kann. Von einer Suche nach einem alleinigen, der Musik zugrundeliegenden Prinzip sollte abgesehen werden. Auch ist nicht jedem zur Analyse herangezogenen Werkzeug jeweils nur ein Zuständigkeitsbereich zugeordnet. Im Gegenteil: Die Kombination mehrerer Werkzeuge kann gewinnbringend angewandt werden. Die Arbeit mit Zentralklängen, wie von Wünsch beschrieben, wird durch die Tonnetzdarstellung greifbar, ebenso der Begriff der assoziativen Harmonik. Die Mischprozesse in Jakobiks ›Dreitakt‹ können durch das Wissen um Sequenzen und ihr harmonisches Lenkpotential nachvollzogen werden. Daher sollte die Suche nach Prinzipien eher in Debussys persönlichen Stellungnahmen zu seiner Musikauffassung betrieben werden, während zur werkimmanenten Analyse ein möglichst gut gefüllter Werkzeugkoffer mitgebracht werden sollte.
Anmerkungen
Debussy 1974, 61 und 269. | |
Jakobik 1977, IX. | |
Debussy 1974, 153 und 269. | |
Zit. nach Reckow 1989, 178. | |
Debussy 1974, 49. | |
Auf dieses Paradox wird auch hingewiesen in: Albrecht 1957, 1056. | |
Barraqué 1964, 114, und Jakobik 1977, 25. | |
Cohn 2012, 25ff. und 28. | |
Jakobik 1977, 11. | |
Wünsch 2009, 63ff. | |
Die Gesamtform des Stückes ließe sich mit Blick auf das reprisenhafte Moment in Takt 30 am ehesten als ABA’-Form beschreiben. B bildet dabei keinen Kontrast, sondern kehrt eine einzelne farbliche Facette stärker hervor. | |
Insofern E-Dur möglicherweise als Vermittlungsfarbe zwischen Grund- und Gegenfarbe steht, würde dieser Schluss der Theorie Jakobiks freilich widersprechen. | |
Die letzten drei Takte ließen sich funktionsharmonisch als Folge von Subdominante mit zugefügter Sexte, Dominantseptakkord und Tonika oder stufentheoretisch als doppelter Quintfall II-V-I interpretieren. |
Literatur
Albrecht, Hans (1957), Artikel »Impressionismus«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hg. von Friedrich Blume, Kassel u.a.: Bärenreiter, Sachteil Bd. 6, Sp. 1046–1090.
Barraqué, Jean (1964), Claude Debussy. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, übers. von Clarita Waege und Hortensia Weiher-Waege, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.
Cohn, Richard (2012): Audacious Euphony. Chromaticism and the Triad’s Second Nature, New York: Oxford University Press.
Debussy, Claude (1974), Monsieur Croche. Sämtliche Schriften und Interviews, hg. von François Lesure, übersetzt von Josef Häußler, Stuttgart: Reclam.
Jakobik, Albert (1977), Claude Debussy oder die lautlose Revolution in der Musik, Würzburg: Triltsch.
Reckow, Fritz (1989), Artikel »Sphärenharmonie«, in: Musiklexikon, Bd. 4, hg. von Carl Dahlhaus, und Hans Heinrich Eggebrecht, Mainz: Schott.
Wünsch, Christoph (2009), Satztechniken im 20. Jahrhundert, Kassel: Bärenreiter.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.