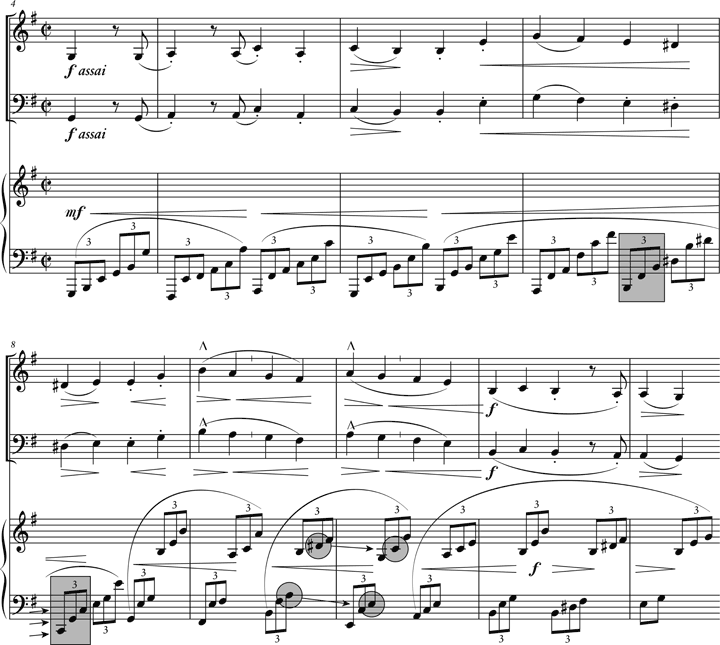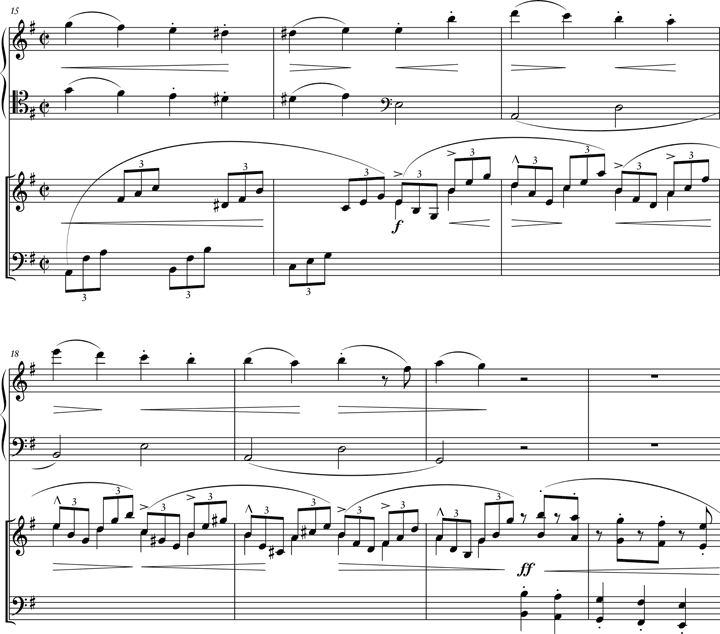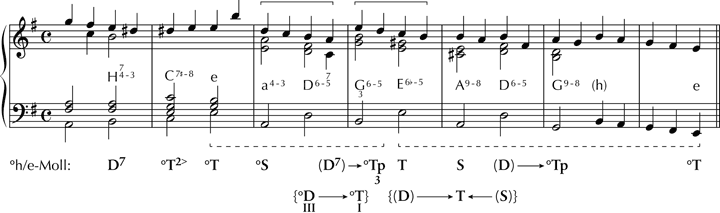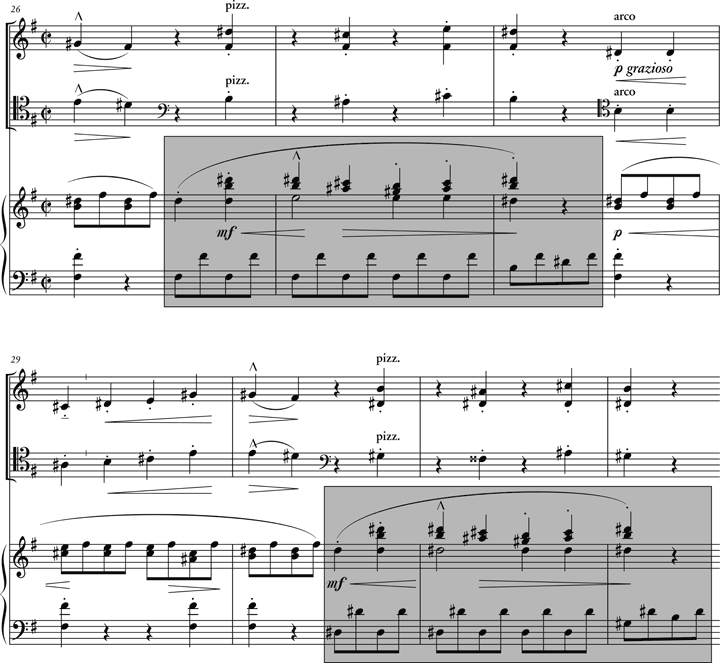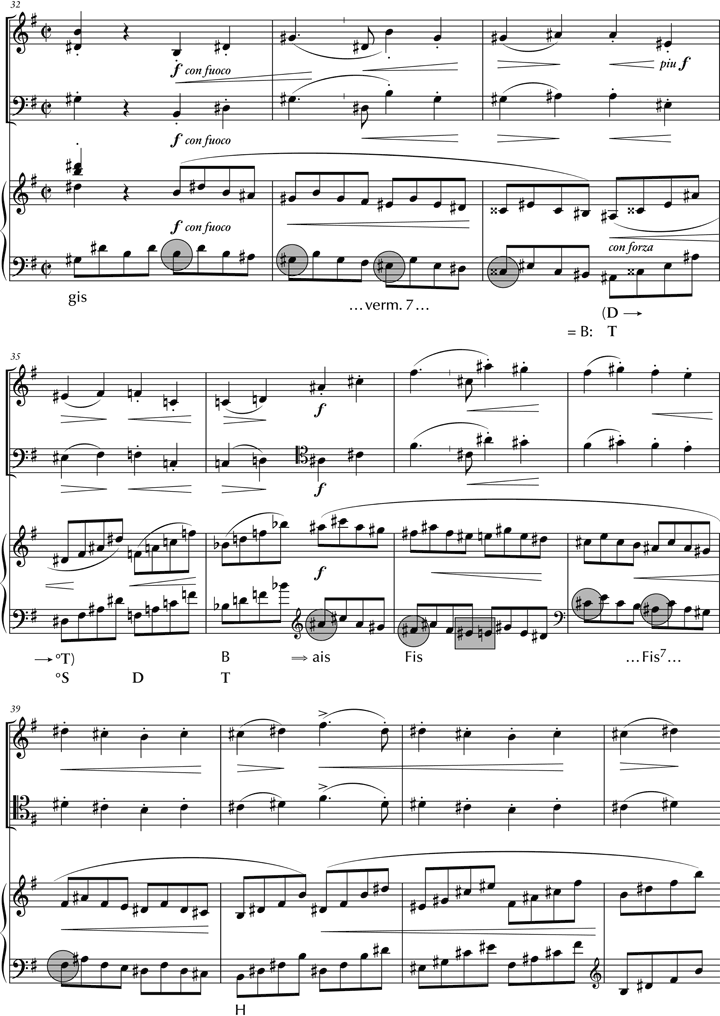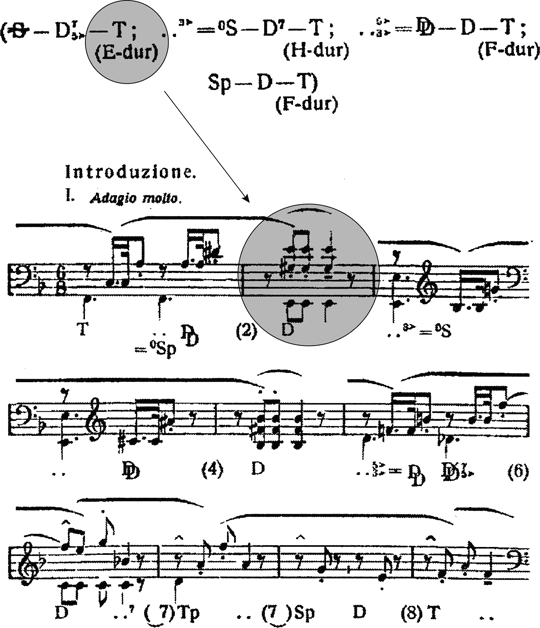Musiktheorie als Kompositionslehre und Komposition(slehre) als Musiktheorie – Hugo Riemann zwischen Theorie und Praxis
Eine Studie zu tonalen Funktionen und dem dialektischen Kadenzmodell
Stephanie Probst
»Die Theorie von Hugo Riemann stellt […] eine umfassende Theorie der tonalen Musik dar. […] diese Lehre betrifft nicht nur eine Deutung von Erscheinungen der Vergangenheit […], sondern sollte zu ihrer Zeit auch eine Kompositionslehre darstellen.«[1] Helga de la Motte-Habers Hinweis auf die nicht nur deskriptive, sondern auch präskriptive Natur von Riemanns Theorie wird im vorliegenden Artikel zum Anlass genommen, den Künstler Riemann in Beziehung zum Musikgelehrten Riemann zu setzen. Dem Komponisten soll seine eigene Theorie als Spiegel vorgehalten werden, um in Folge die Komposition zur Kritik der Theorie heranzuziehen.[2] Dabei gilt es vor allem, die Konsequenzen von Riemanns Dualismus sowohl in Bezug auf die Theorien als auch die Praxis kritisch zu beleuchten. Dies bildet die Grundlage für den Versuch, Riemanns Lehre von den tonalen Funktionen mit dem Deutungsgehalt seines dialektischen Kadenzmodells zu verknüpfen.
Die Entwicklung von Hugo Riemanns Musiktheorie
In seiner ersten musiktheoretischen Publikation »Musikalische Logik«[3] erkundet der 23-jährige Hugo Riemann die innere Dynamik tonaler Musik aus einer von Moritz Hauptmanns dialektischen Theorien beeinflussten Perspektive. Er kündigt jedoch an, die Thesen seines Vorgängers weiter auszuführen und vor allem die zeitliche Abfolge in dessen Tonalitätsmodell detaillierter darzustellen. Denn Hauptmann erkennt zwar in der Aufeinanderfolge von Akkorden das Grundprinzip der Tonalität, behandelt diese aber nur im Rahmen seiner generativen Theorie, die vor allem um die Herleitung und weniger um die Anwendung des tonalen Systems bemüht ist.[4]
Um Hauptmanns Theorie in ein dynamisches und damit auf praktische Anwendbarkeit ausgerichtetes Konzept umzuformen, setzt Riemann die ›thetischen Momente‹ Hauptmanns in eine klare temporale Ordnung[5] und verortet diese in den unterschiedlichen Qualitäten der drei Tonika-Akkorde in jener als »große Cadenz« bezeichneten Akkordfolge (I-IV-I6/4-V-I)[6]:
Ich sehe in diesem zweiten Auftreten der Tonika den Quintbegriff, der sich dem Einheitsbegriff des ersten Auftretens entgegensetzt, und der seine Terzeinigung durch die Oberdominante wieder in der Tonika findet, die nun wieder in der Grundlage erscheint.[7]
Im Anschluss erweitert Riemann das Konzept um die gängigeren dialektischen Begriffe ›These‹, ›Antithese‹, ›Synthese‹, die er zuerst als »Übergangsmomente« deutet.[8] Unmittelbar darauf allerdings lockert er die Stringenz der Zuordnung und bestimmt:
These ist die erste Tonika, Antithese die Unterdominante mit dem Quartsextaccord der Tonika, Synthese die Oberdominante mit dem Grundaccord der Tonika; thetisch ist die Tonika, antithetisch die Unter-, synthetisch die Ober-Dominante.[9]
Die letzte dieser Zuordnungen bestätigt Riemann in seiner Dissertation von 1874[10], wo er explizit formuliert: »thetischer Akkord ist die Tonika, antithetischer die Unterdominante, synthetischer die Oberdominante.«[11] Bereits im Artikel von 1872 vertieft Riemann diese Festlegung durch das Argument, dass IV alleine als ›Antithese‹ zur Tonika wirken könne. Als Beleg hierfür gilt ihm das häufige Auftreten der verkürzten Kadenz I–IV–V–I, in der – im Vergleich zur ›großen Cadenz‹ – der kadenzierende Quartsextakkord weggelassen wird. In Anlehnung an Hauptmann schreibt Riemann:
In freier Composition aber ist I–IV–V–I bei weitem die gebrauchteste Form, was darum sehr gut erklärlich ist und nicht als Lücke empfunden werden kann, weil in IV der tonartliche Grundton als Quint recht wohl als Gegensatz zu dem Grundton der Tonika angesehen werden kann, sodaß der Quartsextakkord der Tonika eigentlich nichts neues bringt …. In I–IV–V–I ist daher IV wirklich Antithese zu I ….[12]
Diese auf einzelne Akkorde fokussierte Zuschreibung darf allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass die Dialektik nach wie vor im Verhältnis der Akkorde zueinander zu verorten ist, ein Aspekt, den auch Alexander Rehding diskutiert.[13]
Zwei Schlussfolgerungen lassen sich bereits aus Riemanns Kadenzmodell ziehen: Erstens setzt das verwendete dialektische Schema das Zusammenwirken von drei Elementen voraus, was die Subdominante den anderen zwei Akkorden – und späteren Funktionen – hierarchisch gleichstellt.[14] Zweitens schreibt das dialektische Grundmodell eine ›logische‹ und damit ›natürliche‹ Reihung der Momente vor.[15] Jede andere Anordnung muss demnach als ›unlogisch‹ und ›unnatürlich‹ gelten. Diese Suche nach klar definierten Ordnungsprinzipien artikuliert Riemann als einen wesentlichen Beweggrund für seine Arbeit:
Zugleich habe ich, gegenüber der mehr und mehr sich entfaltenden Freiheit unserer modernen Harmonik und der aufkeimenden Ansicht, als können überhaupt jeder Accord jedem Accorde folgen, den Zweck vor Augen, nachzuweisen, daß eine ganz bestimmte Schranke für derartige Willkürlichkeit existiert, die in nichts Anderem zu suchen ist, als in der logischen Bedeutung der verschiedenen Tonstufen.[16]
Auch in späteren Schriften kritisiert Riemann immer wieder die zeitgenössische Kompositionspraxis, die er durch die Aufstellung von allgemein gültigen Gesetzen über die Tonalität in ihre Schranken zu weisen trachtet, um der drohenden Gefahr einer Aufhebung der tonalen Ordnung entgegenzuwirken. Allerdings wird Riemann selbst in seinen späteren Schriften dem von ihm postulierten Anspruch eines klaren Ordnungsprinzips nicht gerecht. Der Grund für diese Inkohärenz liegt – wie ich im Folgenden darstellen möchte – in Riemanns beharrlichem Festhalten an den Grundsätzen des harmonischen Dualismus.[17]
Erste Anzeichen eines dualistischen Denkens finden sich in Riemanns Dissertation von 1874 und werden 1877 in Musikalische Syntaxis vollständig entwickelt.[18] Ebenso deutlich zeigt sich der Einfluss dieser Denkweise im Handbuch der Harmonielehre (1887a)[19], in dem Riemann eine umfassende Theorie über tonale Relationen entwickelt. Durch die als ›Schritte‹ und ›Wechsel‹ bezeichneten Transformationen[20] sollen dort alle möglichen Dur- und Molldreiklänge innerhalb einer Tonart hergeleitet werden und jeweils ihr dualistisch geprägtes, symmetrisch entgegengesetztes Pendant erhalten.[21] Riemann etabliert so eine Systematik, die es erlaubt, einzelne Akkorde genau zu bezeichnen und ihr Verhältnis innerhalb der jeweiligen Tonalität präzise auszudrücken. So lässt sich zum Beispiel in C-Dur ein e-Moll-Dreiklang in dreierlei Weise herleiten: durch einen ›Leittonwechsel‹ von der Tonika (C-Dur) aus, durch einen ›Terzwechsel‹ von der Dominante (G-Dur) aus oder durch einen ›Tritonuswechsel‹ von der Subdominante (F-Dur) aus. Diese Art der Unterscheidung und Riemanns konstantes Bemühen, die ›Bedeutung‹ der verschiedenartigen Transformationen zu beschreiben, weisen bereits auf seine Funktionstheorie voraus.[22]
Die Ableitung aller Dur- und Molldreiklänge im Handbuch stellt eine klare Hierarchie der Beziehungen auf, die für Riemann auch Ausdruck des Konsonanz-Dissonanz-Gefälles ist. Durch das Prinzip der ›Scheinkonsonanz‹ können Dreiklänge auch dann als Dissonanzen aufgefasst werden, wenn ihr akustisches Klangbild als Konsonanz zu qualifizieren ist.[23] Allerdings setzt Riemann im Handbuch die tonalen Beziehungen noch nicht in größere Zusammenhänge und Abfolgen, nicht einmal im Rahmen eines Kadenzmodells. Diese stehen schließlich im Mittelpunkt von Riemanns Vereinfachter Harmonielehre von 1893[24], der Einführung in seine Funktionstheorie. Basierend auf den Operationen des Handbuchs definiert Riemann hier die tonalen Beziehungen ausgehend von den drei Bezugspunkten Tonika (T), Subdominante (S) und Dominante (D)[25], wodurch auch die ›Bedeutung‹ anderer Klänge präziser gefasst werden kann.[26]
Es wäre nicht abwegig anzunehmen, dass die Beziehungen zwischen den drei Hauptfunktionen durch Prinzipien bestimmt sind, die jenen in Riemanns Aufsatz über die ›musikalische Logik‹ ähneln. Riemanns eigene Darstellung verwehrt sich allerdings gegen eine solche Interpretation. Der Grund ist – wie oben erwähnt – sein Festhalten an dualistischen Prinzipien. Bei der Aufstellung der Funktionen in Kadenzmodellen verlangen die Grundsätze des harmonischen Dualismus eine symmetrische Gegenüberstellung der Dur- und der Mollkadenz, um die Gleichwertigkeit und Opposition der beiden Tongeschlechter zum Ausdruck zu bringen. Eben dies führt Riemann zur Behauptung, der Prototyp der Mollkadenz habe die Form °T–D–°S–°T.[27] Im Verhältnis zum Prototyp der Durkadenz (T–S–D–T) sind also Dominant- und Subdominantmomente vertauscht, weshalb eine Deutung an Hand eines dialektischen Modells weder ›logisch‹ noch möglich wäre.
Es ist dieses Konzept der ›dualistischen‹ Mollkadenz, das der Verbindung von Riemanns Funktionstheorie mit dem dialektischen Kadenzmodell als Haupthindernis im Wege steht. Viele Wissenschafter plädierten bereits dafür, die Funktionstheorie von ihren dualistischen Zügen zu lösen, und wiesen darauf hin, dass ihre Verknüpfung mit der Theorie des harmonischen Dualismus weder notwendig noch zweckmäßig ist.[28] Während Hermann Grabner bereits 1923 im Dualismus das Hindernis einer breiten Rezeption von Riemanns Theorien erkannte und den Zugang zu Riemanns Schriften durch eine vereinfachte, pädagogisch orientierte Fassung erleichterte[29], sah Carl Dahlhaus gar einen unvereinbaren Widerspruch zwischen kadenzieller Ordnung und den Prinzipien des Dualismus.[30] In ähnlicher Weise argumentiert Brian Hyer, dass eine konsequent dualistische Anordnung der Mollkadenz die Subdominante eine reine Quinte über und die Dominante eine reine Quinte unter der Tonika platzieren müsste.[31] Daraus folge, dass Riemanns dualistische Kadenz nicht konsistent sei.[32]
Obgleich die zwei Prinzipien der tonalen Funktionen und des Dualismus in der Entwicklung von Riemanns Musiktheorien eng miteinander verbunden sind, spricht also vieles für ihre Trennung. In der Praxis wird diese auch durchwegs vollzogen. So gilt der harmonische Dualismus – zumindest in seinen akustischen Ansprüchen – als wissenschaftlich widerlegt[33], während Riemanns Funktionstheorie, in vereinfachter und abgewandelter Form, vor allem im deutschsprachigen Raum vielfach Anwendung findet.
Bereits zu seinen Lebzeiten wurde Riemann mit Kritik am Dualismus konfrontiert[34], mit der er sich 1905 in einem Artikel ausgiebig auseinander setzte.[35] Bei dieser Gelegenheit sagte er sich unter anderem von der zuvor von ihm behaupteten »objektiven Existenz der Untertöne in der Schallwelle«[36] los und erkannte akustischen Phänomenen allgemein ihre Legitimität als Beweismittel musiktheoretischer Konzepte ab. Den Dualismus überhaupt zu verwerfen, war Riemann allerdings nicht bereit – dies hätte wohl sein gesamtes Theoriegebäude zu sehr ins Wanken gebracht. Stattdessen schlägt er eine neue, nunmehr psychologisch geprägte Argumentation zur Erklärung der Gleichwertigkeit und Opposition von Moll und Dur vor.
Zusammengefasst war es also die dualistische Dogmatik und emblematisch für sie die ›dualistische‹ Mollkadenz, die Riemann an der Integration der dialektischen Überlegungen seiner frühen Schriften in die später entwickelte Funktionstheorie hinderte. Aus heutiger Sicht erscheint eine solche Verbindung allerdings möglich und legitim. Zur Untermauerung dieser These möchte ich im Folgenden zwei Argumente vorbringen: Zunächst wird in einer exemplarischen Betrachtung von Riemanns eigener kompositorischer Praxis ersichtlich, dass Riemann die ›dualistische‹ Mollkadenz in erster Linie um der Kohärenz seiner Ausführungen willen postulierte, sie aber selbst als praxisfernes Konzept wahrgenommen haben muss. Anschließend möchte ich auf die konzeptuellen Gemeinsamkeiten zwischen ›musikalischer Logik‹ und der Lehre von den tonalen Funktionen hinweisen, die eine Verknüpfung dieser beiden Konzepte nahelegen.
Hugo Riemann als Komponist bzw. als komponierender Musiktheoretiker
Riemann, der eine kompositorische Ausbildung bei Carl Reinecke genossen hatte, verfolgte eine Zeit lang diese Ambitionen, bevor er sich mehr der Wissenschaft zu widmen begann. In späteren Jahren beschränkte er sich fast ausschließlich auf Werke mit pädagogischer Ausrichtung.[37] Für den Zeitraum zwischen 1873 und 1885 jedoch listet die Riemann-Festschrift[38] von 1909 immerhin 46 Opera auf: vorwiegend Klaviermusik, zahlreiche Lieder und Kammermusik, darunter ein Streichquartett. Das letzte größere und ambitionierte Werk, das auch zum Druck gelang, ist das Klaviertrio in E-Dur op. 47 von 1888.[39] Da sich meine Argumentation mit der Behandlung der Mollkadenz befasst, werde ich meine Ausführungen auf den dritten Satz der Komposition beschränken, der in e-Moll gesetzt ist (und nur am Ende nach E-Dur zurückführt).
In Anbetracht der intensiven Beschäftigung Riemanns mit musiktheoretischen Fragestellungen und des präskriptiven Anspruches seiner Theorie erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass sich seine theoretischen Überlegungen auch in seinem kompositorischen Schaffen widerspiegeln.[40] Vor allem bei einem Stück von 1888 könnte man womöglich eher von dem Werk eines komponierenden Musiktheoretikers als dem eines ungebunden agierenden Komponisten sprechen. Damit bietet sich das Werk für einen Vergleich mit Riemanns theoretischen Postulaten an, wie er im vorliegenden Artikel unternommen wird. Tatsächlich lassen sich im Klaviertrio deutliche Spuren von Riemanns theoretischem Denken erkennen, vor allem den Transformationen des Handbuchs, das nur ein Jahr vor dem Klaviertrio in Druck ging.
Schon die Fortschreitungen zu Beginn des Satzes (nach vier einleitenden Takten mit arpeggiertem vii°7) zeigen, dass Riemanns Augenmerk vor allem auf den harmonischen Beziehungen und weniger auf der Stimmführung liegt – eine Beobachtung, die auch auf den Theoretiker Riemann zutrifft, bildet doch die Harmonik einen deutlichen Schwerpunkt in seinen Schriften. So widersetzt sich etwa die Trugschlussbildung von H-Dur nach C-Dur (T. 7–8) den allgemein anerkannten Verboten paralleler Quinten und Oktaven (Beispiel 1, Klavierpart).[41] Auch bei der Wiederholung derselben Akkordfolge zwei Takte später (T. 9–10) verläuft die Stimmführung unelegant, zum einen durch den Registerwechsel in der linken Hand des Klavierparts, zum anderen durch den abspringenden Leitton dis sowie die nicht vorschriftsgemäß aufgelöste Septime a (Beispiel 1).
Beispiel 1: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 4–12
Eigenartig und zugleich aufschlussreich ist auch die folgende Passage (Beispiel 2):
Beispiel 2a: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 15–21
Beispiel 2b: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 15–21, harmonische Reduktion und Funktionsanalyse
Der Hauptsatz ist periodisch geformt. Beispiel 1 zeigt den in e-Moll stehenden Vordersatz (mit unvollkommenem Ganzschluss), die in Beispiel 2a angeführten Takte bilden die harmonische Ausweichung in die Tonikaparallele im Nachsatz. Die modulierende Anlage des Themas bringt beim Hören eine Unsicherheit über das tonale Ziel mit sich. Im Nachsatz erschweren insbesondere die 6-5-Vorhalte die Bestimmung des harmonischen Grundtons (T. 17.3 und 18.1), wobei die in Frage kommenden Akkorde jeweils im Parallel-Verhältnis zueinander stehen und dadurch dieselbe tonale Funktion vertreten können. Dies ist besonders beim Übergang der Takte 17–18 nachzuvollziehen, wo beide Deutungsmöglichkeiten zugleich fortgeführt werden (Beispiel 2b): Interpretiert man zunächst den dritten Schlag von Takt 17 als h-Moll-Sextakkord, also als Moll-Dominante mit Terz im Bass, findet man auf dem ersten Schlag von Takt 18 die entsprechende Auflösung in einen e-Moll-Quartsextklang. Im größeren Kontext ist es hingegen wahrscheinlicher, die zweite Takthälfte von Takt 17 als D-Dur-Dreiklang mit 6-5-Vorhalt zu hören, zumal sich auf dem letzten Schlag eine dominantische Septime in den Klang mischt. Dieser Dominantklang legt zu Beginn von Takt 18 eine Interpretation des Klangs als G-Dur-Sextakkord mit 6-5-Vorhalt nahe. Trotz dieser Mehrdeutigkeiten folgt die Passage funktionalen Kadenz-Strukturen nach dem Muster ›Tonika–Subdominante–Dominante–Tonika‹ und dessen Varianten (Beispiel 2b). Auffallend ist dabei die Beibehaltung eben dieses Kadenzmodells in Moll (T. 16.3– T. 18.2), also in der ›dialektisch sinnvollen‹ Anordnung der Funktionen. Dies ist besonders an der Gegenüberstellung mit der sich direkt anschließenden Wiederholung der Akkorde ersichtlich, die auf denselben Grundtönen (e-a-d-h/g) beruhen, nun aber alle in Dur-Qualität erscheinen (T. 18.3–T. 20.2). In letztgenannter Akkordfolge tritt das zugrundeliegende Quintfall-Schema deutlicher hervor, das in den vorangegangenen Takten durch die sequenzierend höhergelegte Oberstimme (T. 17–18) und die durch sie bestimmte metrische Gliederung verschleiert wurde. Zudem führt die Quintfallsequenz mit Durdreiklängen (die also alle als starke Dominant-Funktionen in Frage kommen) zu einer funktionalen Ambiguität. So schwankt das Verständnis des E-Dur-Akkords in Takt 18 zwischen Deutungen als Tonika- oder Dominant-Funktion. Vom G-Dur-Akkord kommend bietet sich zunächst eine Interpretation als aufgehellte Dur-Tonika an, doch durch den darauffolgenden Quintfall erscheint der Akkord rückblickend dominantisch. Dieser Eindruck verfestigt sich bei der Fortschreitung zum D-Dur-Klang in Takt 19, der nun seinerseits rückblickend als Subdominante zum A-Dur-Klang erscheint, später jedoch zur Dominante des folgenden G-Dur-Klangs wird. Eine solche Analyse – sie ähnelt Riemanns eigenen Betrachtungen von Beethovens Klaviersonaten[42] – zeigt die temporal abhängige und relative Bedeutung funktionaler Zuschreibungen, die sich von der ›absoluten‹ Bezeichnung einzelner Akkorde in der Stufentheorie klar unterscheidet.
Terzbeziehungen, also jenes tonale Vokabular, das insbesondere Gegenstand des Handbuchs (und später der Funktionstheorie) ist, bestimmen die Passage der Takte 24–32, wo Riemann die ›Mehrdeutigkeit‹ der Terz h-dis zur Modulation von H-Dur nach gis-Moll nutzt (Beispiel 3, wo zunächst fis, dann dis als Basston wirkt).
Beispiel 3: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 26–32
In anderen Fällen kommen Terzverbindungen weniger überzeugend zum Einsatz, wie etwa in jenem von Beispiel 4:
Beispiel 4: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 32–42
Riemann nutzt hier eine Kette fallender kleiner Terzen, um die Ausgangstonart gis-Moll in Frage zu stellen und eine Modulation in Gang zu setzen. Diese Technik manifestiert sich deutlich mit Takt 33.3, wo eis im Bass der Diatonie der Streichinstrumente entgegengesetzt wird. Die nun sich abzeichnende Regelmäßigkeit der Bassbewegung wird mit dem Erreichen von ais in Takt 34.3 unterbrochen, das auch eine Änderung der Figuration und Bewegungsrichtung mit sich bringt. Man könnte ais als funktionellen Grundton des verminderten Septakkords verstehen, der sich mit Takt 35 nach dis-Moll auflöst. Die weitere Fortschreitung via F-Dur nach B-Dur lässt hingegen B-Dur als (vorläufiges) tonales Ziel erscheinen, dem rückblickend auch der Schritt Ais-Dur–dis-Moll kadenziell zugeordnet werden kann. Mit der Wiederaufnahme der Figuration von Takt 32.3 in Takt 36.3 stellt Riemann eine Sequenz der gesamten Taktgruppe in Aussicht, doch wird diese Erwartung bereits in der ersten Fortschreitung durch die große Terz ais-fis enttäuscht. Diese Unregelmäßigkeit setzt sich im drauffolgenden Sekundschritt fis-e fort, der die Wendung zum Dominantseptakkord auf fis verstärkt (wenn auch durch die etwas schroffe Aufeinanderfolge eis-e in T. 37.2–3).
Die Experimentierfreude des Komponisten – bzw. Theoretikers? – ist an dieser Stelle nicht zu überhören. Lassen sich auch alle Fortschreitungen durch die im Handbuch systematisierten Operationen erklären, so wirken die temporal dicht gedrängten und zugleich weitläufigen Modulationen dennoch wie ein Erproben der Grenzen ihrer Anwendbarkeit. Damit setzt die Passage ein Exempel für die von Riemann selbst angedeutete mögliche Diskrepanz zwischen theoretischen Postulaten und deren Wert in der praktischen Umsetzung. So merkt er etwa in seiner Vereinfachten Harmonielehre an:
Kadenzen sind ja zwar keine Musikstücke und insofern darf man die Wichtigkeit dieser Erörterungen nicht überschätzen; andererseits aber wäre es doch auch ganz verkehrt, sie zu unterschätzen, denn sie sind unzweifelhaft ebenso sehr Typen der Harmonieentwicklung, wie die Skalen Typen der Melodiebewegung sind.[43]
Der Kontext dieser Aussage ist interessanterweise die Betrachtung von verschiedenen Kadenzformen in Dur und Moll mit Dominanten in beiden Tongeschlechtern. Dabei räumt Riemann auch ein, bekanntlich sei »diese Form der Kadenz für Moll °T–°S–D+–°T allgemein anerkannt«, setzt dem jedoch sogleich entgegen, es liege »aber keinerlei Grund vor, dass wir eine der beiden leitereigenen Dominanten zu Gunsten der leiterfremden, entlehnten fallen lassen«. Er schlägt daher als Kadenzform für Moll vor: °T–°D–°S–D+–°T.[44] Solcher theoretischer Ausführungen zum Trotz und entgegen dem sich an anderen Stellen manifestierenden Mut zum Experiment findet sich keine dieser Mollkadenzen im Klaviertrio, ebenso wenig wie die ›dualistische‹ Mollkadenz. Stattdessen folgen die wenigen Passagen, in denen Riemann in Moll abkadenziert, dem Muster °T–°S–D–°T, also der »dialektisch sinnvollen« Anordnung der tonalen Funktionen (Beispiel 5).
Beispiel 5: Hugo Riemann, Klaviertrio op. 47, 3. Satz, T. 170–177
Diese Beobachtung kann uns als weiterer Beleg dienen, dass Riemann die ›dualistische‹ Mollkadenz in erster Linie als theoretisch notwendiges Konstrukt verstand. Wenn Riemann sich auch auf Grund seiner dualistischen Prämissen und allumfassenden Ambitionen nicht in der Lage sah, ihren geringen praktischen Wert offen einzugestehen, so könnte man ein solches Zugeständnis doch aus dem Fehlen der ›dualistischen‹ Mollkadenz in seinen Kompositionen ablesen. Trennen wir uns vom Konzept der ›dualistischen‹ Kadenz, so können wir das normative Kadenzmodell mit der dialektischen Deutung in Verbindung setzen, ein Schritt, der auch im Lichte der folgenden Überlegungen zu den psychologischen Implikationen beider Phänomene sinnvoll erscheint.
Tonale Funktionen, musikalische Logik und die Psychologie des aktiven Hörens
In einem Beitrag von 2001 befasst sich Adolf Nowak mit den verschiedenen Bedeutungsebenen, die der Begriff ›musikalische Logik‹ in Riemanns Theorien annimmt. Er hebt die ›Logik der Kadenz‹, die ›innere Logik eines Musikwerkes‹ und die ›Logik in der Lehre von den Tonvorstellungen‹ hervor.[45] Letztere steht im Mittelpunkt von Trevor Pearces Artikel über die starke psychologische Prägung vieler Riemannscher Texte.[46] Pearce analysiert Riemanns Anschauungen über den aktiven Prozess des Musikhörens, der entscheidend von den Vorgängen des kritisch beurteilenden Gehörs[47] bestimmt ist. Dabei werden Tonvorstellungen in Bezug auf die möglichen Klänge, die sie formen und repräsentieren können, gedeutet und die daraus resultierenden Optionen im Vergleich mit der musikalischen Realität ausgewertet.[48] Die so gewonnen Erkenntnisse bilden sodann die Grundlage für die darauffolgenden harmonischen Erwartungen. Dadurch ergibt sich ein ständig fluktuierender Prozess, der synchron mit der musikalisch erlebten Zeit abläuft. Als Orientierungsreferenz in diesem Prozess wirkt ›musikalische Logik‹, die für die Interpretation von Tonvorstellungen unerlässlich ist und die tonalen Erwartungshaltungen lenkt. Die ›Logik‹ fungiert damit wieder – wie eingangs dargestellt – als temporales Ordnungsprinzip.
Ein solches dialektisches Ordnungsprinzip liegt nun ebenso dem Zusammenhang der tonalen Funktionen zu Grunde.[49] Brian Hyer bezeichnet die Funktionen als »the veritable subject matter of musical cognition, the forms within which musical thinking occurs.«[50] Die synthetisierenden Prozesse im Hörvorgang drücken sich also in der Form der tonalen Funktionen aus, die Funktionen dienen als Kommunikationsmittel der entsprechenden Erkenntnisse.
Allerdings kommen hier zwei Aspekte komplizierend hinzu; der erste führt auf das eingangs geschilderte Problem zurück, die dialektischen Momente präzise in der kadenziellen Abfolge zu verorten. Dieselbe Problematik ergibt sich nun auch in Bezug auf tonale Funktionen. Alexander Rehdings Beobachtung, dass dialektische Zuschreibungen nur im Verhältnis zueinander aussagekräftig sind[51], lässt sich ebenso auf Riemanns Funktionen übertragen. In dieser Hinsicht sind die Begriffe der ›Bedeutung‹ und ›Funktion‹ bei Riemann synonym zu verstehen, eine Einsicht, die auch Brian Hyer betont.[52] Hyer veranschaulicht des Weiteren, dass tonale Funktionen nicht eine materielle Eigenschaft von Akkorden ausdrücken, sondern vielmehr deren Einstehen für ein immaterielles ›Konzept‹.[53] Die Zuordnung erfolgt dabei durch eine Abgrenzung gegen gleichwertige ›Konzepte‹, betrifft also im vorliegenden Fall die Entscheidung zwischen den Konzepten ›Tonika‹, ›Subdominante‹ und ›Dominante‹, sowie deren Vertretungen. Diese immateriellen Konzepte stellen für Hyer, in Berufung auf Gottlob Frege, ›Begriffe erster Stufe‹ dar[54], die von einem ›Begriff zweiter Stufe‹ gelenkt werden – dem der ›musikalischen Logik‹. Auf dieser Ebene werden die Konzepte der tonalen Funktionen zueinander in Beziehung gesetzt, so wie es bei der Reihung der dialektischen Momente der Fall ist. Erst dieses hierarchische Ordnungsprinzip ermöglicht die psychologischen Vorgänge und Erwartungshaltungen des aktiven Hörers.[55]
Eine weitere kritische Überlegung in diesem Zusammenhang bezieht sich ebenfalls auf den Parameter der Zeit in der musikalischen Analyse. Wie oben erläutert, versteht Riemann den Prozess des Hörens und Analysierens als kontinuierlichen Ablauf. Solch ein Kontinuum lässt sich allerdings in einer visualisierten Form der Analyse nur schwer wiedergeben. Diese kann vielmehr nur eine rückwirkende, synthetisierende und der temporalen Wirklichkeit enthobene Sicht der simultanen Prozesse darstellen. Der Widerstreit zwischen retrospektiv abstrahierender (›globaler‹) und synchroner (›lokaler‹) Analyse ist auch in Riemanns Schriften erkennbar: Während die im Handbuch behandelten tonalen Beziehungen nur eine sehr enge Perspektive auf Akkordfortschreitungen geben können, erwächst mit der späteren Funktionstheorie der Anspruch, auch größere Zusammenhänge zu deuten. Im ersten Fall umgeht Riemann weitgehend das Problem, seine methodologischen Vorstellungen praktisch in der Analyse zu erproben. So sind die tonalen Beziehungen im Handbuch in den ohnehin spärlichen Notenbeispielen nicht eingetragen; konsequenterweise müssten sie wohl zwischen den Akkorden stehen, um die Prozesshaftigkeit entsprechend darzustellen.
Ein ähnliches Problem ergibt sich im Umgang mit der Funktionstheorie, da, wie oben ausgeführt, Funktionszuschreibungen nicht wie in der Stufentheorie als ›absolutes‹ Bezeichnungssystem einzelner Akkorde aufgefasst werden dürfen, sondern vielmehr als Symbole jener Evaluierungs- und Re-Evaluierungsprozesse, die sich im Hörvorgang in der Form eines zeitlichen Kontinuums abspielen. Dadurch ergibt sich ein relatives Bezeichnungssystem, das aber aus verschiedenen zeitlichen Perspektiven angewandt werden kann – und das damit sowohl eine synchrone als auch eine retrospektiv synthetisierende Sicht wiedergeben kann. Diese Vielschichtigkeit in der Anwendbarkeit findet sich ebenfalls in Riemanns Schriften, wenn auch nicht immer explizit dargelegt. Zunächst erweckt die erstmalige Präsentation der Funktionstheorie in der Harmonielehre von 1893 den Anschein eines ›global‹ abstrahierenden Systems[56], das aber Freiraum zur Interpretation einzelner, verschiedenartig deutbarer Akkorde in ihrem spezifischen Kontext lässt (was vor allem auf ›Nebenklänge‹ zutrifft, die unterschiedliche Hauptfunktionen vertreten können; vgl. oben). Die späteren, psychologisch orientierten, theoretischen Schriften heben hingegen vor allem die starke temporale Abhängigkeit von musikalischer Analyse hervor.
Riemann stellt sich dieser Problematik schließlich in seinen in den Jahren 1918–20 publizierten Analysen von Beethovens Klaviersonaten.[57] Trevor Pearce weist in diesem Zusammenhang besonders auf Riemanns Analyse der Waldstein-Sonate hin[58], zu der Riemann zwei unterschiedliche harmonische Deutungen der eröffnenden Periode des zweiten Satzes präsentiert, wobei die erste – Pearce bezeichnet sie als »local« – eine beinahe synchrone Interpretation wiedergibt, die die Passage in kleine kadenzielle Abschnitte zergliedert. Die ›globale‹ Perspektive hingegen, die Riemann vom ganzen Satz gibt, synthetisiert diese Momentaneindrücke unter der rückwirkenden Autorität einer einzigen übergeordneten Tonart. Beispiel 6 veranschaulicht exemplarisch, wie ein einzelner Akkord in diesem Prozess verschiedene tonale Funktionen annehmen kann:
Beispiel 6: ›Lokale‹ und ›globale‹ analytische Deutungen in Riemanns Analyse von Beethovens Waldstein-Sonate, 2. Satz[59]
Eine solche Mehrschichtigkeit in der harmonischen Analyse schafft meines Erachtens Möglichkeiten, die der Stufentheorie fremd sind. Dabei macht der Deutungsgehalt von Riemanns dialektischem Kadenzmodell einen wesentlichen Teil jener ›Logik‹ aus, wie sie der Hierarchie tonaler Ordnungen und deren Wahrnehmung beim Hören zu Grunde liegt. Ein solches Verständnis hilft auch bei der Beantwortung der von Brian Hyer behandelten Frage »What Is a Function?«.[60] Um allerdings das Potenzial dieses Ansatzes voll ausschöpfen zu können, ist es notwendig, sich ausführlich mit den oben erwähnten Schwierigkeiten der musikalischen Temporalität und ihrer Übertragung in eine visualisierte Analyse auseinanderzusetzen. Darüber hinaus gibt dies Anlass, die Prämissen und Implikationen der Vermischung von Stufen- und Funktionstheorie, wie sie heutzutage unter anderem in führenden Nordamerikanischen Lehrbüchern üblich gewordenen ist[61], kritisch zu hinterfragen.
Anmerkungen
De la Motte-Haber 2005, 203. | |
Ich möchte an dieser Stelle meinen Professoren Suzannah Clark und Alexander Rehding (Harvard University) sowie Robert Hasegawa (Eastman School of Music/McGill University) für ihren inspirierenden Unterricht und ihre wertvollen Kommentare zur Revision dieses Artikels herzlich danken. Mein besonderer Dank gilt Dietmar Friesenegger für sein gewissenhaftes Lektorat und unsere ausgiebigen Diskussionen, von denen meine Arbeit in vielfacher Weise profitiert hat. | |
Riemann 1872 (unter dem Pseudonym Hugibert Ries). | |
Hauptmann 1873. Für ausführliche Studien zu Hauptmanns Theorie und deren Verhältnis zu dialektischen Ansätzen in der Philosophie vgl. Rummenhöller 1963, Jorgenson 1986 und Moßburger 2002. | |
Hauptmanns thetische Momente ergeben sich aus den drei »direct verständlichen Intervallen« Oktav, Quint und Terz (1873, 19), aus denen er die Begriffe der ›Oktaveinheit‹, ›Quintentzweiung‹ und ›Terzeinigung‹ formt. Diese Momente werden auf allen Ableitungsebenen mit »I«, »II« und »III« bezeichnet. Helga de la Motte-Haber betonte die Bedeutung von musikalischer ›Logik‹ als Ordnungsprinzip, vor allem in temporaler Hinsicht (2005, 218). | |
Erst in seinen späteren Theorien versteht Riemann den kadenzierenden Quartsextakkord als Teil der Dominantfunktion und drückt dies durch die Schreibweise V6/4 aus (Riemann 1887b; vgl. Rehding 2003, 69). | |
Riemann 1872, 280, im Original gesperrt gesetzt. Aus dem Zitat geht die Ausführung der ›großen Cadenz‹ mit Quartsextakkord an dritter Stelle hervor, eine Beobachtung, die im folgenden Zitat bestätigt wird. Eine Umsetzung der Kadenz in Notenschrift ist auffälligerweise nicht Teil von Riemanns Artikel, was einen Vergleichspunkt zu Hauptmanns spekulativem Ansatz darstellt. Sowohl Rehding (2003, 70) also auch Hyer (2011, 100) präsentieren hingegen in Notation übertragene Darstellungen von Riemanns dialektischem Kadenzmodell. | |
»Die Übergangsmomente nennen wir Antithese und Synthese.« (Ebd.) Kevin Mooney weist darauf hin, dass das dialektische Modell und die gebrauchten Termini eher auf Fichte als – wie oft angenommen – auf Hegel zurückgehen, eine Provenienz, derer sich Riemann bewusst war (2000, 97, Anm. 7). | |
Ebd. Es ist wichtig festzuhalten, dass Riemann in diesen frühen Schriften die Begriffe ›Tonika‹, ›Subdominante‹ und ›Dominante‹ als Denotation von Akkorden auf den jeweiligen Tonstufen verwendet und noch nicht als Bezeichnung tonaler Funktionen. | |
Riemanns Dissertation geht aus dem Artikel von 1872 hervor und wurde 1874 zweifach publiziert (1874a und 1874b). | |
Riemann 1874, 53, meine Hervorhebung; vgl. Mooney 2000, 86. | |
Riemann 1872, 280. | |
»IV itself is meaningless, it is only in its relation to I that it functions as antithesis.« (Rehding 2003, 71) | |
Damit unterscheidet sich Riemanns Theorie zum Beispiel von Schenkers späteren Theorien, in denen eine hierarchische Gleichstellung der Subdominante nicht möglich ist. | |
Rehding beschäftigt sich ausführlich mit der Frage, wie eng die Konzepte ›Logik‹ und ›Natur‹ (sowie ›Geschichte‹) in Riemanns Theorien miteinander verwoben sind (2003, bes. 88–112). | |
Riemann 1872, 280. | |
Ich beziehe mich im Folgenden auf das Konzept einer Gleichwertigkeit zwischen Dur und Moll. Aspekte dieser Anschauung durchziehen das Gesamtwerk Hugo Riemanns, wenn auch aus immer wechselnden Perspektiven und unter Bezugnahme unterschiedlicher Strategien zur Beweisführung. Zusammenfassungen dieser Entwicklung finden sich in Riemann 1905 und Rehding 2003, 15–35. | |
Riemann 1872 beschränkt sich auf die Durkadenz und lässt damit die Problematik einer Herleitung der Mollkadenz noch außer Acht. | |
Das Handbuch ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung der Abhandlung »Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre« von 1880. | |
›Schritte‹ bezeichnen Transformationen im selben Tongeschlecht, wohingegen ›Wechsel‹ eine Veränderung zwischen einem Dur- und einem Moll-Akkord einbeziehen. Durch den umfassenden Anspruch seiner Theorie lässt sich die Gesamtzahl von Riemanns Transformationen durch die mathematische Gruppentheorie erfassen, was den Hauptbezugspunkt zur in den letzten Jahrzehnten entwickelten ›Neo-Riemannian Theory‹ darstellt. | |
Dualismus manifestiert sich weiters in Riemanns Herleitung und Benennung des Molldreiklangs, der in Symmetrie zum Durakkord den Grundton zuoberst hat. Ein a-Moll-Dreiklang wird dementsprechend mit »°e« bezeichnet. | |
Im Handbuch beschränkt sich Riemanns Vokabular der ›Bedeutungen‹ noch auf Begriffe wie »Gegensatz« (Riemann 1887a, 32, §8), »Übergang« (ebd., 52, §17), »Rückkehr« (ebd., 32, §8) und »Schlussbedeutung« (ebd.). In der Systematischen Modulationslehre aus demselben Jahr sind solche Metaphern mit dialektischen Konnotationen verbunden; so benennt Riemann dort »die vier Hauptstationen der tonalen Kadenzbildung« als: »1. Tonika (erste Aufstellung), 2. Unterdominante (Konflikt), 3. Oberdominante (Lösung des Konflikts), 4. Tonika (Bestätigung, Schluss)« (Riemann 1887b, 16). | |
Siehe auch de la Motte-Haber 2005, 209–212. In letzter Instanz gilt nur der Tonikadreiklang als reine Konsonanz, da strenggenommen selbst die anderen beiden Hauptakkorde IV und V in einem Spannungsverhältnis zur Tonika stehen: »Eigentlich ist nur der tonische Akkord selbst absolute Konsonanz.« (1887a, 64, im Original gesperrt gesetzt) | |
Riemann 1893. | |
Wie Helga de la Motte-Haber feststellt, verwendet Riemann die »Chiffren« der drei ›Hauptfunktionen‹ (T, D, und S) erstmals in Riemann 1891 (2005, 203f., Anm. 4). | |
Abgesehen von den Hauptfunktionen umfasst die Theorie auch »Parallel«- und »Leittonwechselklänge«, die die Hauptfunktionen vertreten, oder den Übergang zwischen ihnen ausschmücken können. Im Bezug auf die Tonika werden Parallelklänge als »Tp« oder »°Tp« notiert, Leittonwechselklänge als »+TII<« oder »°T2>«. Wie bereits in Riemann 1887a kann ein einzelner Akkord durch diese Stellvertretungsklänge verschiedenen Hauptfunktionen zugeordnet werden. | |
In Riemanns Notationssystem sind Mollakkorde durch ein »°« gekennzeichnet, während Durakkorde entweder nur durch das Funktionssymbol oder durch ein hinzugefügtes »+« dargestellt sind. | |
Vgl. Rehding 2003, bes. 79; Dahlhaus 1966, bes. 96f. und 100f. | |
Grabner 1923, bes. V, 5, 9. | |
Vgl. Dahlhaus 1966. Rehdings bündige Zusammenfassung von Dahlhaus’ Argumentation lautet: »Cadential order and dualism are irreconcilably opposed.« (2003, 78) | |
Vgl. Hyer 2011, 96f. Riemann umgeht diesen Schritt, indem er zwar in Moll und Dur die Transformationen in entgegengesetzte Richtungen anwendet, ihnen dabei aber keine unterschiedlichen Funktionen zuordnet. Das lässt darauf schließen, dass für ihn jede Subdominante a priori auf der IV. Stufe erscheint. | |
Hyers Fazit lautet »function and dualism remain separate theories« und »the notion of function cannot be dual.« (Ebd., 96f.) | |
Vgl. Rehding 2003, Kap. 1, insbes. 15–35. | |
Vgl. Georg Capellen (1901) und Ary Belinfante (1904). Eine Übersicht gibt Bent 2011. | |
Riemann 1905. | |
Vgl. den Titel von Riemann 1875. | |
Vgl. Arntz 1999, bes. 51–66 und 183–207. Für einen anekdotischen Bericht über Riemanns Selbsteinschätzung seiner kompositorischen Fähigkeiten vgl. Seidel 2001, 150f. | |
Mennicke 1909, XXXVIf. | |
Eine Einspielung liegt leider nicht vor. | |
Ein solches Bild entspricht wohl auch der Selbstwahrnehmung Riemanns in der Rolle des von der Natur und ihren Tonalitätsgesetzen abhängigen Künstlers. Vgl. Rehding 2011, 112. | |
Solche Verstöße stehen auch im Widerspruch zu den ausführlichen Anweisungen im Handbuch, wo Riemann seitenweise Vorschläge zur Vermeidung solcher Parallelen präsentiert. So warnt er etwa im Zusammenhang des ›Ganztonschritts‹ vor »diesen schlimmsten aller Arten von Quintparallelen«. (1887a, 37) Es sollte aber erwähnt werden, dass Riemann nur kurz darauf diese Strenge relativiert und einräumt: »Quintparallelen wie die des letzten Beispiels im Handbuch sind zwar nicht zu rechtfertigen, aber doch gelegentlich zu entschuldigen, wenn es darauf ankommt, den auffälligen Melodieschritt für die Oberstimme zu gewinnen.« (Ebd., 38) Ob solch eine Entschuldigung im vorliegenden Fall passend erscheint, sei dahingestellt. | |
Siehe Riemann 1918–20 sowie Pearce 2008. Zudem beschreibt Riemann selbst den »Reiz«, der durch die mögliche »Verwechslung der Rollen« im retrograden Quintschritt zweier Dur-Akkorde entsteht, also die Deutungsmöglichkeit eines Quintfalls als T–S oder D–T (Riemann 1887b, 15). | |
Riemann 1893, 49f. | |
Ebd. | |
Nowak 2001, zusammengefasst in Pearce 2008, 91. | |
Riemanns zunehmendes Interesse an psychologischen Überlegungen wurde von zahlreichen Wissenschaftlern beobachtet (vgl. Hyer 2011, 120; de la Motte-Haber 2005, 220) und manifestiert sich in seinen späteren Schriften (vgl. 1914–15). | |
Hier drängt sich ein Vergleich mit den psycho-akustisch inspirierten Theorien von Gottfried Weber auf, die ebenfalls die Vorgänge des – geradezu personifizierten – ›Gehörs‹ beschreiben. Besonders deutlich lassen sich Webers Vorstellungen in seiner Analyse der einleitenden Takte von Mozarts Dissonanzen-Quartett KV 465 nachvollziehen (1830–32). | |
Das Konzept der Klangvorstellung impliziert die potenzielle Mehrdeutigkeit eines einzelnen Tons (bzw. Intervalls), der (bzw. das) Teil von verschiedenen Klängen sein kann. Es geht auf die Theorien von Georg Joseph ›Abbé‹ Vogler und Gottfried Weber zurück. In Riemanns Theorie bildet der Dreiklang die kleinste harmonische Einheit (vgl. 1893, 7), sodass selbst Einzeltöne stets einen Klang vertreten. | |
»For Riemann, the tonal functions of chords are directly related to the activity of the logical functions of the human mind.« (Pearce 2008, 99) | |
Hyer 2011, 130. | |
»IV itself is meaningless, it is only in its relation to I that it functions as antithesis.« (Rehding 2003, 71) | |
Hyer hebt hervor, dass auch Riemann die beiden Begriffe als Synonyme verwendet (2011, bes. 92–111), wie etwa in der Einleitung zur Vereinfachten Harmonielehre, wo Riemann schreibt: »Es giebt nur dreierlei tonale Funktionen der Harmonie (Bedeutungen innerhalb der Tonart), nämlich die der Tonika, Dominante und Subdominante.« (1893, 9) | |
Hyer 2011, 101. Vgl auch Rehdings Warnung, das Konzept der Funktion zu eng mit einem konkreten Klang zu assoziieren: »The problem can … be located in his associating too closely the notion of function with the chord.« (2003, 78) Dahlhaus formuliert den Konflikt als Gegenüberstellung von »Erscheinung und Bedeutung« sowie »Präsentem und Repräsentiertem« (1966, 93). | |
Hyer 2011, 120. Hyer bezieht sich nicht nur im Titel, sondern auch in der inhaltlichen Organisation seines Artikels (»What Is a Function?«) auf Frege 1904. | |
Diese Erkenntnis deckt sich auch mit Rehdings Schlussfolgerung in Bezug auf Riemanns Spätwerk: »The notion of function (certainly in this late conception) was not strictly dependent on the sounded chord but rather on an expectation-fulfillment pattern.« (2003, 77) | |
So sind in den Notenbeispielen, wenn sie überhaupt beschriftet sind, Funktionsbezeichnungen direkt unter einzelnen Akkorden vermerkt, was auf den ersten Blick einen Vergleich mit stufentheoretischer Beschriftung nahe legt. | |
Riemann 1918–20. | |
Vgl. Pearce 2008, 103–108. | |
Pearce 2008, 105–6. Vgl. Riemann 1918–20, Bd. 3, 30ff. Die erste der beiden Graphiken (von Pearce mit »Figure 1« beschriftet) enthält auch im Riemannschen Original einen Druckfehler. Der d-Moll-Klang in Takt 7 müsste als ›Tp‹ statt als ›T‹ von F-Dur bezeichnet sein. Riemann selbst beschreibt die Stelle als »Trugschluß« (1918–20, Bd. 3, 31) und verwendet in der ›globalen‹ Analyse das korrekte Funktionssymbol. | |
Hyer 2011. | |
Vgl. z.B. Laitz 2003, wo ein von Schenkerschen Aspekten durchzogenes stufentheoretisches Bezeichnungssystem mit funktionstheoretischen Konnotationen vermischt wird. | |
In Mennicke (1909, XXXVII) wird die Tonart irrtümlich mit Es-Dur angegeben. |
Noten
Riemann, Hugo (1888), Trio (E-Dur[62]) für Pianoforte, Violine und Violoncell, op. 47. Hamburg: Rahter und St. Petersburg: Büttner. http://imslp.org/wiki/Piano_Trio,_Op.47_%28Riemann,_Hugo%29
Literatur
Arntz, Michael (1999), Hugo Riemann (1894–1919). Leben, Werk und Wirkung, Köln: Concerto.
Belinfante, Ari (1904), »De leer der tonale functien in conflict met die der polaire tegenstelling«, Orgaan van de Vereeniging van Muziek-Onderwijzers en – Onderwijzeressen 4/9, 1–2.
Bent, Ian (2011), »The Problem of Harmonic Dualism. A Translation and Commentary«, in: The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Theories, hg. von Edward Gollin und Alexander Rehding, 167–193.
Capellen, Georg (1901), »Die Unmöglichkeit und Überflüssigkeit der dualistischen Molltheorie Riemann’s«, NZfM 97, 529–531, 541–543, 553–555, 569–572, 585–587, 601–603, 617–619.
Dahlhaus, Carl (1966), »Über den Begriff der tonalen Funktion«, in: Beiträge zur Musiktheorie des 19. Jahrhunderts (= Studien zur Musik des 19. Jahrhunderts 4), hg. von Martin Vogel, Regensburg: Bosse, 93–102.
De la Motte-Haber, Helga (2005), »Musikalische Logik. Über das System von Hugo Riemann«, in: Musiktheorie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 2), hg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch, Laaber: Laaber, 203–223.
Frege, Gottlob (1904), »Was ist eine Funktion«, in: Festschrift. Ludwig Boltzmann gewidmet zum 60. Geburtstage 20. Februar 1904, hg. von Stefan Meyer, Leipzig: Barth, 656–666.
Grabner, Hermann (1923), Die Funktionstheorie Hugo Riemanns und ihre Bedeutung für die praktische Analyse, München: Otto Halbreiter.
Hauptmann, Moritz (1853), Die Natur der Harmonik und Metrik, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Hyer, Brian (2011), »What Is a Function?«, in: The Oxford Handbook of Neo-Riemannian Theories, hg. von Edward Gollin und Alexander Rehding, 92–139.
Jorgenson, Dale A. (1986), Moritz Hauptmann of Leipzig (= Studies in the history and interpretation of music 2), Lewiston: Mellen.
Laitz, Steven (2003), The Complete Musician. An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening, New York: Oxford University Press.
Mennicke, Carl (Hg.) (1909), Riemann-Festschrift. Gesammelte Studien. Hugo Riemann zum sechzigsten Geburtstage überreicht von Freunden und Schülern, Leipzig: Hesse.
Mooney, Kevin (2000), »Hugo Riemann’s Debut as a Music Theorist«, Journal of Music Theory 44/1, 81–99.
Moßburger, Hubert (2002), »Das dialektische Kadenzmodell Moritz Hauptmanns und die Harmonik des neunzehnten Jahrhunderts«, Musik & Ästhetik 6/24, 50–59.
Nowak, Adolf (2001), »Wandlungen des Begriffs ›musikalische Logik‹ bei Hugo Riemann«, in: Hugo Riemann (1849–1919): Musikwissenschaftler mit Universalanspruch, hg. von Tatjana Böhme-Mehner und Klaus Mehner, Köln: Böhlau, 37–48.
Pearce, Trevor (2008), »Tonal Functions and Active Synthesis. Hugo Riemann, German Psychology, and Kantian Epistemology«, Intégral 22, 81–116.
Rathert, Wolfgang (2005), »Riemann, Hugo« in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl., hg. von Ludwig Finscher, Kassel u.a.: Bärenreiter u.a., Personenteil 14, Sp. 64–78.
Rehding, Alexander (2003), Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought, New York: Cambridge University Press.
––– (2011), »Tonality between Rule and Repertory; Or, Riemann’s Functions – Beethoven’s Function«, Music Theory Spectrum 33/2 (Fall 2011), 109–123.
Riemann, Hugo (als Hugibert Ries, 1872), »Musikalische Logik. Ein Beitrag zur Theorie der Musik«, NZfM 68, 28–29, 36–38, 279–282, 287–288, 353–355, 363–364, 373–374.
––– (1874a), Ueber das musikalische Hören, Leipzig: Fr. Andrä’s Nachfolger.
––– (1874b), Musikalische Logik. Hauptzüge der physiologischen und psychologischen Begründung unseres Musiksystems (= Ueber das musikalische Hören, Diss. Göttingen 1874), Leipzig: Kahnt.
––– (1875), Riemann, Hugo »Die objective Existenz der Untertöne in der Schallwelle«, Allgemeine deutsche Musikzeitung 2 (1875), 205f., 213ff.
––– (1877), Musikalische Syntaxis. Grundriß einer harmonischen Satzbildungslehre, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
––– (1887a), Handbuch der Harmonielehre, (2. erw. Aufl. von: Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre, 1880), Leipzig: Breitkopf & Härtel.
––– (1887b), Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre. Hamburg: J.F. Richter.
––– (1891), »Die Neugestaltung der Harmonielehre«, Musikalisches Wochenblatt 22, 513–514; 40, 529–531; 42, 541–543.
––– (1893), Vereinfachte Harmonielehre oder Die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorde, London: Augener.
––– (1905), »Das Problem des harmonischen Dualismus. Ein Beitrag zur Ästhetik der Musik«, NZfM 72, 3–5, 23–26, 43–46, 67–70.
––– (1916), »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹«, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 21/22, Leipzig: Peters, 1–26.
––– (1918–20), L. van Beethovens sämtliche Klaviersonaten. Ästhetische und formal-technische Analyse mit historischen Notizen, 3 Bde., Berlin: Hesse.
Rummenhöller, Peter (1963), Moritz Hauptmann als Theoretiker: eine Studie zum erkenntnistheoretischen Theoriebegriff in der Musik, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Seidel, Wilhelm (2001), »Riemann und Beethoven«, in: Hugo Riemann (1849–1919): Musikwissenschaftler mit Universalanspruch, hg. von Tatjana Böhme-Mehner und Klaus Mehner, Köln: Böhlau, 139–151.
Weber, Gottfried (1830–32), »Über eine besonders merkwürdige Stelle in einem Mozart’schen Violinquartett aus C«, in: Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, 3. überarb. Aufl., Bd. 2, Mainz u.a.: Schott, 196–226.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.