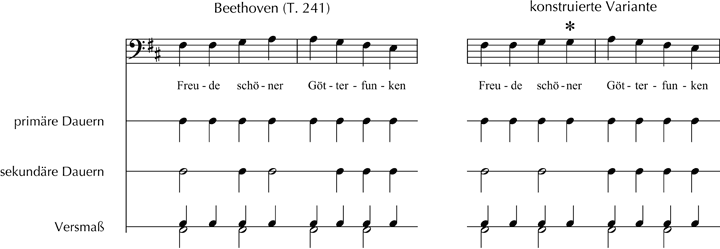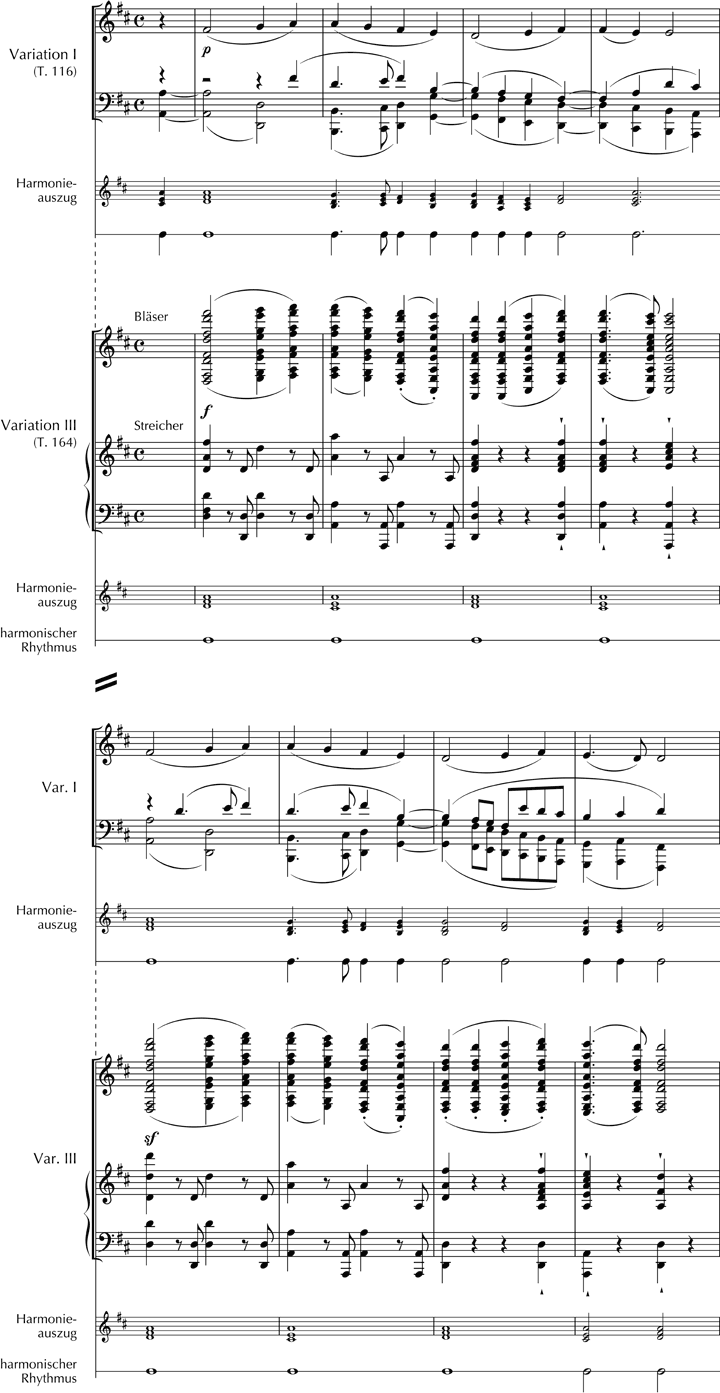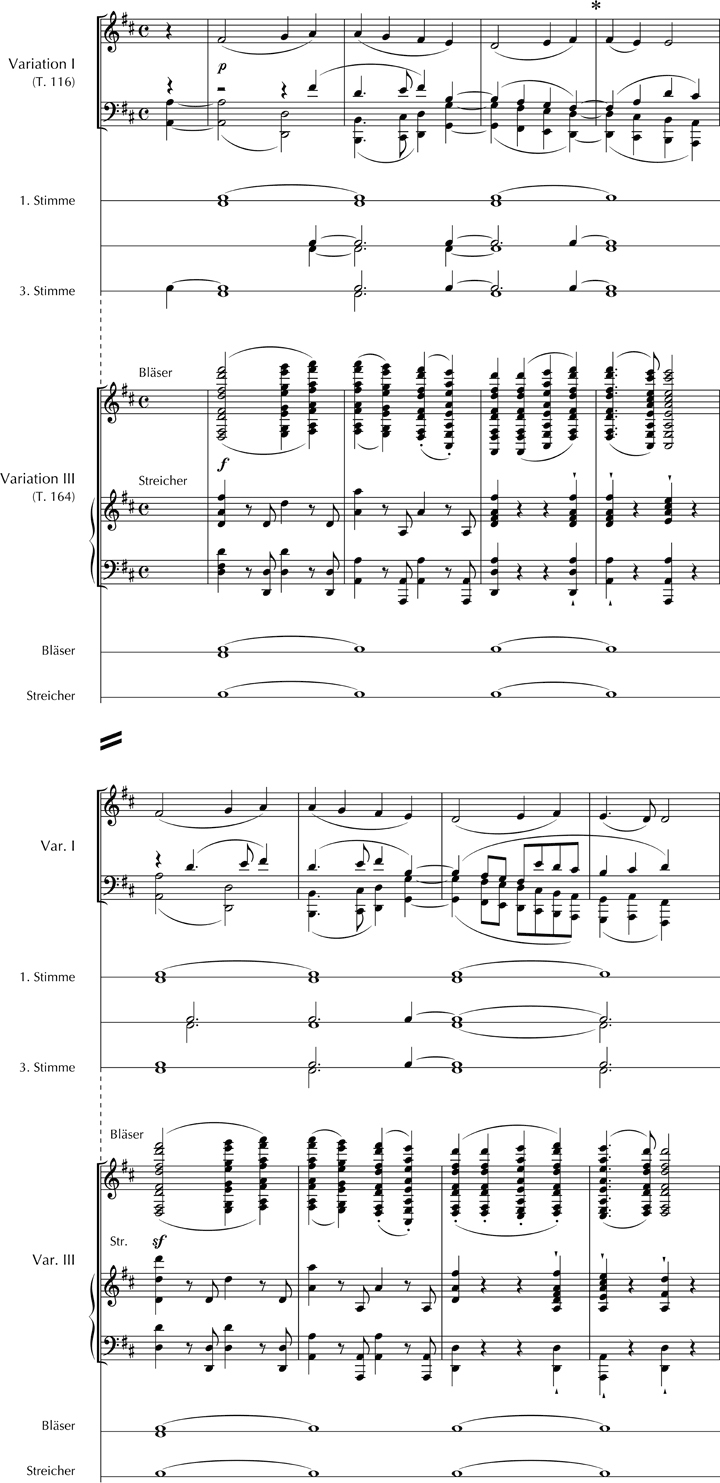Primäre und sekundäre Dauern in der Musik
Über einige Grundzüge der ›Komponententheorie‹
Peter Petersen
Primäre Dauern sind konkrete Noten- und Pausenwerte, sekundäre Dauern entstehen zwischen Tönen/Klängen sowie Klanggestalten und deren Komponenten. Weil sekundäre Dauern nicht unmittelbar aus dem Notentext hervorgehen, wurden sie bisher meistens nicht als Dauern, sondern als Betonungen, emphatische Zusätze o.ä. angesehen. Was früher unter Begriffen wie Akzent, Faktor, Parameter usw. wahrgenommen wurde, verdient es jedoch, als Fundament rhythmischer Gefüge in die Analyse einbezogen zu werden. Denn es geht nicht nur um vereinzelte Betonungen oder Zusätze, sondern vor allem um Zeitintervalle zwischen ihnen. Nicht ›Akzent‹ o.ä., sondern ›Komponente‹ ist der geeignete Terminus, um die vom Komponisten gesteuerten und vom Musiker und Hörer wahrgenommenen ›sekundären Dauern‹, die zu echten Rhythmen (Komponentenrhythmen) führen, aufspüren und in die rhythmische Feinanalyse einbringen zu können.
Ausgehend von Wolf Frobenius’ Bedeutungsgeschichte des Terminus’ »Dauer« im Handwörterbuch der musikalischen Terminologie[1], soll im folgenden nach den Ansatzpunkten für die Benennung bzw. Bemessung von Dauern in Tonsätzen gefragt werden. Bereits im 13. Jahrhundert im Musikschrifttum nachgewiesen, »gehört der Ausdruck [Dauer, duratio] seit dem späteren 16. Jhd. zu den zentralen Termini der Tonbeschreibung«.[2] »Dauer« bedeutete im allgemeinsten Sinn »die zeitliche Erstreckung von Tönen«[3], wobei zwischen der Fortsetzung der Existenz von etwas (»das Dauern«) und dem Maß der zeitlichen Erstreckung (»die Dauer«) unterschieden wurde. Der zu bezeichnende Gegenstand war der Einzelton, der als länger oder kürzer beschrieben wurde. Im 18. Jahrhundert unterschied man darüber hinaus tatsächliche »Klingdauern« und »Geltungsdauern« (auch »gemeinte Dauern«); mit letzteren war der »Abstand eines Toneinsatzes zum folgenden« gemeint.[4] Bis ins 20. Jahrhundert blieb der Terminus »Dauer« auf den Einzelton bezogen; er trat jetzt »an die Stelle der herkömmlichen Rede von Notenwerten« und wurde nun auch im Plural gebraucht.[5]
Musik ist wegen ihres Verlaufscharakters besonders geeignet, ›Dauern‹ im erwähnten zweifachen Sinn (Sukzession bzw. Maß) erfahrbar zu machen. Wer fragt: »Was dauert in der Musik?« bekommt die Antwort: »Alles in der Musik hat Dauer«. Entgegen dieser weiten Bedeutung von ›Dauer‹ wurde der Begriff in der Musiktheorie allerdings von Anfang an auf einen Terminus verengt, der nichts als den Zeitwert von Einzeltönen (›primäre Dauern‹) bezeichnet. Da aber musikalische Klangereignisse – allein weil sie geschehen – im Zeitkontinuum Markierungspunkte hinterlassen, ergeben sich ständig weitere Dauern bzw. Zeitintervalle (›sekundäre Dauern‹). Eine festgehaltene Tonhöhe bei Tonrepetitionen, die Abstände zwischen sfz-Akzenten, die Länge von Phrasierungsbögen, eine prolongierte Harmonie im mehrstimmigen Tonsatz und vieles andere mehr gehören zu solchen nicht unmittelbar notierten sekundären Dauern. Bewusst oder unbewusst fragen wir uns beim Spielen oder Hören von Musik, wieviel Zeit zwischen ›Anfang und Ende‹ oder ›Anfang und Anfang‹ von etwas verstreicht, wie lang also ›etwas dauert‹. Dass in der musikalischen Rhythmik unter diesem ›etwas‹ – der ›Dauer‹ also – immer nur Einzeltöne gemeint sein sollen, ist eine Verengung der Bedeutung des Begriffs, die nicht deshalb einleuchtender wird, weil sie – mit wenigen Ausnahmen[6] – seit hunderten von Jahren besteht.
Frobenius führt aus, dass »die Rede von duratio in bezug auf den Ton« erst mit der Ausbildung einer mensuralen Rhythmuskonzeption und der Entwicklung einer geeigneten Notenschrift aufkam.[7] Konnte man sich vorher über die Zeitwerte von Tönen leicht verständigen – nach der Maßgabe, dass eine Länge zwei Kürzen enthalte –, so bedurfte es bei der Festlegung graphischer Symbole genauer Regelwerke, um deren kontextabhängige Wertigkeiten (›perfekte‹ bzw. ›imperfekte‹ Teilung) als Ausführender erkennen und richtig umsetzen zu können. Die Verschriftlichung von Musik, die fraglos zu den großen Kulturleistungen des Abendlands gehört, hatte freilich außer Vorteilen auch Nachteile. Die Vorteile bestanden u.a. in der Möglichkeit, komplexere Strukturen zu entwickeln, wie etwa den präzisen Wechsel von Kon- und Dissonanzen. Nachteile lagen etwa darin, dass mit der Schriftlichkeit von Musik dem Missverständnis Vorschub geleistet wurde, das, was aufgeschrieben ist, bilde die klingende Musik tatsächlich ab. Stattdessen galt (und gilt weitgehend bis heute), dass die Notenschrift nicht den Zweck hat, Musik abzubilden, sondern dazu da ist, Musik zu ermöglichen, das heißt, sie überhaupt spielen zu können. Die Analytiker neigten allerdings bei der Beschreibung zeitlicher Strukturen in Musikstücken dazu, die Notenzeichen für das Ganze zu nehmen, also die Folge von Notenwerten in einer Stimme als ›den‹ Rhythmus dieser Stimme anzusehen. Dies führte dazu, dass ganze Bereiche rhythmischen Geschehens, namentlich die ›sekundären‹, erst zu erschließenden Dauern neben den ›primären‹, also direkt notierten Dauern vielfach außerhalb des Blickfelds blieben.
Hiermit ist selbstverständlich nicht gesagt, dass in Musiktheorie und Analyse bisher nur von Einzeltönen und deren Dauer gehandelt worden wäre. Unter Begriffen wie Akzent, Faktor, Element, Parameter usw.[8] oder auch Gruppe, Phrase, Hypermeasure usw.[9] wurden und werden markante Phänomene des Tonsatzes aufgenommen und auf ein jeweiliges rhythmisch-metrisches Gefüge bezogen, allerdings meistens nur im Sinne von akzidentellen Beifügungen und Sonderphänomenen. Im Gegensatz dazu ist festzustellen (und nachfolgend zu begründen), dass ›sekundäre Dauern‹ kein Sonderbefund sind, sondern ständig und notwendig vorkommen und entsprechend auch beim Komponieren eine Rolle spielen. Ich nenne solche den Zeitstrom markierenden Phänomene ›Komponenten‹. Dieser Begriff deckt sich weitgehend mit dem seit den 1950er Jahren verbreiteten, aus der Mathematik entlehnten und zunächst auf serielle und elektronische Musik bezogenen und dann immer mehr erweiterten Begriff ›Parameter‹ (Bestimmungsgröße).[10] Joseph Häusler hat folgende bündige Formulierung vorgeschlagen: »Parameter sind alle Komponenten des Klanges oder des Tonsatzes, die sich isoliert betrachten und behandeln lassen.«[11] Es fragt sich allerdings, wozu man den abstrakten und letztlich inadäquaten Begriff ›Parameter‹ noch braucht, wenn auch direkt von »Komponenten des Klanges oder des Tonsatzes« gesprochen werden kann. Komponenten sind konkrete, vom Komponisten gebrauchte Tonsatzbestandteile wie ›Tonhöhe‹, ›Diastematik‹ (Kontur), ›Artikulation‹, ›Dynamik‹, ›Klangfarbe‹, ›Harmonik‹, ›Textur›, ›Phrase‹ und ›Sprache‹.[12] Sie bilden das Material, mit dem komponiert wird. Insbesondere können sie auch ursächlich sein für die Konstituierung von Dauern, die so zu ›Komponentendauern‹ werden. Entsprechend lässt sich von ›Komponentenrhythmen‹ sprechen, wenn mehrere solcher Dauern zu Zeitgestalten geformt werden. Da ein musikalisches Ereignis oder ein musikalischer Verlauf notwendig von mehreren Komponenten bestimmt ist, folgt daraus, dass selbst einstimmigen Tonfolgen mehr als ein Rhythmus inhärent ist. Dieser Gedanke sei an einem einfachen Beispiel erläutert.
* * *
Als Beethoven 1824 das Finale seiner 9. Sinfonie fertig konzipiert hatte, machte er sich Gedanken darüber, wie die ›Freudenmelodie‹ in den Satz eingeführt werden könnte. Schließlich notierte er in einer Skizze die ersten acht Töne der Melodie und ließ diesen ein Rezitativ für Basso solo mit einem selbst erdachten Text folgen: »Dieses ist es Ha es ist nun gefunden.«[13] Man kann diese Worte, die sich in abgewandelter Form auch in der fertigen Neunten finden (»O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen…« usw.), auf die Gestalt der ›Freudenmelodie‹ beziehen, die in der Tat als eine glückliche Findung Beethovens anzusehen ist. Analysiert man die melodische Struktur und vergleicht diese mit einer konstruierten ›schlechten‹ Variante, wird schnell deutlich, dass es rhythmische Qualitäten sind, die Beethovens Original attraktiver als das Konstrukt erscheinen lassen (Beispiel 1a).
Beispiel 1a: Beethoven, 9. Sinfonie, Finale, Skizze der ›Freudenmelodie‹ (Thayer 1879, S. 27ff.)
Die ersten acht Töne der ›Freudenmelodie‹ – Beethoven hat sie in der Skizze noch in G-Dur notiert – zeigen als primäre Dauernfolge lauter Viertel; gleiches gilt für die konstruierte Variante, bei der ein Ton (*) in seiner Höhe verändert wurde. Fragt man nun nach den sekundären Dauern und beobachtet speziell die Tonhöhen, die infolge von Tonrepetitionen länger oder kürzer sind, zeigen sich Abweichungen: Beim Original besteht die tonhöhenabhängige Dauernfolge aus Halben und Vierteln in ungerader Mischung, beim Konstrukt liegt eine gerade Anordnung vor. Dabei gilt für beide Fälle, dass die sekundären Dauern die primären nicht etwa auslöschen; vielmehr sind sie in Gestalt primärer und sekundärer Rhythmen gleichzeitig wirksam und auch wahrnehmbar. Dass Beethoven sich für eine Fassung der Melodie entschieden hat, bei der die von der Komponente ›Tonhöhe‹ abhängige Dauernfolge die acht Viertel nicht mittig, sondern asymmetrisch teilt, dürfte darin begründet sein, dass sie belebter, weniger mechanisch klingt als das Konstrukt.
Man könnte nun die Frage stellen, was der Wechsel von Tonhöhen mit Dauern und Rhythmen zu tun habe, wo es sich doch einfach um melodische Varianten handele. Das Notenbild lässt ja in der Tat keinen Unterschied der Notenwerte erkennen: Es zeigt ausschließlich Viertel. Die Antwort bestünde in einer Gegenfrage: Um was sollte es sich denn sonst handeln, wenn nicht um Dauern bzw. Rhythmen, die sich (im vorliegenden Fall) von den Tonhöhenwechseln herleiten? Wer den Unterschied der beiden Melodievarianten – Beethovens Original einerseits und das leicht veränderte Konstrukt andererseits – frei zu beschreiben versuchte, dem bliebe am Ende nichts anderes übrig, als Temporaladverbien zu Hilfe zu nehmen. Zunächst würde man vielleicht den Tonbestand ermitteln und feststellen, dass er in beiden Varianten identisch ist: d-c-h-a. Danach würden die melodischen Konturen verglichen und festgestellt, dass sie ebenfalls übereinstimmen: von der Terz aufwärts zur Quinte und danach wieder abwärts in Richtung Grundton. Des Weiteren könnte man registrieren, dass in beiden Fassungen zwei doppelt angeschlagene Tonhöhen sowie vier einzeln angeschlagene Töne vorkommen, was wiederum Übereinstimmung bedeutet. Um nun den Unterschied wirklich fassen zu können, müsste schließlich gefragt werden: ›Wann‹ setzen welche Töne ein und: ›Wann‹ verändern sich die Komponenten der Töne? Im vorliegenden Fall lautete z.B. eine Frage: ›Wann‹ treten die durch Repetition verlängerten Tonhöhen ein? Die Antwort: Im Konstrukt direkt nacheinander, im Original durch eine Viertel getrennt. Mit dieser Antwort hätten wir aber zeitliche Bestimmungen vorgenommen und befänden uns mitten in der Rhythmusanalyse. Die derart ermittelten sekundären Rhythmen können im Übrigen erklären, was die reine Melodieanalyse nicht vermag: warum das Konstrukt um einiges naiver und steifer als das Original erscheint.
Jede Musikanalyse ist einerseits von ›Was‹-, andererseits aber von ›Wann‹-Fragen bestimmt.[14] ›Was‹-Fragen betreffen die Gesamtheit des klingenden Materials, mit dem komponiert wird – also Töne/Klänge und Klanggestalten sowie deren Komponenten, und ›Wann‹-Fragen sind auf die Zeitverhältnisse und somit auf die Rhythmik und Metrik von Musik gerichtet. Komponentendauern bzw. Komponentenrhythmen, die sich von klingenden Phänomenen herleiten, holen etwas in die Rhythmusanalyse zurück, das bei der Fixierung auf notierte Einzeltondauern bisher fast immer unter den Tisch gefallen ist.
* * *
Feine Unterschiede in der Rhythmik von Melodievarianten lassen sich komponentenanalytisch gut beschreiben. Sie wurden bisher, wie ausgeführt, unter dem Aspekt ›Betonung‹, ›Emphase‹ oder ›Akzent‹ erörtert (sofern überhaupt nach ihnen gefragt wurde). Insbesondere der weit verbreitete Begriff ›Akzent‹ ist allerdings problematisch. Er scheint kaum angemessen, die Bildung von sekundären Dauern zu beschreiben, die ja zu den rhythmischen Alltagserscheinungen zählen. So lässt sich ein harmonischer Vorhalt zwar als Akzent beschreiben und historisch begründen, bei einem einfachen Wechsel von der Tonika in die Dominante und zurück liegt diese ›emphatische‹ Qualität dagegen meistens nicht vor. Sekundäre Dauern also, die sich etwa infolge solcher schlichter Harmoniewechsel einstellen, würden ignoriert, solange man nur nach Akzenten Ausschau hielte. Gleiches gilt für Tonhöhenwechsel nach Tonrepetitionen, die zwar im Einzelfall Akzentcharakter haben können, meistens aber nicht akzentuierend sind.
Ein weiteres Problem, das der Akzentbegriff aufwirft, hängt mit dem unklaren Verhältnis von metrischem und rhythmischem Akzent zusammen. Metrische Akzente werden seit Jahrhunderten als durch die Takthierarchie ›gegeben‹ beschrieben, während rhythmische Akzente das Ergebnis kompositorischer Entscheidungen sind. Bei letzteren stellt sich der Analysierende allerdings meistens die Frage, welche Akzente es ›wert‹ seien, bei der Beschreibung einbezogen zu werden, und welche als ›nebensächlich‹ vernachlässigt werden könnten. Denken wir an die Skizze zur Freudenmelodie zurück: Zwei Viertel h1 und zwei Viertel d2 wären in konventionellen Rhythmusanalysen womöglich als »Längenakzente«[15] eingestuft worden. Hätte dies aber auch noch in der textierten Fassung gegolten, in der die entsprechenden Töne (jetzt fis-fis und a-a) zwar alle mit je einer Silbe belegt sind, aber nur der erste »Längenakzent« (fis—) offensichtlich mit der Prosodie übereinstimmt, der zweite (a—) nicht (Beispiel 1b)? Vermutlich nicht, denn die verlängerte Tonhöhe a, die jetzt (im metrischen Kontext) synkopische Wirkung entfaltet, wird von Versmaß und Silbengewicht scheinbar unkenntlich gemacht. Wiederum wäre man dann jedoch mit der Schwierigkeit konfrontiert gewesen, das Konstrukt vom Original unterscheiden zu müssen, ohne auf die sekundären Dauern (Komponentenrhythmen) eingehen zu können, die hier eben nicht von Akzenten abhängen.
Beispiel 1b: Beethoven, 9. Sinfonie, Finale, ›Freudenmelodie‹, Anfang (textierte Fassung)
Besser geeignet als der Begriff ›Akzent‹ ist hier der neutralere Begriff ›Komponente‹[16], insoweit es um die Erfassung sekundärer Dauern geht. Der umfassende Bedeutungshof des Worts ›Komponente‹ legt eine entsprechend umfassende Analysemethode nahe. Wählt man eine bestimmte Komponente aus, um deren Rolle im rhythmischen Gefüge eines Tonsatzes zu ermitteln, dann müssen konsequenterweise alle Zeitpunkte, an denen sie zeitmarkierend wirkt, einbezogen werden. Die Untersuchung sollte deshalb weitgehend formalisiert werden, um sich nicht dem Vorwurf subjektiver Willkür auszusetzen. Das Ziel besteht ja darin, von musikalischen Komponenten abgeleitete Dauernfolgen mit anderen solchen Dauernfolgen zusammenzubringen und zu vergleichen, um auf diese Weise die Rhythmik einer (ein- oder mehrstimmigen) Klanggestalt differenzierter als bisher beschreiben zu können.
* * *
Beispiel 2a: Beethoven, 9. Sinfonie, Finale, Freudenmelodie, Var. I und III, harmonischer Rhythmus (und Harmonieauszug)
Zu den in rhythmischer Hinsicht besonders wirkungsmächtigen Komponenten gehört die Harmonik. Bei einem Harmoniewechsel haben wir es in jedem Fall mit einem bedeutenden Markierungszeichen im Zeitkontinuum zu tun. Von der Regel- oder Unregelmäßigkeit des harmonischen Rhythmus hängt der gesamte Bewegungscharakter einer Passage oder gar eines Satzes entscheidend ab. Im Fall der ›Freudenmelodie‹, die Beethoven zunächst in einer nicht harmonisierten Fassung in den Streicherbässen (T. 92) exponiert, kommen mit der ersten Variation (ab T. 116) im dreistimmig-polyphonen Satz (Melodie als Oberstimme in Bratschen und Celli) harmonische Rhythmen zum Zuge. Gleiches gilt für die nachfolgende vierstimmig-polyphone zweite Variation (ab T. 140) und schließlich für die vollstimmig-homophone dritte Variation (ab T. 164). Sehen wir uns den harmonischen Rhythmus der ersten und dritten Variation einmal etwas genauer an (Beispiel 2a).
Rhythmen – ganz gleich, ob sie auf primären oder sekundären Dauern beruhen – werden am besten auf einer Linie ohne Schlüssel und ohne Taktstriche notiert (siehe im Beispiel 2a jeweils das unterste System). Im vorliegenden Fall habe ich einen Harmonieauszug dazugestellt, damit man schneller überblicken kann, in welchem Rhythmus die harmonischen Funktionen wechseln. In Var. I (T. 116) ist der harmonische Rhythmus unerwartet mobil (eingedenk der schlichten Melodie), was selbst dann deutlich wird, wenn man Akkordumkehrungen, Halb- und Vollkadenzen, Vorhalte und ähnliche harmonische Details vorerst unbeachtet lässt und nur die Harmoniewechsel notiert. Mag man über einzelne Deutungen streiten (z.B. im vorletzten Takt des Ausschnitts von Var. I), so ist das meiste doch unstrittig, z.B. die Synkope des harmonischen Rhythmus beim Asteriskus (*) über dem vierten Taktstrich. Anders als in Var. III (T. 167 und öfters im Finale) wechselt Beethoven an dieser Stelle mit dem neuen Takt nicht in die Dominante, sondern hält die Tonikaharmonie unter den beiden fis1 der Hauptstimme fest. Damit wird beim Übergang vom dritten zum vierten Takt die Komponentendauer ›Tonhöhe‹ (fis1 = Halbe) von der Komponentendauer ›Harmonik‹ (Tonika = Halbe) unterstützt, während die primären Dauern (zweimal fis1 = zwei Viertel) fortbestehen. Auch der sich direkt anschließende Eintritt der Dominante auf der zweiten Zählzeit klingt synkopisch, wohingegen an der gleichen Stelle in Var. III der dominantische Vorhaltsquartsextakkord, der von der Eins an gilt, taktbestätigend ist. Insgesamt lässt sich sagen, dass der harmonische Rhythmus in Var. I aufgrund seiner Unregelmäßigkeit das Taktmetrum tendenziell erschüttert, während in Var. III die harmonischen Funktionen fast ausschließlich in Ganzen wechseln und mit dazu beitragen, ein prägnantes Alla-breve-Taktgefüge zu etablieren.
* * *
Anhand der Variationen I und III lassen sich weitere sekundäre Komponentendauern bzw. -rhythmen beschreiben. Die Komponenten ›Artikulation‹ und ›Phrasierung‹ sind nicht immer klar voneinander zu unterscheiden, zumal Legato- und Phrasierungsbögen die gleiche Form haben. In Var. I dürften die meisten Bögen in der Oberstimme legato bedeuten, während die langen Bögen in den Unterstimmen im 7. und 8. Takt wohl als Phrasierungsbögen gemeint sind. In Var. III, in der die Bläser (obere Akkolade) die ›Freudenmelodie‹ in einem einfachen Terz-Quint-Satz in vier Oktaven gleichzeitig spielen, handelt es sich meines Erachtens um Artikulationsbögen (legato bzw. portato) und gleichzeitig – mit Bezug auf den ersten und fünften Takt – um Phrasierungsbögen. Rhythmisch auffällig ist hier der Legatobogen im dritten Takt, der auf der zweiten Viertel beginnt und der Melodie einen leichten Impuls gibt. In den Streichern (untere Akkolade) wird markante Artikulation verlangt, die durch Pausen (Artikulationspausen), Staccatokeile oder beides gleichzeitig angezeigt ist. Die sekundären Dauern sind den primären eingepasst.
Phrasierungen leiten sich in erster Linie von innermusikalischen Motivbildungen her, darüber hinaus können sie durch Bögen angezeigt sein. Innere Phrasenstruktur und Phrasierungsbögen müssen dabei keineswegs übereinstimmen, viel eher können sie wie zwei eigenständige Komponenten eingesetzt werden und zu unterschiedlichen Dauernfolgen führen.[17] Die ›Freudenmelodie‹ ist schlicht isometrisch in 4(2+2) + 4(2+2) Takte untergliedert. Dieser Phrasenrhythmus ist auch in Var. III bestimmend. In Var. I zeigen Bass- und Tenorstimme indessen abweichende innere Phrasenaufteilungen (Beispiel 2b). Hinweisen möchte ich hier insbesondere auf eine vorübergehend ternäre Struktur in der Tenorstimme in Takt 120–122 von Var. I, die durch eine zweifache melodisch-rhythmische Wendung zustande kommt und die Selbständigkeit der Stimme unterstreicht.
Beispiel 2b: Beethoven, 9. Sinfonie, Finale, ›Freudenmelodie‹, Var. I und III,
Phrasenrhythmen (Binnengliederung/Bogenbezeichnung)
Große rhythmische Bedeutung haben auch jene sekundären Dauern, die aus Richtungswechseln in melodischen Verläufen resultieren. Beginnt eine Tonfolge steigend, so warten wir unbewusst darauf, wann ein Wechsel in die umgekehrte Richtung erfolgt. Die Zeitabstände zwischen den Wendepunkten führen zu Komponentenrhythmen von teils simpler, oftmals aber auch bizarrer Struktur. Dass sie Gegenstand des kompositorischen Kalküls sind, wird besonders bei monochronen Stücken, die auf einem einzigen Notenwert basieren, deutlich.[18] Hierher gehört in gewisser Weise auch der Anfang der Freudenmelodie in der Skizzenfassung (h1-h1-c2-d2-d2-c2-h1-a1) mit seinen acht einheitlichen Notenwerten (siehe Beispiel 1). Das d2, das bereits unter dem Aspekt der Tonhöhe angesprochen wurde, markiert einen melodischen Richtungswechsel. Dieser tritt nach drei Vierteln ein, um dann fünf Viertel später wieder in die Aufwärtsrichtung umzuschwenken; er teilt die acht Töne also im Verhältnis 3:5. Bei dem Vergleichsstück, der konstruierten Variante (h1-h1-c2-c2-d2-c2-h1-a1), fällt der obere Wendeton (›Kammton‹) genau in die Mitte der Phrase, gefolgt vom unteren Wendeton (›Kielton‹) nach wiederum vier Vierteln, was ein Verhältnis von 4:4 ergibt. Wiederum bestätigt eine sekundäre Dauernfolge (Komponentenrhythmus), dass Beethoven schon zu Anfang der Freudenmelodie für rhythmische Belebung innerhalb reiner Viertel-Folgen gesorgt hat. In gesteigerter Form zeigt sich die Relevanz ›diastematischer‹[19] Dauern und Rhythmen in den Kontrapunktstimmen der Var. I. So hat z.B. die Mittelstimme folgenden unregelmäßigen Rhythmus aus ›Kamm-‹ und ›Kieltönen‹: 1+2+5+3+1+4+1+2+4+½+3½ Viertel. In Var. III (Streicherpart) hat der Komponentenrhythmus ›Diastematik‹ dagegen nur eine den primären Rhythmus unterstreichende Rolle, weil hier die Intervallrichtung meist von Ton zu Ton wechselt.
Was die bereits angesprochene Komponente ›Tonhöhe‹ betrifft, wäre mit Bezug auf Var. I und III noch darauf hinzuweisen, dass Beethoven primäre und sekundäre Dauern häufig austauscht. So sind die beiden ersten Töne der Freudenmelodie, zwei repetierte Viertel, in den Instrumenten zu einer Halben zusammengezogen. Da das Wort »Freude« (später, in T. 241) auf zwei Tönen identischer Höhe gesungen wird, können die Instrumente die Dauer der Tonhöhe fis umstandslos übernehmen, also statt zwei Vierteln eine Halbe spielen. In Var. III werden einzelne dieser Halben dann aber wieder in zwei Viertel zurück verwandelt (im 3. und 7. Takt). Man sieht an diesem Spiel mit Komponentendauern, dass primäre und sekundäre Dauern stets beide als gegenwärtig angenommen werden müssen – selbst dann, wenn sie, was bei Tonhöhendauern häufig der Fall ist, identisch sind.
* * *
Primäre und sekundäre Dauern bzw. Rhythmen erscheinen im Zeitkontinuum sozusagen nebeneinander, d.h. sie finden gleichzeitig statt. Für die Praxis der Rhythmusanalyse bedeutet dies, dass sich nicht einfach ›der‹ Rhythmus eines Musikstücks, ja nicht einmal ›der‹ Hauptrhythmus eines Themas oder einer Passage bestimmen lässt, sondern dass zunächst die sekundären Dauern pro Stimme oder pro ›Abschnitt‹ ermittelt und aufeinander bezogen werden müssen, bevor dann die Rhythmik der polyphonen Textur beschrieben werden kann. Im Fall von Var. I (Beispiel 2b, oberes System) wären also die drei selbständig geführten Stimmen komponentenrhythmisch zu analysieren, so dass für jede Stimme das Gewebe aus primären und sekundären Dauern und Rhythmen sichtbar würde; dann kämen der harmonische Rhythmus sowie der übergeordnete Phrasenrhythmus dazu. Am Ende ergäbe sich ein partiturähnliches komplexes Gesamtbild aller primären und sekundären Rhythmen der drei Stimmen und des Tonsatzes als Ganzem, aus dem sich Rückschlüsse auf den spezifischen Bewegungsmodus dieser dem Charakter nach zarten, hellen und fluiden ersten Variation ziehen ließen. In Var. III (Beispiel 2b, unteres System) würde man anders vorgehen, da eine völlig andere Textur gegeben ist: Statt eines filigranen, polyphonen Gewebes aus drei Stimmen haben wir hier einen massiven Tuttisatz vorliegen. Dessen zwei Bereiche, nicht aber die einzelnen Stimmen wären komponentenrhythmisch zu analysieren. Auch hier würden die beiden Orchestergruppen – Bläser gegen Streicher – erst in ihrer individuellen Rhythmik zu bestimmen sein, danach kämen wiederum der harmonische und der übergeordnete Phrasenrhythmus hinzu, womit sich ein Gesamtbild des rhythmischen Charakters dieser Variation herauskristallisierte.
Dass die beiden Variationen stark kontrastieren, ist evident; um dies feststellen zu können, bräuchte man nicht die aufwendige komponentenrhythmische Analyse. Diese ist allerdings unverzichtbar, sobald es um die Feinanalyse eines musikalischen Zusammenhangs geht, also auch um dessen Rhythmik und Metrik. Trotz intensiver Erörterung von Fragen der musikalischen Rhythmik und Metrik in Musiktheorie und -wissenschaft[20] fehlte es bis heute an einem Schlüssel, mit dem rhythmische Strukturen jenseits der notierten Dauern genau zu beschreiben wären.[21] Ein im Kern sehr einfacher Sachverhalt, wie etwa die Tonhöhensynkope am Beginn von Beethovens ›Freudenmelodie‹, wäre unbemerkt und unerklärt geblieben, wenn denn danach gefragt worden wäre. Mit der Erkenntnis, dass primäre und sekundäre (komponentenabhängige) Dauern beide grundsätzlich immer nebeneinander bestehen, dass also selbst bei einstimmigen melodischen Linien mehrere Komponentenrhythmen gleichzeitig wirksam sind, lässt sich Musik als vielfaseriges rhythmisches Gewebe bis in kleinste Verästelungen hinein analysieren. Mit solcher Feinanalyse ist die rhythmische Komplexität hochrangiger Musik, die der ausübende Musiker vermutlich immer schon erspürt und der aufmerksame Hörer auch unbewusst wahrgenommen hat, nun auch theoretisch zu fassen.
* * *
Frobenius spricht in seinem Artikel auch die Frage an, ob die »Dauer« zu den Eigenschaften eines Tons zählt oder nicht. Außer bei Jean-Jacques Rousseau (1768) und Jan L. Broeckx (1967), die sie »als eine kompositorische Größe einstufen«[22], gilt die Tondauer überall als eine Toneigenschaft neben Tonhöhe, Tonstärke und Tonfarbe – und zwar von Gioseffo Zarlino bis hin zu Pierre Boulez.[23] Letzterer hat im Zuge der Beschreibung seriellen Komponierens die prinzipielle Gleichrangigkeit dieser »4 composantes« unterstrichen, indem er Reihen gebildet hat, deren »rapports chiffrés […] caractérisent aussi bien l’intervalle de fréquence que l’intervalle de durée, l’intervalle de dynamique que l’intervalle de timbre«.[24] Trotz der enormen Verbreitung des ›Vier-Eigenschaften-Axioms‹ hält sich ein Unbehagen angesichts dieser Zuordnung, das daher rührt, dass zwischen den physikalischen Merkmalen von Tönen (Höhe, Lautstärke, Farbe) und deren Erstreckung in der Zeit (Dauer) ein kategorialer Unterschied liegt. Im Hintergrund eines solchen Diskurses stehen zentrale Kategorien wie ›Raum‹ und ›Zeit‹. Wegen ihres materialen Charakters gelten Tonhöhe, Tonstärke und Tonfarbe eher als ›räumlich‹ bestimmt, während Dauer direkt ›Zeit‹ bedeutet.
Zwar gilt, dass es nichts Seiendes ohne Dauer gibt und dass somit auch kein Ton/Klang ohne Dauer in Erscheinung treten kann. Sobald wir es jedoch mit musikalischen Ereignissen innerhalb einer musikalisch strukturierten Zeit zu tun haben, genügt ein bloßes Konstatieren der (physikalischen) Dauer nicht. Es bedarf vielmehr eines Verständnisses von ›Dauer‹, das auf die konkrete Einbindung eines Ereignisses in eine rhythmische Ordnung eingeht. Dass zu solchen Ereignissen auch Teilmomente der Klangphänomene samt deren Einführung, Veränderung oder Wiederkehr gehören, ist eine der Kernthesen der Komponententheorie. Ein Anliegen dieses Beitrags war es zu zeigen, dass derartige Komponenten eine je eigene Zeitstruktur, also spezifische Komponentendauern und -rhythmen ausbilden, die das rhythmische Gesamtgefüge einer Komposition bereichern und mit bestimmen.
Anmerkungen
Frobenius 1979. | |
Ebd., 1. | |
Ebd. | |
Ebd., 4f. | |
Ebd., 5ff. | |
Z.B. LaRue 1957; Epstein 1995; Agmon 1997; Schachter 1999. | |
Ebd., 1. | |
Z.B. Berry 1976; Yeston 1976; Lerdahl & Jackendoff 1983; Lester 1986; Epstein 1995; Hasty 1997; London 2004. | |
Z.B. Kramer 1988; Rothstein 1989; Krebs 1999; Lerdahl 2001. | |
Vgl. zur Herkunft und Geschichte des Begriffs Blumröder 1982. | |
Häusler 1969, 49. | |
Ausführlich bei Petersen 2010. | |
Nach Thayer/Deiters/Riemann, Bd. V, 30; vgl. auch Nottebohm 1887, 191. | |
Justin London, der in seinem Rhythmus-Artikel im New Grove ebenfalls von »Whats« and »Whens« spricht, bezieht die beiden Anschauungsweisen auf die Rhythmik (»whats«) einerseits und die Metrik (»whens«) andererseits (London 2000, Bd. 21, 278). Weil der metrische Akzent nur im Kopf des Spielers oder Hörers existiere, fehle ihm die Konkretheit eines musikalischen Ereignisses, weshalb auf ihn »Was«-Fragen nicht zu beziehen seien. Durchaus widersprüchlich klingt dann allerdings die Feststellung, der »metrische Akzent« sei »always the first event in a measure« (ebd.), womit ihm offenbar doch Ereignischarakter zugestanden wird. Meines Erachtens sollten ›Wann‹- und ›Was‹-Fragen sowohl auf rhythmische als auch auf metrische Sachverhalte bezogen werden. | |
Z.B. Dürr/Gerstenberg 1963, 389. | |
Siehe für eine Definition oben; außerdem: Petersen 1999; Petersen 2010. | |
Vgl. dazu Petersen 2010, 53f. | |
Als exemplarisch für solche monochronen Kompositionen kann Ligetis Cembalostück Continuum gelten. Vgl. dazu meine Rhythmusanalyse des Stücks (Petersen 2009). | |
Der Begriff ›Diastematik‹ ist von dem musikhistorisch geläufigen Terminus ›diastematische Neumen‹ hergeleitet. | |
Vgl. den den 3. Teil meines oben erwähnten Buchs (Petersen 2010), der sich der Besprechung von Rhythmustheorien aus vier Jahrhunderten (von Michael Praetorius bis Justin London) widmet. | |
Stellvertretend für viele sei Carl Schachter erwähnt, dessen Arbeiten über Rhythmus und Metrum seit 1976 entstanden und 1999 in dem Band Unfoldings. Essays in Schenkerian Theory and Analysis neu erschienen sind. Schachter hat sich zum Ziel gesetzt, die Schenkersche Schichtenlehre auch für die Analyse rhythmischer Strukturen nutzbar zu machen. So gut und detailliert, wie Schachters Beobachtungen am konkreten Notentext auch sind, so bleiben die Ergebnisse hinsichtlich der präzisen Bestimmung einzelner Rhythmen oder gar rhythmischer Texturen doch unbefriedigend. Letztlich erweist sich die Schenkersche Reduktionsmethode als kontraproduktiv bei der Erörterung musikalischer Rhythmik, deren Vielfalt und Feinstruktur sich nur im Vordergrund, nicht aber in den tonalen Tiefenschichten aufspüren lässt. | |
Frobenius 1979, 4. | |
Ebd., 3f. | |
Boulez 1958 (»… Reihen, deren Zahlenverhältnisse sowohl Tonhöhen- als auch Dauernintervalle, Lautstärke- als auch Farbintervalle kennzeichnen«). |
Literatur
Agmon, Eytan (1997), »Musical Durations as Mathematical Intervals: Some Implications for the Theory and Analysis of Rhythm«, Music Analysis 16/1, 45–75.
Berry, Wallace (1976), Structural Functions in Music, Chapter Three: »Rhythm and Meter«, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 301–424.
Blumröder, Christoph von (1983), Artikel »Parameter«, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, 10. Auslieferung, 1–8.
Boulez, Pierre (1958), Artikel »Série«, in: Encyclopédie de la Musique Fasquelle, Bd. III, Paris: Fasquelle, 696f.
Dürr, Alfred und Walter Gerstenberg (1963), Artikel »Rhythmus, Metrum, Takt«, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, hg. von Friedrich Blume, Bd. 11, Kassel: Bärenreiter, 383–419.
Epstein, David (1995), Shaping Time. Music, the Brain, and Performance, New York: Schirmer.
Frobenius, Wolf (1979), Artikel »Dauer«, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, hg. von Hans-Heinrich Eggebrecht, Wiesbaden: Steiner, 1–9.
Hasty, Christopher F. (1997), Meter as Rhythm, New York / Oxford: Oxford University Press.
Häusler, Josef (1969), Musik im 20. Jahrhundert. Von Schönberg zu Penderecki. Bremen: Schünemann.
Kramer, Jonathan (1988), The Time of Music. New Meanings, New Temporalities, New Listening Strategies, New York: Schirmer.
LaRue, Jan (1957), »Harmonic Rhythm in the Beethoven Symphonies«, Music Review 18, 8–20.
Lerdahl, Fred (2001), Tonal Pitch Space, New York / Oxford: Oxford University Press.
Lester, Joel (1986), The Rhythms of Tonal Music, Carbondale / Edwardsville: Southern Illinois University Press.
London, Justin (2000), Artikel »Rhythm«, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2. Ausgabe, hg. von Stanley Sadie, Vol. 21, London / New York: Macmillan, 277–309.
London, Justin (2004), Hearing in Time. Psychological Aspects of Musical Meter, New York / Oxford: Oxford University Press.
Nottebohm, Gustav (1887), Zweite Beethoveniana. Nachgelassene Aufsätze, Leipzig: Rieter-Biedermann.
Petersen, Peter (1999), »Die ›Rhythmuspartitur‹. Über eine neue Methode zur rhythmisch-metrischen Analyse pulsgebundener Musik«, in: 50 Jahre Musikwissenschaftliches Institut in Hamburg. Bestandsaufnahme – aktuelle Forschung – Ausblick (= Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 16), hg. von Peter Petersen und Helmut Rösing, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 83–110.
––– (2009), »›Jede zeitliche Folge von Tönen, Klängen, musikalischen Gestalten‹ hat Rhythmus. Über die Rhythmik in Ligetis Cembalostück ›Continuum‹«: Online Publikation: http://www.saitenspiel.org/saitenspiel.org/Ligetis_Continuum.html
––– (2010), Musik und Rhythmus. Grundlagen, Geschichte, Analyse, Mainz u.a.: Schott.
Rothstein, William (1989), Phrase Rhythm in Tonal Music, New York: Schirmer.
Schachter, Carl (1999), Unfoldings. Essays in Schenkerian Theory and Analysis, hg. von Joseph N. Straus, New York / Oxford: Oxford University Press.
Thayer, Alexander Wheelock (1866–1879), Ludwig van Beethovens Leben. Auf Grund der hinterlassenen Vorarbeiten und Materialien weitergeführt von Hermann Deiters, hg. von Hugo Riemann, 5 Bde., Berlin: Weber, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 2001.
Yeston, Maury (1976), The Stratification of Musical Rhythm, New Haven/London: Yale University Press.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.