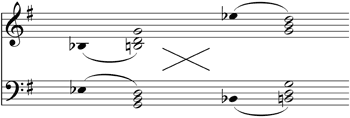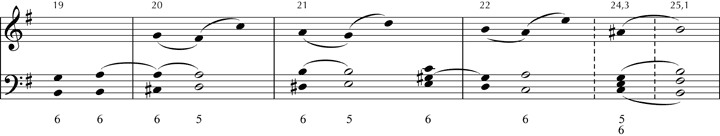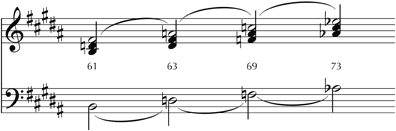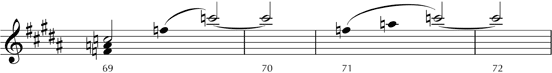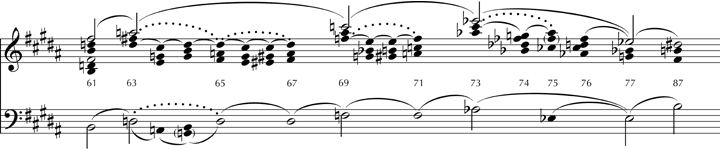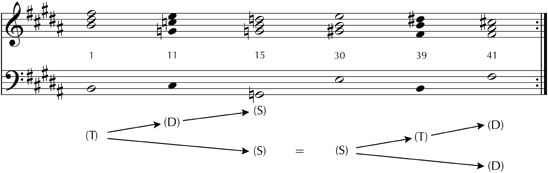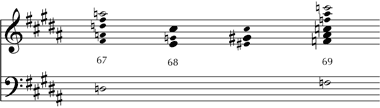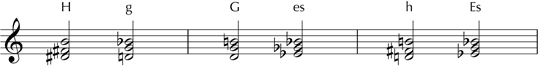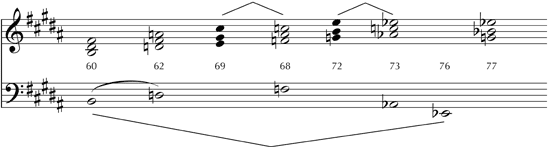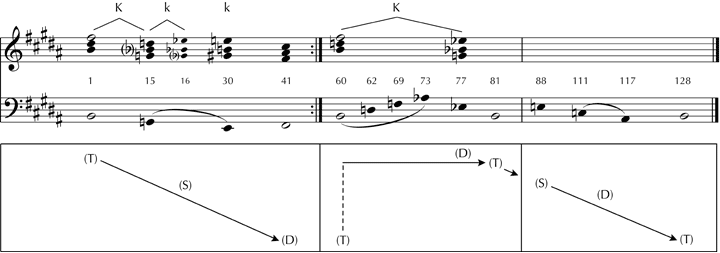Schuberts frühe Sonatenform und die Tonfeldtheorie
Stefan Nowak
Der Beitrag bietet eine detaillierte Analyse des Kopfsatzes von Schuberts Klaviersonate D575 von 1817. Dabei werden erstmals bei einer so frühen Sonate des Komponisten traditionelle Analyseverfahren mit Simons Tonfeldtheorie kombiniert.
I. Einleitung
Eine in der Schubertforschung des 20. Jahrhunderts viel diskutierte Frage war, wie die teils auffälligen Ausprägungen der Schubertschen Sonatenform zu bewerten seien. Schon früh tendierten zahlreiche Musikwissenschaftler zu einem negativen Urteil. Ablehnend konstatierte man Schuberts Neigung zu parataktischer Reihung der Formteile, zu ungewöhnlichen Tonartendispositionen sowie zum Umkreisen zentraler Klänge. Diese formbildenden Verfahren, in Liedkompositionen ästhetisch gebilligt, galten – in einem Sonatensatz beobachtet – als Ursache einer Diskrepanz zwischen der dynamischen Form, wie man sie mustergültig bei Beethoven ausgeprägt fand, und einem ›lyrischen Inhalt‹. Für Joseph v. Spaun standen »hie und da Längen oder Mängel« dem »Ursprüngliche(n) und Frische(n)« gegenüber (die Qualität der Einfälle Schuberts hat man trotz der konstatierten formalen Mängel nicht übersehen).[1] Alfred Einstein warf Schubert vor, seine Durchführungen – bei Beethoven Inbegriff der Entwicklung – seien »oft nur Übergänge, ja manchmal sogar der Ort für Episoden und seliges Verweilen«.[2] Karl Michael Komma schließlich unterstellte Schubert »Zweifel an der Sonate im überlieferten Sinn« sowie die Absicht zum »Rütteln an der überkommenen Form«.[3]
Der Kopfsatz der Klaviersonate in H-Dur (D575) diente mehrfach als Beispiel einer »missverstandenen Sonatenform«[4]: Zum einen existieren für ihre Zeit fortschrittliche Klangverbindungen, die sich schwerlich mit dem Konzept einer dynamischen Entwicklung vereinbaren lassen (beispielsweise der innerhalb eines H-Dur-Kontextes eingefügte ›Schein-Seitensatz‹ in G-Dur, T. 15–26). Zum anderen gerät Schubert, indem er den Seitensatz der Exposition sowie den Repriseneinsatz in der Tonart der IV. Stufe erscheinen lässt, in Konflikt mit bestehenden Normen der Sonatentheorie. Die Tonartendisposition scheint einem Beethovenschen Konzept diametral entgegen zu stehen und hat Schubert sogar den absurden Vorwurf der Bequemlichkeit eingehandelt: Es handele sich um einen »Kunstgriff« oder »Trick«, »um ohne jede Änderung durch […] [die Reprise] hindurchzukommen.«[5]
Diesen Vorwurf hat Hans-Joachim Hinrichsen philologisch entkräftet: Ein Vergleich zwischen dem handschriftlichen Entwurf und der nur in einer Abschrift überlieferten Endfassung zeigt, dass die vermeintlich bequemere Variante das Resultat einer in mehreren Arbeitsgängen erzielten Vereinfachung einer ursprünglich komplizierteren Reprisenanlage darstellt. Hinrichsen selbst erklärt die Besonderheit des Reprisenbeginns ästhetisch als Resultat aus der Anlage der Durchführung.
Diese Durchführung ist nämlich harmonisch betrachtet nichts weiter als eine enharmonische Auskomponierung der Tonart H (Vierteilung der Oktave: H-D-F-As=Gis-H). Danach noch einmal in H-Dur zu beginnen, wäre nicht nur pedantisch, sondern auch ein glatter Verstoß gegen das tonale Gleichgewicht.[6]
Dieser Deutung ist zuzustimmen. Sie soll in diesem Beitrag allerdings auf eine breitere Basis gestellt werden. Was nämlich bei Hinrichsen als Ergebnis einer singulären Analyse erscheint, lässt sich als Anzeichen eines Systems betrachten, das die Grundlage des musikalischen Zusammenhangs in Schuberts gesamter Musik bilden könnte. Dieses System kann mit Hilfe der Theorie der Tonfelder nach Albert Simon beschrieben werden.
Erste Versuche, die Tonfeldtheorie auf eine Komposition Schuberts anzuwenden, haben Bernhard Haas und Stefan Rohringer unternommen.[7] Beide setzen sich – auf je unterschiedliche Weise – mit einer Frage auseinander, die Haas aufgeworfen hat: wie nämlich die Analysemethode Heinrich Schenkers, deren Anwendung bei Schubert ebenfalls zu konsistenten Ergebnissen führt, mit derjenigen Simons zusammen bestehen kann.
Das Anliegen dieses Beitrags ist allerdings bescheidener. Es geht darum, erstmals einen der frühen Sonatensätze von Schubert einer ausführlichen Analyse nach Simon zu unterziehen. Im Anschluss an eine mehr oder weniger konventionelle Analyse in Teil II werden in Teil III zentrale Elemente der Theorie Simons, ›Funktion‹ und ›Konstrukt‹, auf ihre Tragfähigkeit untersucht, den musikalischen Zusammenhang auf unterschiedlichen formalen Ebenen und strukturellen Schichten (also durchaus im Geiste der Schenkerschen Schichtenanalyse) zu erhellen.
II. Harmonische Analyse
a. Exposition
Die Exposition des Satzes gliedert sich in vier Tonartenbereiche: H-Dur, G-Dur ab Takt 15, E-Dur (ab T. 27 notiert, in Grundstellung zum ersten Mal mit dem Eintritt des Seitensatzthemas in T. 30) und Fis-Dur (von T. 41 bis zum Doppelstrich).[8] So konventionell sich der Rahmen des Formteils ausnimmt (H-Dur und Fis-Dur), so bemerkenswert sind die Ereignisse im Inneren: der Seitensatz auf der IV. Stufe sowie der erwähnte ›Schein-Seitensatz‹ (T. 15ff.), der mit einer seltsamen Mischung aus G-Dur, g-Moll und Es-Dur denkbar weit von der Grundtonart H-Dur entfernt liegt.
Vor dem Hintergrund derartiger Harmoniefolgen und einer solchen Tonartendisposition fällt auf, dass Hinrichsens Analysen diese Ereignisse fast immer nur rubrizierend aufführen: als Vorkommnisse von Typen, nicht im Hinblick auf deren konkrete satztechnische Einbettung. Um zu einem umfassenderen Verständnis der Schubertschen Harmonik zu gelangen, müssen aber auch die nicht minder auffälligen Arten der satztechnischen Vermittlung von Akkorden berücksichtigt werden, denn die Klangwirkung eines Akkordes hängt wesentlich davon ab, wie er konkret aus dem vorangehenden Klang hervorgeht. So ist in Takt 15 auffällig, wie G-Dur erreicht wird: Ein H7/9-Akkord in Takt 10 mündet trugschlüssig in einen C-Dur-Akkord, der selbst wiederum subdominantisch in die neue Tonart G-Dur führt. Der Tonartenwechsel wirkt abrupt und dadurch exponiert, weil an eben dieser Stelle – einer Zäsur – die Dynamik und die Satztechnik (vom Unisono in einen Akkordsatz) wechseln. Der Wechsel der Satztechnik kommt hier einer Aufhebung der Akkordverbindung, einer Suspension der Stimmführungsvorgänge gleich.[9]
Dagegen setzt die Passage ab Takt 15 in überdeutlicher Art darauf, die tonartfremden Töne b und es stimmführungstechnisch einzubinden, wie die folgende Grafik verdeutlicht[10]:
Beispiel 1: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 15ff.: Stimmführung
Schubert schafft es, diese Stelle merkwürdig instabil klingen zu lassen: Das harmonische Geschehen pendelt zwischen G-Dur (jeweils auf den ersten drei Zählzeiten) und Es-Dur (auf Zählzeit 4). Der Einsatz der Oberstimme auf dem Ton b, durch Akzentuierung hervorgehoben, verdunkelt das gerade erst etablierte G-Dur merklich – das es der Bassstimme deutet einen neapolitanischen Sextakkord an. Auch der in der Grafik verdeutlichte Stimmtausch trägt zu dem schwebenden Charakter der Stelle bei: Hier werden von Schenker her bekannte Stimmführungstechniken, wie sie in der Musik zwischen 1680 und 1810 häufig zu finden sind, in den Dienst neuer Klangeffekte gestellt.
Ähnliches lässt sich im weiteren Verlauf festhalten: Zwar wird der Weg zum subdominantischen Seitensatz mit einer in vieler Hinsicht undurchsichtigen Sequenz (T. 20–24) beschritten, aber der Übergang wirkt, ganz im Gegensatz zu jenem nach G-Dur, sehr organisch. Dies kann zumindest teilweise stimmführungstechnisch begründet werden: Die Häufung von Sextakkorden legt nahe, der Passage einen steigenden Fauxbourdonsatz als Gerüst zu Grunde zu legen, der im Bass chromatisch angereichert und stellenweise zur 5-6-Konsekutive ausgebaut wird:
Beispiel 2: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 19–25: 5-6-Konsekutive[11]
Die (Quint-)Sextakkordkette vermittelt zwischen dem noch zum ›Schein-Seitensatz‹ gehörigen G-Dur in Takt 19 und dem a-Moll-Sextakkord (T. 22f.), der im Sinne einer phrygischen Wendung nach H-Dur (T. 25), der Dominanttonart des Seitensatzes führen kann.[12]
Was folgt, ist ein in seiner harmonischen und melodischen Einfachheit beinahe irritierender Seitensatz. Im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung dieses Beitrags sind jedoch zwei andere Aspekte von Bedeutung: die Tonart der IV. Stufe und die Schlussgruppe, die in die erwartete Dominanttonart führt.
b. Durchführung
Die Durchführung des Satzes erscheint mit lediglich 27 Takten vergleichsweise kurz. Zudem ist sie mehr von Klangereignissen geprägt als von Stimmführungsprozessen, d.h. Schubert vermeidet traditionelle Verfahren der linearen Akkordverbindung, indem er unvermittelt von Akkord zu Akkord springt und häufig Lagenwechsel vornimmt. Der bereits in der Exposition beobachtete abrupte Gestus (T. 3/T. 11) erscheint hier zum Prinzip erhoben.
Das folgende Diagramm zeigt den Mittelgrund der Durchführung. Bemerkenswert ist, dass die vier von Hinrichsen genannten tragenden Akkorde (h-D-F-As) – bei näherer Betrachtung – allesamt in Quintlage erscheinen.
Beispiel 3: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 61–73: Quintlagen in der Durchführung
Dass der h-Moll-Akkord in Quintlage erscheint, bedarf keiner weiteren Erklärung; die Lage gleicht derjenigen des H-Dur-Akkords zu Beginn der Exposition. Die Quintlage des F-Dur- (T. 69) und des As-Dur-Akkords (T. 73) wird jeweils in den Folgetakten in der nächst höheren Oktave bestätigt: F-Dur erscheint in Takt 71 als vollständiges Arpeggio, nachdem in Takt 69 der Terzton ausgelassen wurde. Ebenso erscheint As-Dur in Takt 73 als Arpeggio, analog zum F-Dur-Akkord in Takt 69 wiederum mit ausgelassenem Terzton (für die Wahrnehmung der Quintlage ist jedoch der Ton es3 entscheidend).
Beispiel 4: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 69–72: Quintlage von F-Dur
Von dieser Beobachtung ausgehend, lässt sich auch das vordergründig in Oktavlage eintretende D-Dur als großflächiges Arpeggio in Quintlage auffassen: Beim ersten Mal (T. 62) befindet sich d1 im Sopran, beim zweiten Mal (T. 64) fis3 (es bildet den Zielpunkt des vordergründigen Arpeggios a2-d3-fis3) und beim dritten Mal (T. 66) a2 – gewissermaßen als Zielpunkt des Arpeggios und ›mittelgründige‹ Oberstimme. In Takt 67 vollzieht sich diese Bewegung ein weiteres Mal auf engerem Raum, diesmal in der ›korrekten‹ zweigestrichenen Oktave.
Die Hauptklänge des ersten Durchführungsteils werden – mit Ausnahme des h-Moll-Akkordes – durch weitere Akkorde auskomponiert: D-Dur wird mit den Kadenzakkorden A7 und einem plagal in die Kadenz führenden G-Dur angereichert. Von Takt 65 an bleibt der mittelgründige Bass auf d stehen. Die Akkorde, die oberhalb des ›Orgelpunktes‹ chromatisch verschoben werden, nehmen den Charakter von Durchgangsklängen an. Das folgende Schaubild zeigt die Hauptakkorde in Quintlage sowie die vermittelnden Akkordbewegungen:
Beispiel 5: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 61–87: Mittelgrund[13]
Die Takte 69–72 wiederholen das Geschehen der Takte 65–68 um eine kleine Terz nach oben auf f versetzt. Auch die Akkordfolge von Takt 73 an lässt noch das Vorbild der Takte 65–67 erkennen. Um allerdings den Es-Dur-Akkord in Takt 77 halbschlüssig herbeiführen zu können, hat Schubert die Akkordfolge modifiziert und in Takt 76 einen doppeldominantischen verkürzten B7/9- mit tiefalterierter Quinte eingeschoben. Dabei spielen vor allem die Eintrübung des As-Dur-Klanges in einen as-Moll-Klang sowie die Hinzufügung des Tones fes, der den Akkord vorübergehend als Fes-Dur wirken lässt, eine besondere Rolle. Nach einer ›regulären‹ Auflösung des fes ins es (T. 76f.) erscheint der auf ›falscher Stufe‹ angesetzte Halbschluss auf Es-Dur. Zugleich beginnt der zweite Abschnitt der Durchführung.
Der zweite Teil der Durchführung setzt den harmonischen Weg von Es-Dur nach H-Dur fort: Es-Dur wird in den Takten 77–80 allmählich in einen Dv über g umgewandelt, enharmonisch umgedeutet und in Takt 81 in einen Fis-Dur-Septakkord weitergeführt. Der H-Dur-Akkord, mit dem die Durchführung in Takt 87 endet, irritiert, weil er nicht die V. Stufe der Ausgangstonart bildet, sondern über einen Quintfall in die Subdominanttonart E-Dur führt.
Weil die Reprise – abgesehen von der Transposition – eine wörtliche Wiederholung der Exposition bildet, muss auf sie für unsere Zwecke nicht weiter eingegangen werden. Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang allerdings, dass eine auf der IV. Stufe angesetzte und ansonsten wörtlich von der Exposition übernommene Reprise im Sonatenmodell Heinrich Schenkers als eine Ausnahme erscheint, die zu besonderen Erklärungen herausfordert.[14] Im nächsten Abschnitt wird mit Hilfe der Tonfeldtheorie jedoch eine Interpretation angeboten, welche die Subdominantreprise nicht negativ (als Abweichung von einer Norm), sondern positiv aus ihrer Rolle im besonderen formalen Ablauf dieses Sonatensatzes beschreibt.
III. Tonfeldanalyse
Nach der Analyse der harmonischen Stationen des Satzes und ihrer Verankerung in den Stimmführungsprozessen folgt nun die Tonfeldanalyse. Zur besseren Übersichtlichkeit ist diese in zwei Teile gegliedert, in denen die beiden für die Sonate maßgeblichen Tonfelder, ›Funktion‹ (a) und ›Konstrukt‹ (b), getrennt voneinander betrachtet werden. Dabei werden zunächst eher lokal wirksame bzw. vordergründige Zusammenhänge betrachtet und schließlich solche, die über größere Distanzen (teilweise über den ganzen Sonatensatz) hinweg wirksam sind.
a. ›Funktion‹ als formbildendes Element[15]
1. Mit Hilfe der Tonfeldtheorie Albert Simons lassen sich den beobachteten harmonischen Phänomenen ›Funktionen‹ zuordnen. So entspricht die beschriebene harmonische Abfolge in der Durchführung (h-D-F-As), die Hinrichsen als enharmonische Auskomponierung der Tonart H interpretiert, einem Verweilen im Tonfeld ›Funktion h/d/f/as‹. Über Hinrichsen geht diese Deutung insofern hinaus, als sie einem Detail des Tonsatzes einen spezifischen Sinn geben kann: Die erwähnte Quintlage der tragenden Akkorde erscheint jetzt als Teil der Struktur des Tonfeldes. Die Grundtöne h-d-f-as liegen im Bass, die Quinttöne fis-a-c-es in der Oberstimme. Die Analogie der Lagen suggeriert die funktionale Äquivalenz der beteiligten Akkorde: Ein und derselbe ›Klang‹ wird von vier verschiedenen Seiten gezeigt.
2. Dass das Tonfeld ›Funktion‹ eine übergeordnete Struktur liefern kann, lässt sich auch anhand der Exposition zeigen. Der Einschub einer Taktgruppe in G-Dur (T. 15ff.) in ein Gefüge aus H- und E-Dur wirkt aus funktionsharmonischer Perspektive vergleichsweise unorthodox. Tonfeldtheoretisch aber sind G- und E-Dur als äquivalent zu betrachten, da sie demselben Funktionsfeld angehören. Die Auffassung als Äquivalenz wiederum ergibt Sinn, insofern beide Passagen (im Sinne der Formenlehre) als Seitensätze fungieren. Aus Simonscher Perspektive sind die beiden Seitensätze gemeinsam als ›Subdominantbereiche‹ gegen den ›Tonikabereich‹ des Hauptsatzes abgesetzt.
3. Nach Simon wird bei der Fortschreitung von einer ›Funktion‹ in eine andere zwischen plagalen und authentischen Schritten unterschieden. Plagal ist der Weg in eine ›quinthöhere‹ ›Funktion‹ (beispielsweise von der ›Funktion h/d/f/as‹ zur ›Funktion fis/a/c/es‹), authentisch der Weg in eine ›quinttiefere‹. Haas ordnet authentischen und plagalen Schritten unterschiedliche Wirkungen zu: »Die authentische Bewegung hat den Vorrang, sie ist kraftvoll, gleich dem Vorwärtsschreiten der Musik.«[16] Dagegen bezeichnet er den plagalen Schritt als »Rückwärtsgehen oder Ausholen«.[17]
Der Unterschied zwischen authentischen und plagalen Schritten besitzt im ersten Satz der H-Dur-Sonate formale Relevanz. Es fällt auf, dass an allen entscheidenden Stellen der Sonatenform ein authentischer Schritt vorliegt: Jeder der drei durch Doppelstriche abgegrenzten Teile der Exposition sowie der Übergang zur Durchführung werden durch einen ›Quintfall‹ – also einen authentischen Schritt im Sinne Simons – verbunden (H- nach G-Dur, E- nach Fis-Dur bzw. Fis-Dur nach h-Moll). Mit dem Erreichen des h-Moll zu Beginn der Durchführung schließt sich gewissermaßen der Kreis der ›Funktionen‹. Interessant sind hier die Details der Akkordverbindungen. Der Übergang von H-Dur nach G-Dur führt – wie bereits erwähnt – als plagale Wendung über C-Dur. Analog dazu erscheint zwischen E-Dur und Fis-Dur ein kurzes H-Dur (T. 39), das seinerseits den Zielpunkt einer Sequenz (T. 37–39) darstellt. Vordergründig werden die übergeordneten authentischen Schritte mithin als Folge von zwei plagalen Schritten dargestellt.
Beispiel 6: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, Exposition: authentische Schritte als doppelte Plagalschritte[18]
Diese Aufgabenverteilung, das Wirken der ›plagalen‹ Schritte im Vordergrund und dasjenige der ›authentischen‹ im Hintergrund, kann als strukturelles Prinzip des gesamten Satzes verstanden werden. In diesem Sinne wäre auch die Folge von Durchführung und Reprisenbeginn als weiträumiger authentischer Schritt zu begreifen: Die Durchführung, die eine einzige hintergründige ›Tonika‹ auskomponiert, mündet mit einem kraftvollen authentischen Schritt in die subdominantisch ansetzende Reprise. Die mitunter kritisierte ›Transpositionsreprise‹ lässt sich aus dieser Perspektive heraus als konsequente Fortsetzung der authentischen Schritte interpretieren; denn die wörtliche Übernahme der Exposition garantiert die Wiederholung der beiden ›Quintfälle‹ zwischen den drei Tonartenbereichen. Die Subdominantreprise erfüllt somit einen funktionalen Sinn im Gefüge einer Sonatenform, die auf Tonfeldern gründet. Und gegen den (aus Beethovenscher Sicht erhobenen) Vorwurf der mangelhaften formalen Stringenz in Schuberts Sonatensätzen ließe sich die H-Dur-Sonate als ein Beispiel anführen, das auf einer Stringenz eigener und um 1817 sehr moderner Art beruht.
b. ›Konstrukt‹
1. Die sechs Töne eines ›Konstrukts‹ lassen sich in zwei komplementäre Akkorde, in einen Dur- und einen Mollakkord teilen. Jeder Ton des Durakkordes liegt einen Halbtonschritt von einem Ton des Mollakkordes entfernt. Die Klangwirkung eines derart artikulierten ›Konstrukts‹ hängt unter anderem von der Reihenfolge der beteiligten Akkorde ab: Tritt der Mollakkord an zweiter Stelle auf, so wurde der klangliche Effekt schon von Richard Cohn als »unheimlich« beschrieben.[19] Umgekehrt lässt ein ›Konstrukt‹ den Durakkord an zweiter Stelle in einem sehr hellen und klaren Licht erscheinen (man kann metaphorisch sogar an ein ›Abheben‹ der Musik zu einer ›transzendenten Ebene‹ denken).
Bei der Artikulation eines ›Konstrukts‹ folgt ein Komponist den satztechnischen Möglichkeiten, die zu seiner Zeit bereit stehen. Während Komponisten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts – wie Bruckner und Schönberg – ein ›Konstrukt‹ als unmittelbare Akkordfolge in eine Komposition aufnehmen konnten, finden sich vor dieser Zeit – beispielsweise bei Mozart – fast nur indirekte Darstellungen, d.h. ›Konstrukte‹ erscheinen beispielsweise durch die besondere Inanspruchnahme ›gewöhnlicher‹ Satzmodelle.[20]
Schubert kennt die unmittelbare Artikulation eines ›Konstrukts‹ (z.B. im Sanctus der Messe in Es-Dur D950, T. 1–4) ebenso wie die indirekte, die in dieser Sonate vorliegt. Die drei Halbtonschritte, die für die Transformation des Ausgangs- in den Zielakkord des ›Konstrukts‹ notwendig sind, finden nicht gleichzeitig statt, sondern in der Regel nacheinander: Entweder erscheint zunächst ein einzelner Halbtonschritt, und danach folgen die übrigen beiden gleichzeitig, oder die Reihenfolge ist exakt andersherum.[21] Überdies erklingen die wenigsten (lokalen) ›Konstrukte‹ vollständig, sondern lediglich mit fünf Tönen.[22] Stellvertretend seien einige wenige Beispiele herausgegriffen: Bereits erwähnt wurde die Akkordfolge G-Dur - Es-Dur in Takt 15–19 (hier fehlt der Ton ges). Ein weiteres fünftöniges ›Konstrukt‹ findet sich im Schlussteil der Durchführung: Es-Dur - H-Dur (T. 80/81; hier fehlt der Ton d).
Eine etwas andere Situation zeigt sich bei einer indirekten Artikulation eines ›Konstrukts‹. Ein Beispiel bieten die Takte 68/69. Die Akkordfolge Cis-Dur - F-Dur kann für sich als fünftöniges ›Konstrukt‹ gelten. Der Schritt e-eis geht einerseits der Konstruktfolge voraus, steht andererseits aber so nahe am Geschehen, dass der Ton e als sechster Ton des ›Konstrukts‹ interpretiert werden könnte.[23]
Beispiel 7: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 67–69: ›Konstrukt Ia‹
2. Wie schon bemerkt, stellt das ›Konstrukt‹ eine Einheit aus Gegensätzen dar, eine Verbindung aus sechs Tönen, die sich ›intern‹ wiederum zu zwei kontrastierenden Klangbereichen zusammenschließen. Ein ›Konstrukt‹ kann auf der Ebene des Hintergrunds angesiedelt sein, und auch der Kontrast kann hintergründig wirken. So sind etwa die Töne des ›Konstrukts Ib‹ formbildend für den gesamten Satz – in Ergänzung zu den beschriebenen ›Funktionen‹. Die folgende Abbildung stellt zunächst die möglichen Akkordpaare des ›Konstrukts‹ dar:
Beispiel 8: ›Konstrukt Ib‹ in drei komplementären Akkordpaaren
Während die Verbindung G-Dur – es-Moll (als vordergründige Akkordfolge) bereits unter Punkt 2a erläutert wurde, sollen hier die beiden anderen Akkordpaare des ›Konstrukts‹ behandelt werden. Die formalen Stellen, die diese Akkordpaare besetzen, sind die Übergänge zwischen dem Haupt- und dem ›Schein-Seitensatz‹ sowie zwischen den Eckpunkten der Durchführung.
Die Reihenfolge der beteiligten Akkorde, die das ›Konstrukt Ib‹ darstellen, lässt sich auf den Formabschnitt beziehen, in dem die Akkordpaare jeweils erscheinen: In der Exposition lautet die Abfolge Dur - Moll, in der Durchführung Moll - Dur.[24] Dass es sich gerade in der Durchführung nicht um die ›unheimliche‹, sondern um die aufhellende Inszenierung des ›Konstrukts‹ handelt, ist sinnfällig: Im Vordergrund finden sich zwischen dem h-Moll (T. 60) und Es-Dur (T. 77) sowohl eine konventionelle Variante der harmonischen Aufhellung, der Terzstieg von h-Moll nach D-Dur, als auch die im vorigen Abschnitt beschriebenen konstruktiven Effekte. Das ›Konstrukt‹ bildet somit den richtungsweisenden Rahmen für eine Reihe aufhellender Vordergrundeffekte, welche – in Ergänzung zu den erwähnten internen Plagalschritten – dem ›funktional‹ bedingten harmonischen Stillstand der Durchführung entgegenwirken.
Beispiel 9: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz, T. 60–77: ›aufhellende‹ Konstrukte
IV. Zusammenfassung und Ausblick
Das Zusammenspiel von Funktions- und Konstruktverbindungen ist in Beispiel 10 zusammengefasst.
Beispiel 10: Franz Schubert, Klaviersonate H-Dur D575, 1. Satz: Zusammenspiel konstruktiver und funktionaler Zusammenhänge
Es bestätigt sich eine Feststellung, die Stefan Rohringer am Beispiel des B-Dur-Trios D898 getroffen hat, dass nämlich bei Schubert »ein Wechsel zwischen benachbarten Funktionen […] so eingerichtet ist, dass der Übergang sogleich ein ›Konstrukt‹ hervorbringt«.[25] Mit ›K‹ bzw. ›k‹ werden alle Akkordpaare bezeichnet, die das ›Konstrukt Ib‹ hervorbringen. Dabei zielt die Großschreibung auf eine mittelgründige Erscheinung, die Kleinschreibung auf eine vordergründige.
Eine andere Feststellung Rohringers, »dass ein Formverlauf, der auf Vervollständigung oder Eliminierung eines Tonfelds hin ausgerichtet ist, der Formdramaturgie einen prozessualen Charakter verleihen kann«[26], spielt in diesem Sonatensatz eine untergeordnete Rolle. Nicht die schrittweise Vervollständigung oder Eliminierung von Tonfeldern, sondern das Fortschreiten in authentischen Schritten bildet das harmonische Prinzip, aus dem eine vorwärtstreibende Kraft hervorgeht.
Beobachtet man das Verhältnis zwischen der Darstellung von Tonfeldern und den satztechnischen Anschlüssen von Akkordfolgen, so fällt auf, dass Schubert auf traditionelle Anschlüsse gerade dann verzichtet, wenn die Akkorde zu einer ›Funktion‹ gehören. Der Gis-Dur-Septakkord in Takt 3 bildet einen ersten Beleg dafür: So abrupt der Einsatz der Zwischendominante gestisch wirkt, so kontinuierlich erscheint er harmonisch, weil Schubert das Tonfeld ›Tonika‹ nicht verlässt. Noch deutlicher wird dieses Prinzip in der Durchführung, die – wie erwähnt – harmonisch an der (hintergründigen) ›Tonika‹ festhält, aber auf eine melodische Vermittlung der zahlreichen Einzelklänge nahezu gänzlich verzichtet. Die Stimmführung kommt hingegen dann zum Tragen, wenn entweder zwischen den beiden kontrastierenden Akkorden eines ›Konstrukts‹ oder zwischen unterschiedlichen ›Funktionen‹ gewechselt wird. Ein Beispiel für ersteres wäre das ›Konstrukt‹ in Takt 15ff., dessen Töne es und b satztechnisch als Wechselnoten bzw. Vorhalte erscheinen. Letzteres kommt in der Passage zwischen Takt 19 und 25 zum Tragen: Das ›plagale Ausholen‹ (von der ›Subdominante‹ G-Dur zum kurzzeitigen Halbschluss H-Dur) wird in eine Sequenz eingebettet.
Diese hier mitgeteilten Beobachtungen dürfen als vorläufige Erkenntnisse gelten. Um den zuletzt vorgebrachten Gedanken weiterzuverfolgen, müsste die Untersuchung auf weitere Werke ausgedehnt werden, insbesondere unter dem Aspekt der satztechnischen Einbettung signifikanter, das Stück tragender Funktionswechsel. Hierzu lassen sich dem Kopfsatz von D575 keine eindeutigen Erkenntnisse abgewinnen: Während beim Plagalschritt H-C (T. 9f.) die satztechnische Vermittlung nur sehr dezent erfolgt, ist beispielsweise der authentische Schritt im Seitensatz von E-Dur nach Fis-Dur in eine traditionell anmutende Quintfallsequenz eingebettet. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob sich beispielsweise die von Rohringer angedeutete Hinzunahme des dritten Simonschen Tonfeldes, der Quintenreihe, sowie deren Kombination insbesondere mit dem ›Konstrukt‹ bei der Analyse von Schuberts Musik als gewinnbringend herausstellt.
Anmerkungen
Zit. nach Hinrichsen 1994, 15. | |
Einstein 1950, 86. | |
Zit. nach Kämper 1987, 26. | |
Vgl. Hinrichsen 1994, Fußnote 282. Dort bezieht sich der Autor auf Walther Dürr, Paul Egert und auf eigene Äußerungen. | |
Hans Gál (1970), zit. nach Hinrichsen 1994, 125. Der Vorwurf der Bequemlichkeit kann allein dadurch zurückgewiesen werden, dass Schubert einzig und allein in der H-Dur-Sonate D575 die Möglichkeit einer vollständigen transponierten Übernahme nutzt (abgesehen von der Fragment gebliebenen Sonate fis-Moll D571); in sämtlichen anderen derartig angelegten Stücken weist die Reprise Unterschiede gegenüber der Exposition auf. | |
Ebd., 126. | |
Rohringer 2009. | |
Dass ab Takt 41 wieder H-Dur vorgezeichnet ist, könnte das Einschwenken des Geschehens in den konventionellen dominantischen Seitensatz der Exposition suggerieren (der traditionelle Tonartenwechsel zur Dominanttonart wird nicht durch Änderung der Grundvorzeichnung angezeigt). | |
Der abrupte Gestus selbst wurde in dezenter Form bereits in Takt 3 mit der Zwischendominante Gis7 vorausgenommen. | |
Zugunsten besserer Lesbarkeit wird auf eine exakte Angabe der Oktavlagen verzichtet. Schubert nimmt bei der Wiederholung des Motivs in Takt 15 leichte Veränderungen vor. | |
Das Beispiel zeigt, dass die Takte 20 bis 22 den Kern der Sequenz bilden (Melodiebildung analog). Harmonisch lassen sich taktweise D-Dur (T. 20) und E-Dur (T. 21) zuordnen (Dies wird auch durch die Oberstimmenbewegung 4-3-7 suggeriert.) Die Oberstimme wurde in der Generalbassbezeichnung nicht berücksichtigt, um die 5-6-Bewegung zu verdeutlichen. In dem Moment, in dem sich das Satzmodell (vgl. linke Hand T. 22) nicht fortsetzen lässt (es entstünde eine verminderte Quinte fis-c ), bricht der Komponist ab und kehrt zurück zum a-Moll Sextakkord (T. 22, 2. Zählzeit). | |
Dies geschieht von Takt 24 nach 25, sogar als übermäßiger Quintsextakkord c-e-g-ais. | |
Dieses Schaubild ähnelt der Anlage nach (wie alle anderen in diesem Beitrag) den Diagrammen der ›Schenkerian Analysis‹, beruht jedoch auf anderen systematischen Voraussetzungen. | |
In zahlreichen Schenkerschen Analysen kommt es bei der Deutung der Reprisen zu gravierenden Uminterpretationen gegenüber den Expositionen. So werden hintergründige Bewegungen der Exposition in der Reprise oft in den Mittelgrund verschoben, andere vormals mittelgründige Züge wandern in den Hintergrund. Bestes Beispiel hierfür ist die Kadenz, mit der in Takt 128 die abschließende Modulation nach H-Dur vollzogen wird: In der Exposition wurde hier aus gutem Grund eine (nicht explizit notierte) Quintlage angenommen, welche die Ankunft der 3 auf der 2 der Urlinie repräsentierte. In der Reprise stellt diese Stelle aber den strukturellen Schluss des Satzes dar (was ihm folgt, erscheint als lockere Nachbereitung der erreichten Schlusstonika). Also muss es sich hier um die Ankunft auf der 1 handeln, was harmonisch wiederum eine Oktavlage impliziert. | |
Im Folgenden wird der Terminus ›Funktion‹ generell in dem von Simon geprägten, erweiterten Sinne verwendet. | |
Haas 2004, 15. | |
Ebd., 16. | |
Das Diagramm symbolisiert Funktionswechsel (im Sinne Simons) mit Pfeilen nach oben bzw. unten: Dabei wird deutlich, dass ein authentischer Schritt (Pfeilrichtung abwärts) zwei Plagalschritten (Pfeilrichtung aufwärts) entspricht. Letztere entstehen durch die (in Viertelnoten dargestellten) zwischengeschalteten ›vordergründigen‹ Akkorde. | |
Vgl. Cohn 2004. Dass Cohn von einer »unheimlichen« Klangwirkung spricht, mag daran liegen, dass er immer nur die Abfolge Dur - Moll betrachtet. Darüber hinaus ist das Wort »uncanny« bei Cohn mehrdeutig; denn er rekurriert in seinem Text explizit auf die Freud’sche Prägung des Wortes »unheimlich«, welche immer auch das Gegenteil von »heimlich« meint, im Sinne eines Aufdeckens von etwas, das nicht »ans Licht« kommen soll. | |
Vgl. Polth 2006, 158. Michael Polth bezeichnet solche »harmonischen Wendungen, welche aus dem besonderen Gebrauch resultieren«, als »Metaeffekte«. | |
Vgl. die Analyse des Liedes ›Aufenthalt‹ (Sotirianos 2007, 39), in dem ein ›Konstrukt‹ als Akkordfolge E-Dur - c-Moll ausgebreitet wird, vermittelt durch einen e-Moll-Akkord. Dadurch verteilen sich die drei Halbtonschritte auf zwei Akkordfortschreitungen. | |
Es hat wenig Zweck, den vermeintlichen Mangel der Unvollständigkeit durch die Integration eines entfernt liegenden Tones beheben zu wollen, da entfernte Töne mit dem vordergründigen Effekt des ›Konstrukts‹ in der Regel nicht in Verbindung gebracht werden können. Es mag überraschen, dass auch ein unvollständiges ›Konstrukt‹ als ›Konstrukt‹ wahrgenommen werden kann. Doch ist bereits aus traditioneller Harmonik bekannt, dass sich die funktionale Einheit eines Zusammenklangs auch konstituieren kann, wenn nicht alle Töne erscheinen. | |
Beim Übergang von F-Dur nach As-Dur erscheint in analoger Weise das von e-Moll und As-Dur induzierte ›Konstrukt‹ (T. 72). | |
Dass an der entsprechenden Stelle in der Exposition auf das Erklingen eines echten g-Moll-Akkordes verzichtet wird, lässt sich mit der bereits erläuterten Technik der sukzessiven Ausbreitung eines ›Konstrukts‹ und unter Verweis auf die vorige Fußnote leicht begründen und ändert an der irritierenden klanglichen Wirkung nur wenig. | |
Rohringer 2009, 299. | |
Ebd. |
Literatur
Cohn, Richard (2004), »Uncanny Resemblances. Tonal Signification in the Freudian Age«, Journal of the American Musicological Society 57/2, 285–323.
Einstein, Alfred (1950), Die Romantik in der Musik, München: Liechtenstein.
Haas, Bernhard (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon, Wilhelmshaven: Noetzel.
Hinrichsen, Hans-Joachim (1994), Untersuchungen zur Entwicklung der Sonatenform in der Instrumentalmusik Franz Schuberts, Tutzing: Schneider.
Kämper, Dietrich (1987), Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrjabin, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Polth, Michael (2006), »In den Freiräumen der Schenkerschen Tonalität. Harmonische Effekte durch Tonfelder in der Prager Sinfonie«, Tijdschrift voor Muziektheorie 11/3, 151–163.
Rohringer, Stefan (2009), »Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen. Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898«, ZGMTH 6/2−3, Hildesheim u.a.: Olms, 273−308.
Sotirianos, Markus (2007), Die musikalische Sprache des späten Schubert am Beispiel des Schwanengesangs, Zulassungsarbeit für das künstlerische Lehramt an Gymnasien, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.