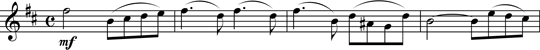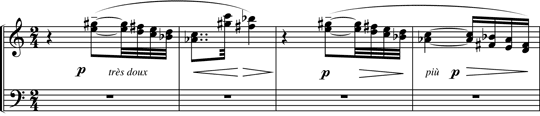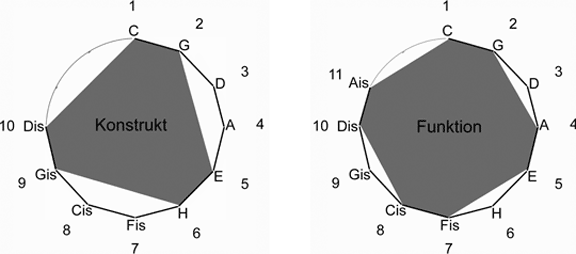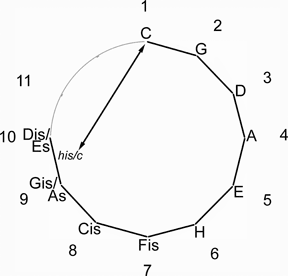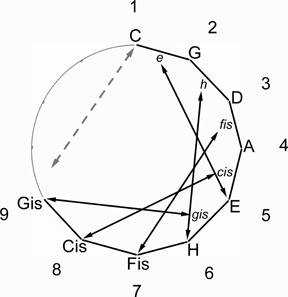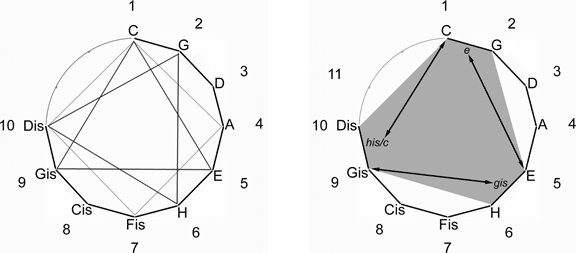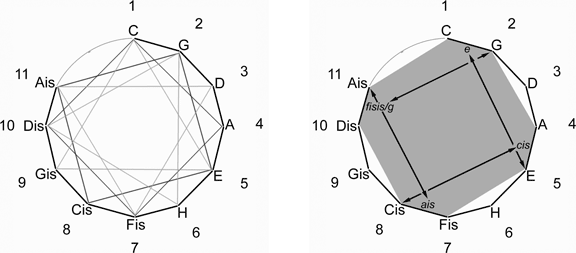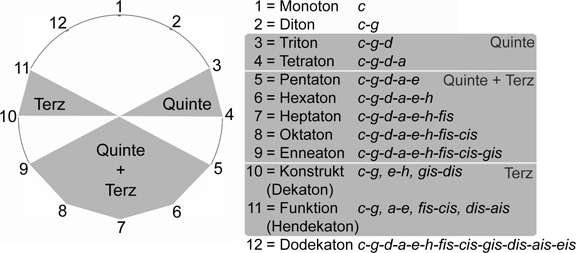›Konstrukt‹ und ›Funktion‹
Eine Herleitung der Simonschen Tonfelder
Dres Schiltknecht
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Begründung und Herleitung der Simonschen Tonfelder, also mit dem, was der Tonfeld-Analyse logisch vorausgeht: Nach welchen Kriterien sind Tonfelder beschaffen und warum gibt es nur die von Albert Simon behaupteten Tonfelder? Tonfelder beschreiben Tonbeziehungen. Davon ausgehend lassen sich zwei Tonfeld-Typen unterscheiden: Tonfelder, die ausschließlich auf dem Intervall der Quinte aufgebaut sind und deshalb als Quinttonfelder bezeichnet werden, und Tonfelder, die auf je zwei Intervallen, der Quinte und der großen (›Konstrukt‹) bzw. der kleinen Terz (›Funktion‹) aufgebaut sind. Der unterschiedlich strukturierte Zusammenhang der Töne korreliert mit einer unterschiedlichen Auffassung der Tonbeziehungen selbst: Bei Quinttonfeldern sind die Tonbeziehungen eindeutig, bei ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ ambivalent. Im Versuch, diese ›ambivalenten Tonfelder‹ aus den Quinttonfeldern abzuleiten, offenbart sich im Hinblick auf beide Tonfeld-Typen ein innerer Zusammenhang zwischen Intervallaufbau und Intervallauffassung. Davon ausgehend lassen sich ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ als die einzig möglichen ambivalenten Tonfelder begründen. Nun ergibt sich eine verblüffende Erkenntnis über Zusammenhang und Vollständigkeit der Tonfelder: Die ambivalenten Tonfelder ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ können als modifizierte Quinttonfelder aufgefasst werden und fügen sich als solche nahtlos an die bestehenden Quinttonfelder an. Die dadurch erreichte Vollständigkeit numerisch möglicher Quinttonfelder ist gleichzeitig der Beweis für die Vollständigkeit der von der Simonschen Theorie vorgeschlagenen Tonfelder.
Einleitung
Die Analyse nach Tonfeldern geht davon aus, dass den Strukturen, mit denen sie arbeitet, musikalische Zusammenhänge entsprechen und dass eine strukturelle Analyse dazu verhelfen kann, Zusammenhänge zu erleben, die man zuvor nicht erlebt hat. Das Erstaunliche und bisweilen Befremdende der bis heute veröffentlichten Tonfeldanalysen[1] mag sein, dass die Beschreibung der Zusammenhänge mit wenigen Tonfeldern auskommt. Gibt es einen Grund dafür, dass nur drei Grundformen von Tonfeldern existieren (Quinttonfelder[2], ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹), oder handelt es sich um eine willkürliche Setzung? Dieser Frage widmet sich der vorliegende Beitrag: Er beschäftigt sich mit der Begründung und Herleitung der Tonfelder selbst, also mit dem, was der Tonfeld-Analyse logisch vorausgeht. Nach welchen Kriterien sind Tonfelder beschaffen, und warum gibt es nur die von Albert Simon behaupteten Tonfelder?[3]
I. Vorüberlegungen
›Eindeutige‹ und ›ambivalente Ton-Auffassung‹
Bezogen auf die Anordnung der Töne innerhalb einer Oktave lassen sich alle möglichen Tonvorräte in zwei Kategorien einteilen: Tonvorräte, die distanziell, und solche, die nicht-distanziell strukturiert sind. Distanziell strukturierte Tonvorräte beruhen auf der Teilung der Oktave in gleichgroße (äquidistante) Abschnitte, d.h. das jeweilige Intervall-Muster dieser Tonvorräte wiederholt sich mehrmals innerhalb einer Oktave.[4] Dagegen wiederholt sich das Intervall-Muster in nicht-distanziell strukturierten Tonvorräten oktavweise. Bei letzteren sprechen wir der Einfachheit halber fortan von diatonisch strukturierten Tonvorräten. (Das stimmt zwar genau genommen nicht, soll aber hier nichts anderes bedeuten, als dass diese Tonvorräte, wie die Diatonik, sich oktavweise wiederholen.)
Da unsere Notenschrift laut Gárdonyi auf diatonischer Basis »gewachsen« ist, kommt es bei allen Tonvorräten der ersten Kategorie zu einem »unlösbaren inneren Widerspruch zwischen diatonischen Tonnamen (die in jeder Oktave nur einmal vorkommen) und distanzieller Struktur (die sich innerhalb des Oktavraums periodisch wiederholt) […]«[5] Gárdonyi weiter: »Der oktavweisen diatonischen Einmaligkeit der Tonnamen steht hier somit die oktavweise distanzielle Mehrmaligkeit der kurzen Intervallmuster gegenüber.«[6]
Jegliche distanzielle Struktur bringt aufgrund dieses Widerspruchs die Notwendigkeit der enharmonischen Verwechslung mit sich. Haas schreibt dazu im Zusammenhang mit dem Tonfeld ›Funktion‹: »Offenbar ist hier die Möglichkeit enharmonischer Verwechslung oder die bereits durchgeführte enharmonische Verwechslung [Identität von dis und es etc.] vorausgesetzt.«[7] Diese ›durchgeführte‹ enharmonische Verwechslung, die ›Identität‹ von dis und es, indiziert jedoch nicht bloß einen Widerspruch zur ›diatonisch gewachsenen‹ Notation, sondern einen Widerspruch zu unserem Verständnis bzw. der Auffassung von Tönen, also der Art und Weise, wie wir aufgrund einer Jahrhunderte alten Tradition europäischer Kunstmusik (einschließlich einer bislang nicht-überbrückten Distanz zur Neuen Musik) gewohnt sind, Töne (innerlich) zu hören und aufeinander zu beziehen. Die Notenschrift ist letztlich nichts als das graphische Abbild einer ebenfalls diatonisch gewachsenen Auffassung von Tönen. In dieser diatonischen Auffassung sind und bleiben es und dis zwei verschiedene Töne, d.h. ein und derselbe Ton-Ort kann in unterschiedlichen musikalischen Kontexten verschiedene Ton-Bedeutungen (dis und es) annehmen. Der Begriff ›enharmonische Verwechslung‹ ist daher irreführend: dis kann nicht mit es verwechselt werden, weil die Ton-Bedeutung eines Tonorts im jeweiligen Kontext feststeht. Tonorte bilden demnach auch keine neutralen Instanzen im Sinne von »weder dis noch es«. Dies wäre nur dann möglich, wenn unsere Wahrnehmung von Tönen nach Belieben auch ohne Auffassung von Ton-Bedeutungen geschehen könnte (wir können jedoch Tonorte nicht ohne Ton-Bedeutung wahrnehmen). Abstrakt betrachtet ist der Tonort dis/es ambivalent, d.h. nicht festgelegt auf, aber offen für die eine wie die andere Bedeutung, er ist »sowohl dis als auch es«.
Wir halten fest: Diatonisch und distanziell strukturierte Tonvorräte unterscheiden sich in der Art und Weise, wie Tonorte auf Grundlage der Diatonik aufgefasst werden. In diatonisch strukturierten Tonvorräten ist die Bedeutungs-Zuordnung zu einem Tonort eindeutig, d.h. jeder Tonort besitzt eine diatonische Bedeutung – wir bezeichnen dies fortan vereinfacht als ›eindeutige Ton-Auffassung‹. In distanziell strukturierten Tonvorräten jedoch sind die Tonorte von ihrer Bedeutung her ambivalent, d.h. einem Tonort entsprechen zwei verschiedene diatonische Bedeutungen – im folgenden ›ambivalente Ton-Auffassung‹ genannt. Im Umkehrschluss gilt, dass ambivalente Tonorte in distanziellen, eindeutig bestimmte Tonorte in diatonischen Strukturen vorkommen.
Wahrnehmung von Ambivalenz
Lässt sich Ambivalenz wahrnehmen? Die Ambivalenz eines Tonortes wahrzunehmen heißt nicht, dass ein wechselnder musikalischer Kontext einem Tonort nacheinander (im Sinne einer enharmonischen Umdeutung) zwei verschiedene Ton-Bedeutungen (z.B. dis/es) verleiht. Vielmehr bedeutet es, dass ein spezieller Kontext (von dem noch zu sprechen sein wird) einen Tonort zugleich in beiden möglichen Bedeutungen erscheinen lässt. ›Zugleich‹ wäre besser noch als Fluktuation zu beschreiben: Der Hörer erkennt beide Ton-Bedeutungen, aber kann sich auf keine von beiden festlegen, weil bei jeglichem Versuch der Festlegung die jeweils andere ihr Daseinsrecht anmeldet. Wie sieht ein solcher Kontext aus?
Sehr aufschlussreich im Zusammenhang mit Ambivalenz ist ein Artikel von Richard Cohn, »Uncanny Resemblances: Tonal Signification in the Freudian Age«.[8] Das Hauptanliegen Cohns besteht darin, Musiktheorie mit Psychoanalyse, die Wahrnehmung von Ambivalenz in der Musik mit Freuds Auffassung des ›Unheimlichen‹ (›Uncanny‹) in Verbindung zu bringen. Das ›Unheimliche‹ analysiert Freud – anders als seine Vorgänger – nicht als das Fremde und Unvertraute, sondern als etwas, das sowohl unvertraut-fremd als auch vertraut-heimlich ist. In Übertragung auf die Ambivalenz des Tonortes dis/es könnte das bereits Gesagte, dass der Tonort sowohl als dis als auch als es verständlich ist (was eben gleichzeitig bedeutet, dass sowohl dis als auch es als unverständlich empfunden werden müssen), dahingehend umformuliert werden: Ambivalenz besteht, wenn nicht festgestellt werden kann, welche der beiden möglichen Ton-Bedeutungen als die vertraute und welche als die fremde erscheint, sondern wenn beide Bedeutungen beides zugleich sind.[9] Das Beispiel, an dem Cohn das Phänomen der Ambivalenz nachweist, ist – wohl nicht zufällig – ein distanzieller Tonvorrat, der sogenannte »Hexatonic Pole«, sechs Töne, die von ihrer Struktur her dem ›Konstrukt‹ der Tonfeldtheorie entsprechen.
Zwei Beispiele sollen die Kontexte näher bestimmen, die eine Wahrnehmung von Ambivalenz auslösen. Entscheidend wird dabei sein, dass die distanzielle Ordnung der Töne nur dann für eine Ambivalenz sorgt, wenn diese die Tiefenstruktur des musikalischen Zusammenhangs betrifft. Das heißt: Ambivalenz kann mitunter auch dort wahrgenommen werden kann, wo die Oberfläche des Tonsatzes keine distanziellen Strukturen enthält, wie umgekehrt distanzielle Strukturen an der Oberfläche bisweilen keine Ambivalenz entstehen lassen.
Abb. 1a: Peter Iljitsch Tschaikowsky, Thema aus dem Schwanensee-Ballett (Schlussakt)
Abb. 1b: Claude Debussy, Préludes Bd. 1, Nr. 2 Voiles (Anfang)
Das Schwanensee-Thema steht eindeutig in h-moll. Dennoch – und das ist das Bemerkenswerte – lässt der dritte Takt für einen Augenblick einen g-Moll-Akkord anklingen (der den düsteren Grundcharakter der Melodie unterstreicht). Der Leitton ais kann trotz des h-Moll-Kontextes im Vorübergehen auch als b verstanden werden. Es entsteht also eine Ambivalenz, weil derselbe Tonort quasi-gleichzeitig auf zwei gegensätzliche Weisen aufgefasst werden kann: als ais (Leitton im übergeordneten h-Moll-Kontext) und als b (Akkord-Terz im g-Moll-Akkord).[10] Da aber die Wahrnehmung von Ambivalenz an distanzielle Strukturen gebunden ist, müssen wir davon ausgehen, dass wir auch einem vermeintlich eindeutigen h-Moll-Geschehen – wenn der spezielle Kontext dies erlaubt – eine distanzielle Ordnung als Grundstruktur des musikalischen Zusammenhangs zugrunde legen.[11]
Das zweite Beispiel zeigt in etwa das Gegenteil des ersten. Weil ausschließlich ganztönige Strukturen vorherrschen (und überdies ein Basston fehlt), kommt es erst gar nicht zu (diatonischen) Tonbeziehungen, die eine Ambivalenz auslösen könnten. Aus der Perspektive von Cohn/Freud wirken die Klänge weder fremd noch vertraut, sondern neutral.
Die Wahrnehmung von Ambivalenz setzt demnach einen musikalischen Kontext voraus, der nicht allein eine distanzielle Tonordnung als Basis seines strukturellen Zusammenhangs deutlich macht, sondern überdies (traditionelle) diatonische Tonbeziehungen hervorbringt, deren (traditionell bekannte) Eindeutigkeit auf der Basis der distanziellen Ordnung in Ambivalenz umschlagen kann. Eine systematische Erschließung ambivalenter Strukturen – und damit die Herleitung der Tonfelder ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ – kann also erst dann erfolgen, wenn wir Töne und Tonbeziehungen hinsichtlich ihrer ›Verständlichkeit‹ (im Sinne der diatonischen Auffassung) näher untersucht haben.
Die Verständlichkeit von Tönen
Grundsätzlich gilt, dass die Verständlichkeit eines Tones mit seinem Intervallabstand zu einem anderen Ton gleichgesetzt werden kann. Sei ein Ton gesetzt, so resultiert die Verständlichkeit eines zweiten Tones aus der Verständlichkeit des Intervalls zwischen ihnen. Wenn also im Folgenden von der ›Verständlichkeit von Tönen‹ die Rede ist, ist damit zugleich die Verständlichkeit von Intervallen gemeint.
Die Verständlichkeit von Tönen lässt sich anhand eines konkreten Beispiels erläutern: Zu einem ersten, als h gesetzten Ton erklingt ein zweiter Ton im Abstand von vier Halbtonschritten aufwärts. Das Naheliegendste ist, den Abstand als große Terz und Ton 2 als dis zu bestimmen. Derselbe Abstand könnte in einem veränderten Kontext als verminderte Quarte und Ton 2 als es bestimmt werden (z.B. in c-Moll). Weil wir stets darauf angewiesen sind, Töne und Abstände zu bestimmen – die diatonische Ton-Auffassung ist für den Hörer keine Option, sondern eine (historisch gewachsene) Bedingung – entscheiden wir uns im vorliegenden Falle für das diatonisch Näherliegende, die große Terz. In beiden Fällen ist es aber letztlich der Zusammenhang mit bzw. die Vermittlung durch andere, tatsächlich erklingende oder aber nur ›gefühlte‹ (weil naheliegende) Töne, die uns eine große Terz oder eine verminderte Quarte hören lassen. Die Verständlichkeit eines Tones basiert also auf der Vermittlung durch andere Töne (bzw. Intervalle).
Eine Vermittlung durch Töne und Intervalle muss zurückführbar sein auf Tonbeziehungen, die selbst nicht mehr vermittelt werden müssen. Wir bezeichnen diese Tonbeziehungen fortan als ›unmittelbar verständlich‹. Die Ambivalenz eines Tones (z.B. dis/es) entsteht demnach dann, wenn sowohl die eine (dis) als auch die andere (es) Ton-Bedeutung durch unmittelbar verständliche Tonbeziehungen vermittelt wird. (Die Bestimmung, welche Tonbeziehungen unter welchen Bedingungen als unmittelbar verständlich gelten, ist Teil der Herleitung der Tonfelder in den nächsten beiden Kapiteln.)
Da Tonfelder musikalische Strukturen angeben, denen musikalische Zusammenhänge entsprechen, kann vorausgesetzt werden, dass diese Strukturen (im Sinne der diatonischen Auffassung) verständlich sind und mit ihnen die Töne, die das jeweilige Tonfeld artikulieren. Ein Tonfeld muss daher ausschließlich aus unmittelbar verständlichen Tönen bzw. Intervallen konstituiert sein.
II. Herleitung der Tonfelder
Ausgehend von den vorangegangenen Überlegungen kann folgende These formuliert werden:
Ein ausschließlich aus unmittelbar verständlichen Intervallen konstituierter Tonvorrat ist dann als Tonfeld zu bezeichnen, wenn aus den durch die spezifische Struktur des Tonvorrates artikulierten Tonbeziehungen eine einheitliche Auffassung der Töne hervorgeht.
Da es zwei verschiedene Auffassungen von Tönen gibt, die eindeutige und die ambivalente, muss es zwei verschiedene Kategorien von Tonfeldern geben. Unterschiedliche Tonfelder derselben Kategorie bilden wiederum mögliche Varianten, die sich bei der konkreten Umsetzung einer einheitlichen Ton-Auffassung ergeben. Aus der diatonisch-eindeutigen Auffassung geht die Kategorie der Quinttonfelder hervor, die zweite Kategorie besteht aus den Tonfeldern ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ und basiert auf der enharmonisch-ambivalenten Auffassung.
Quintgenerierte Tonfelder
Die reinen Intervalle Oktave und Quinte (bzw. Quarte) können als unmittelbar verständlich vorausgesetzt werden. Daher bietet es sich an, bei der nun folgenden Herleitung der Tonfelder von der Anzahl theoretisch möglicher, aus dem Quint-Intervall generierter Tonvorräte auszugehen[12]: Ein für den musikalischen Zusammenhang relevanter Tonvorrat soll aus wenigstens zwei Elementen (also zwei Quinten bzw. drei Tönen) bestehen sowie eine Teilmenge aus dem ›Total‹ der Zwölftönigkeit darstellen. Der größtmögliche quintgenerierte Tonvorrat besteht somit aus elf Tönen, der kleinstmögliche aus drei Tönen.
Allerdings ist das Repertoire der möglichen Quintenreihen in der Tonfeld-Theorie bereits beim Enneaton, also bei neun Tönen zu Ende. Ein Dekaton (zehn Töne) gibt es ebenso wenig wie ein Hendekaton (elf Töne).[13] Gleichzeitig zeigt jedoch Abbildung 2, dass die Töne der beiden distanziell strukturierten Tonfelder Simons, ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹, in den beiden Quintenreihen Dekaton und Hendekaton enthalten sind. Wie das Dekaton ist auch das ›Konstrukt‹ neun Quinten ›breit‹, die ›Funktion‹ wie das Hendekaton zehn.
Abb. 2: Dekaton mit integriertem ›Konstrukt‹, Hendekaton mit integrierter ›Funktion‹
Der entscheidende Unterschied zwischen den Tonvorräten Dekaton und ›Konstrukt‹ einerseits sowie Hendekaton und ›Funktion‹ andererseits besteht in deren jeweiliger Struktur: Dekaton und Hendekaton beruhen auf der diatonischen Struktur[14] der Quintenreihen, ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ auf einer distanziellen Struktur. Der Unterschied ist also zugleich derjenige zwischen Eindeutigkeit und Ambivalenz in der Ton-Auffassung. Wenn nach Simon also nur die distanziell strukturieren Tonvorräte ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹, nicht aber auch Dekaton und Hendekaton als Tonfelder gelten, so könnte dies von dem hier dargelegten Ansatz aus damit erklärt werden, dass die Töne einer Quintenreihe nur dann eindeutig aufgefasst werden können, wenn die Gesamtzahl von neun Tönen nicht überschritten wird. Kommt jedoch ein zehnter Ton hinzu, entsteht Ambivalenz. Der ›neue‹ zehnte Ton (nehmen wir an, er lautet dis) kann nicht mehr eindeutig als dis, sondern muss sowohl als dis als auch als es aufgefasst werden.
Wie zuvor erläutert, beruht Ton-Auffassung generell auf Vermittlung durch unmittelbar verständliche Intervalle. Wird ein zehnter Ton ambivalent als dis und es aufgefasst, muss es für beide Auffassungen Gründe geben, d.h. das Tonfeld muss zwei verschiedene Weisen ermöglichen, den zehnten Ton auf unmittelbar verständliche Intervalle zurückzuführen. Somit kann auch die Quinte nicht mehr das einzige Intervall sein, das die Tonfeld-Struktur determiniert; denn die Beziehung vom zehnten zum ersten Ton[15] kann in Quint-Vermittlung nur als übermäßige Sekund c-dis (über die Töne 2–9), nicht aber als kleine Terz c-es verstanden werden. Woher kommt also die zweite Bedeutung des Tonortes als es?
Die ›quintgebundene‹ Terz
Abb. 3: Dekaton mit Dur-Dreiklang zwischen den Randtönen
Abb. 3 zeigt, dass die Randtöne des Dekatons (die Töne 1, 9 und 10) einen Dur-Dreiklang bilden. Fasst man sie als einen solchen auf, müssen sich die Bedeutungen einiger beteiligter Töne (gegenüber ihren Bedeutungen in der Quintenreihe) ändern: Soll Ton 1 nach wie vor c heißen, muss Ton 10 es lauten; soll Ton 10 weiterhin dis heißen, muss Ton 1 als his verstanden werden (Entsprechendes gilt für Ton 9).[16] Es steht außer Frage, dass spätestens seit der Entstehung der sogenannten »harmonischen Tonalität«[17] der Dur-Dreiklang von allen möglichen Dreiklängen als der verständlichste und damit als der einheitlichste aufgefasst wird. Diese historisch gewachsene Auffassung des Dur-Dreiklangs als einer Einheit kann dahingehend interpretiert werden, dass die ihn konstituierenden Töne und Intervalle nicht vermittelt werden müssen, sondern unmittelbar verständlich sind. Dementsprechend wären sowohl die große als auch die kleine Terz eines Dur-Dreiklangs, ich nenne sie ›quintgebundene‹ Terzen[18], unmittelbar verständliche Intervalle.[19]
Im Dekaton wäre nun, aufgrund der soeben formulierten Terz-Verständlichkeit, zum ersten Ton nicht nur der zehnte (c-es), sondern auch der neunte Ton (c-as) unmittelbar verständlich. Die Schlüssigkeit der Annahme, Terzen nur in Quintbindung als unmittelbar verständlich zu empfinden, zeigt sich beim erneuten Entfernen des zehnten Tons. Auf diese Weise würde die zuvor bestehende Nähe zwischen dem neunten und ersten Ton wieder erlöschen:
Abb. 4: Enneaton[20]
Im Enneaton, dem mit neun Tönen größten Quinttonfeld nach Simon, bleiben die Töne 1 und 9 eindeutig als c und gis bestimmt. Das Rahmenintervall c-gis kann nur als verminderte Quarte oder übermäßige Quinte, nicht jedoch als große Terz as-c oder gis-his aufgefasst werden. Dazu müsste das Intervall quintgebunden, also Bestandteil eines As- bzw. Gis-Dur-Dreiklangs sein. Im Enneaton fehlt dafür aber der notwendige Quint-Ton dis bzw. es, so dass kein Dur-Dreiklang und damit auch keine Umdeutung des Rahmenintervalls c-gis möglich ist. Sämtliche Töne des Enneatons bleiben daher eindeutig bestimmt.
Halten wir fest: Mit der Erweiterung einer Quintenreihe auf zehn Töne erfolgt ein ›Umschlag‹ sowohl in der Auffassung als auch in der Strukturierung der Töne. Dieses ›Umschlagen‹ von der Eindeutigkeit zur Ambivalenz ist zugleich ein Wechsel des strukturgenerierenden Intervalltyps von der Quinte zur Terz (gemeint ist die Quint-gebundene Terz); denn die Ambivalenz beruht auf der Fundierung eines Tonvorrats durch die Terz.
In der Herleitung des Tonfelds ›Konstrukt‹ aus dem Dekaton fehlt der letzte Schritt, die Reduktion der zehn Töne auf sechs. Anlass dazu gibt die bereits erwähnte ›einheitliche Auffassung der Töne‹, die eine Bedingung für das Zustandekommen eines Tonfelds darstellt. Im Sinne dieser einheitlichen Auffassung müssen diejenigen Töne des Dekatons beibehalten bzw. aus dem Dekaton herausgefiltert werden, die sich ausschließlich über das Terz-Prinzip zu einer distanziellen Struktur formieren.[21] Dabei kommen nur Töne in Frage, die sich jeweils zu einem geschlossenen (und somit distanziellen) Groß- oder Kleinterz-Zirkel zusammenfügen. Aus dem Dekaton können demnach zwei Großterz-Zirkel (c-e-gis und g-h-dis) und ein Kleinterz-Zirkel (c-a-fis-dis) herausgeflitert werden (s. Abb. 5). Der einzelne Kleinterz-Zirkel kann kein Tonfeld bilden, da seine Terzen aufgrund der fehlenden Quint-Bindung nicht unmittelbar verständlich sind. (Die Konstituierung aus unmittelbar verständlichen Intervallen ist ebenfalls eine Voraussetzung für ein Tonfeld.) Die beiden Großterz-Zirkel stehen jedoch im Abstand einer Quinte zueinander, wodurch die gewünschte Quintbindung eintritt: Die Terzen sind (als mögliche Bestandteile von Dur-Dreiklängen) unmittelbar verständlich. Die Ambivalenz des Dekatons kann somit auf die beiden Großterz-Zirkel c-e-gis und g-h-dis zurückgeführt werden. Allerdings kann sie auch nur auf diese Töne zurückgeführt werden, weil die verbleibenden Töne des Dekatons ausschließlich Quint- und nicht Terz-generiert sind und sich daher an der Ambivalenz nicht beteiligen. Unter der Bedingung der einheitlichen Ton-Auffassung sind diese Töne überflüssig und fallen weg. Damit ist das ›Konstrukt‹ aus dem Dekaton hergeleitet.
Abb. 5: Dekaton mit möglichen Terzen-Zirkeln, ›Konstrukt‹[22]
Mit dem Hendekaton, der rein theoretisch größtmöglichen Quintenreihe mit elf Tönen, kann nun in gleicher Weise verfahren werden. Hier ließen sich zwar mehrere Großterz-Zirkel im Quintabstand herausfiltern[23], doch einzig das Herausgreifen der beiden Kleinterz-Zirkel im Quintabstand lässt etwas Neues entstehen; denn nur in den acht Tönen c-a-fis-dis + g-e-cis-ais sind die Töne 1 und 11 enthalten. Damit ist die ›Funktion‹ aus dem Hendekaton hergeleitet.
Abb. 6: Hendekaton mit möglichen Terzen-Zirkeln, ›Funktion‹[24]
Zusammenfassung
Die unmittelbare Verständlichkeit der Terz ist an die Quinte gebunden (vgl. Fußnote 19). Aus dieser Abhängigkeit erklärt sich die Anzahl möglicher Tonfelder: Aus dem Quint-Prinzip alleine können beliebig große Strukturen hervorgehen. Das Quint-Prinzip kennt nicht das Kriterium der Vollständigkeit. Die Simonsche Begrenzung der Quintenreihen auf einen Umfang von maximal neun Tönen liegt nicht im Quint-Prinzip selbst begründet, sondern wird durch das Terz-Prinzip, das vom zehnten Ton an wirksam ist, gewissermaßen ›von außen‹ herangetragen.[25] Da das Terz-Prinzip nur in distanziellen Strukturen zum Tragen kommen kann, sind Terz-generierte Tonfelder vollständig.
Im Anschluss an die Herleitung der Simonschen Tonfelder lassen sich diese in einer Gesamtschau als ein stimmiges Ganzes darstellen. Aus der Kombination von Quinte und Terz sind drei Arten von Strukturen in Tonfeldern möglich:
Tonfelder, die allein auf dem Quint-Prinzip basieren (Triton und Tetraton)
Tonfelder, die auf dem Quint-Prinzip basieren, aber quintgebundene Terzen enthalten (Pentaton, Hexaton, Heptaton, Oktaton und Enneaton
Tonfelder, die auf dem Terz-Prinzip basieren (›Konstrukt‹, ›Funktion‹)
Abb. 7 lässt eine symmetrische Anordnung aller Tonfelder um das Heptaton herum erkennen. (In der Abbildung sind auch die Tonvorräte Monoton, Diton und Dodekaton, die keine Tonfelder darstellen, abgebildet. Die Tonfelder ›Konstrukt‹ und ›Funktion‹ werden an ihren ›Ursprungsorten‹ notiert.)
Abb. 7: Darstellung der Tonfelder im Hinblick auf die konstitutiven Intervalle Quinte und Terz
Das Heptaton entspricht der Diatonik, die das Bezugssystem unserer Ton-Auffassung bildet. Sie ist insofern vollkommen, als Quinten und Terzen in ihr zu gleichen Teilen vertreten sind: In ein Gerüst von drei Quinten c-g-d-a (dem Terz-freien Triton) werden drei Terzen (e-h-fis) eingefügt, für jede Quinte eine.[26] In den Quinttonfeldern ›vor‹ dem Heptaton, dem Pentaton und dem Hexaton, wird dieses Quintgerüst c-g-d-a nach und nach mit Terzen angereichert. Daher wenden sich diese Tonfelder zur Diatonik, zum Heptaton hin. Die Quinttonfelder ›nach‹ dem Heptaton, das Oktaton und das Enneaton, wenden sich dem gegenüber von der Diatonik ab und zu den ambivalenten Tonfeldern hin. Vom Oktoton an werden Ansätze einer Terz-Struktur sichtbar: Während im Heptaton sämtliche Dur-Dreiklänge im Quint-Abstand angeordnet sind (C-Dur, G-Dur, D-Dur), entsteht mit dem 8. Ton cis erstmals eine Terzbeziehung zwischen zwei Dur-Dreiklängen (A-Dur, C-Dur). Solche Terz-Beziehungen zwischen Dur-Akkorden führen mit dem zehnten Ton schließlich zu dem erwähnten ›Umschlagen‹ in die Ambivalenz und somit zur geschlossenen (distanziellen) Terz-Struktur.
Anmerkungen
Als wichtigste Beiträge wären zu nennen: Haas 2004, Polth 2006a, 2006b, 2007b, 2009, Rohringer 2009. | |
Ich bezeichne mit ›Quinttonfelder‹ diejenigen Tonfelder, die Bernhard Haas Quintenreihen genannt hat. | |
Der Anspruch einer systematischen Herleitung der Tonfelder knüpft an verwandte Theorien bei Ernö Lendvai und Zoltan Gàrdoniy an. Sowohl Lendvais Achsensystem wie auch Gàrdoniys Distanzielle Tonalität basieren auf Überlegungen zu übergeordneten Tonbeziehungen, die von den Autoren abstrakt und ohne Bezugnahme auf konkrete musikalische Zusammenhänge konstatiert werden (Lendvai 1993, Gàrdoniy 1989). Vgl. den Beitrag von Konstantin Bodamer in diesem Band. | |
Gárdonyi 1990, 156 und 194. | |
Ebd, 194. | |
Ebd. | |
Haas 2004, 11. | |
Cohn 2004. | |
Eine ausschließlich als fremd empfundene Ton-Auffassung ist ein Widerspruch in sich. | |
Natürlich erleben wir beim Hören nicht bloß den Ton ais/b, sondern sein gesamtes Umfeld als unheimlich-bedrückend (Cohn/Freud). Das Unheimliche strahlt auf den Gesamtcharakter des Schwanensee-Themas ab, lässt sich aber im Kern auf die Ambivalenz dieses Tones zurückführen. | |
Im vorliegenden Beispiel bilden die Akkord-Töne von h-Moll und g-Moll ein ›Konstrukt‹, wobei der Ton es fehlt. Das ›Konstrukt‹ blitzt auf im Moment des g-Moll-Akkordes. Als Hörexperiment spiele man zum übermäßigen Dreiklang ais-d-fis abwechselnd die Töne h und g. Dabei wechselt die Ton-Auffassung von ais nach b bzw. umgekehrt. | |
Die Oktave scheidet aufgrund der Oktavidentität als Tonvorrat-generierendes Intervall aus. | |
Dass ein Dekaton bzw. Hendekaton kein Tonfeld bildet, begründet Haas mit dem Argument, dass der komplementäre Rest (zwei Töne bzw. ein Ton) ebenfalls kein Tonfeld bildet (2004, 25). | |
›Diatonisch‹ im Sinne von ›oktavweise strukturiert‹. | |
Die Auffassung des zehnten Tones kann nur in seiner Beziehung zum ersten, dem ›gesetzten‹ Ton sinnvoll beschrieben werden. | |
Dass nicht entschieden werden kann, ob dieser Dreiklang als Gis-Dur oder As-Dur zu notieren ist, liegt im Wesen der Ambivalenz begründet: Wenn zuvor gesagt wurde, der zehnte Ton sei ambivalent, so ist damit gemeint, dass mit dem Eintreten des zehnten Tones grundsätzlich Ambivalenz entsteht. Sie existiert nicht etwa nur in diesem Ton, sondern bezieht alle Töne der distanziellen Struktur, der dieser zehnte Ton angehört und die es im Folgenden zu bestimmen gilt, in gleichem Maße mit ein. Allerdings kann sie in unserer diatonischen Notation immer nur an einer Stelle sichtbar gemacht werden. So muss z.B. beim Notieren einer Ganztonleiter willkürlich ein Intervall als verminderte Terz notiert werden. | |
Dahlhaus 1968. | |
Die quintgebundene Terzverständlichkeit wäre demnach der Grund, weshalb z.B. eine Ganztonleiter, obwohl sie aus großen Terzen besteht, kein Tonfeld sein kann. Die Ganztonleiter enthält keine Quinten, weshalb die in ihr enthaltenen Großterzen nicht quintgebunden und somit nicht unmittelbar verständlich sind. | |
Da ich mich hier nicht explizit auf Moritz Hauptmann beziehe, wird seine Terminologie der »direct verständlichen« Intervalle (1853, 21) bewusst vermieden. Hierzu ein kleiner Exkurs: Der Behauptung der Dualisten, die große Terz sei für sich ein direkt verständliches Intervall, ist nur bedingt zuzustimmen; denn die Direktverständlichkeit der Terz steht in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zur Quinte. Ob im metaphorischen oder konkreten Sinne, Hauptmanns Intervall-Dialektik basiert auf dem Aus-sich-Hervorgehen und In-sich-Aufheben der Intervalle: »Der Verbindung [Terz] muss die Trennung [Quint], der Trennung die Einheit [Oktav] vorausgegangen sein.« Und: »Die Terz erfüllt die Leere der Quinte, indem sie die getrennte Zweiheit dieses Intervalles zur Einheit verbunden in sich hält.« (ebd., 22) Damit geht die Quinte aus der Oktave, die Terz aus der Quinte hervor, im Terzintervall sind Oktav und Quinte »aufgehoben«. Diese Aufeinander-Bezogenheit muss auf die direkte Verständlichkeit der Intervalle übertragen werden: Die Terz ist nicht für sich alleine, als Abstand zweier Töne, sondern nur innerhalb der Quinte als Dreiklangs-Ton aufzufassen. Nicht das Terz-Intervall (2 Töne) ist direktverständlich, sondern die ›quintgebundene‹ Terz im Dreiklang (3 Töne). Hauptmanns Intervallbegriff Oktav, Quint und Terz – als Abstand zweier Töne – verfehlt somit, in Bezug auf die Direktverständlichkeit dieser Intervalle, das eigentlich Gemeinte: Die Oktav meint nur einen Ton (aufgrund der Oktavidentität sind die jeweiligen Oktav-Töne eines einzelnen Tones in diesem bereits enthalten), die Quinte zwei (Intervall) und die Terz drei Töne (Akkord). | |
Die Bezeichnung der Terz-Töne mit Kleinbuchstaben geht auf Moritz Hauptmann (1853) zurück, nicht aber deren Anordnung in einem Quintenkreis. | |
Die Vorstellung eines Tonfeldes als Resultat eines Filterungsvorganges aus einer größeren Tonmenge stammt von Haas, der schreibt, man könne »Funktion und Konstrukt als aus der vollständigen Quintenreihe herausgefiltert auffassen« (2004, 32). | |
In jeder distanziellen Struktur muss aus notationstechnischen Gründen wenigstens ein Ton enharmonisch notiert werden, damit die unmittelbar verständlichen Intervalle als solche sichtbar bleiben. In Abb. 3 ist die Wahl des enharmonisch notierten Tones his/c willkürlich. | |
Zwischen dem ersten und zehnten Ton entsteht das vormalige ›Konstrukt‹ (die beiden Großterz-Zirkel c-e-gis + g-h-dis), zwischen dem zweiten und elften Ton dasselbe ›Konstrukt‹ als Quint-Transposition (g-h-dis + d-fis-ais). Die Überlagerung beider ›Konstrukte‹ entspricht Messiaens 3. Modus (als Skala: c-d-dis-e-fis-g-gis-ais-h-c). Dieser kann jedoch nicht als Tonfeld aufgefasst werden, weil in ihm keine einheitliche Auffassung der Töne besteht: Jeweils drei quintverwandte Töne formieren sich zu einem Quinttonfeld (die drei Tritone c-g-d, e-h-fis, gis-dis-ais). Somit überlagern sich in Messiaens 3. Modus Quint- und Terz-generierte Strukturen. | |
Zur enharmonischen Notation s. Fußnote 22. | |
Die andere Begrenzung ist dem einfachen Umstand geschuldet, dass eine ›Struktur‹ aus mindestens zwei Elementen (also zwei Quinten bzw. drei Töne) bestehen soll. | |
Sogenannte Terz-Töne in Tonfeldern sind immer auch Quint-Töne. Die begriffliche Reduktion auf die Terz-Verständlichkeit dieser Töne erfolgt aufgrund der hier beabsichtigten Differenzierung der Tonfelder aus Sicht der Terz. |
Literatur
Cohn, Richard (2004), »Uncanny Resemblances: Tonal Signification in the Freudian Age«, Journal of the American Musicological Society 57/2, 285–323.
Dahlhaus, Carl (1968), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität (= Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft 2), Kassel u.a.: Bärenreiter.
Gárdonyi, Zsolt / Hubert Nordhoff (1989), Harmonik, Wolfenbüttel: Möseler.
Haas, Bernhard (2004), Die neue Tonalität von Schubert bis Webern, Wilhelmshaven: Noetzel.
Handschin, Jacques (1948), Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie, Zürich: Atlantis 1948 [Reprint der 1. Auflage, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995].
Hauptmann, Moritz (1853), Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Lendvai, Ernö (1993), Symmetries of Music: an introduction to semantics of music, Kecskemét: Kodály Institute.
Polth, Michael (2001), »Nicht System – nicht Resultat. Zur Bedeutung von harmonischer Tonalität«, Musik & Ästhetik 18, 12–36.
––– (2006a), »Tonalität der Tonfelder: Anmerkungen zu Bernhard Haas ›Die neue Tonalität von Schubert bis Webern. Hören und Analysieren nach Albert Simon‹«, ZGMTH 3/1, Hildesheim u.a.: Olms, 167–178. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/210.aspx
––– (2006b): »In den Freiräumen der Schenkerschen Tonalität: Harmonische Effekte durch Tonfelder in der Prager Sinfonie«, Dutch Journal of Music Theory 11/3, 151–163.
––– (2007a), »Zum Verhältnis zwischen Satztechnik und musikalischem Zusammenhang: Bemerkungen zu einer Sequenz in Bruckners 6. Symphonie«, in: ›Vom Erkennen des Erkannten‹. Musikalische Analyse und Editionsphilologie. Festschrift für Christian Martin Schmidt, hg. von Thomas Ahrend, Heinz von Loesch und Frederike Wißmann, Wiesbaden u.a.: Breitkopf & Härtel, 335–344.
––– (2007b), »Satztechnische Modelle und moderne Tonalität. Zu einem Archaismus in Bruckners d-Moll-Messe«, in: Bruckner-Tag Mannheim 2006: Anton Bruckner – Die geistliche Musik (= Bruckner-Vorträge), hg. von Rainer Boss, Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag, 47–64.
––– (2009), »Atonalität und musikalischer Zusammenhang in Weberns Orchesterstück op. 6 Nr. 3. Ein Beitrag zur Theorie der Tonfelder von Albert Simon«, Jahrbuch 2008/2009 des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, Mainz u.a.: Schott, 87–121.
Rohringer, Stefan (2009), »Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen. Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898«, ZGMTH 6/2–3, Hildesheim u.a.: Olms, 273–308. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/458.aspx
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.