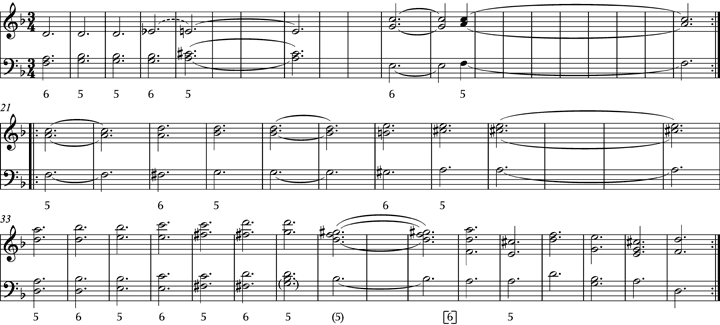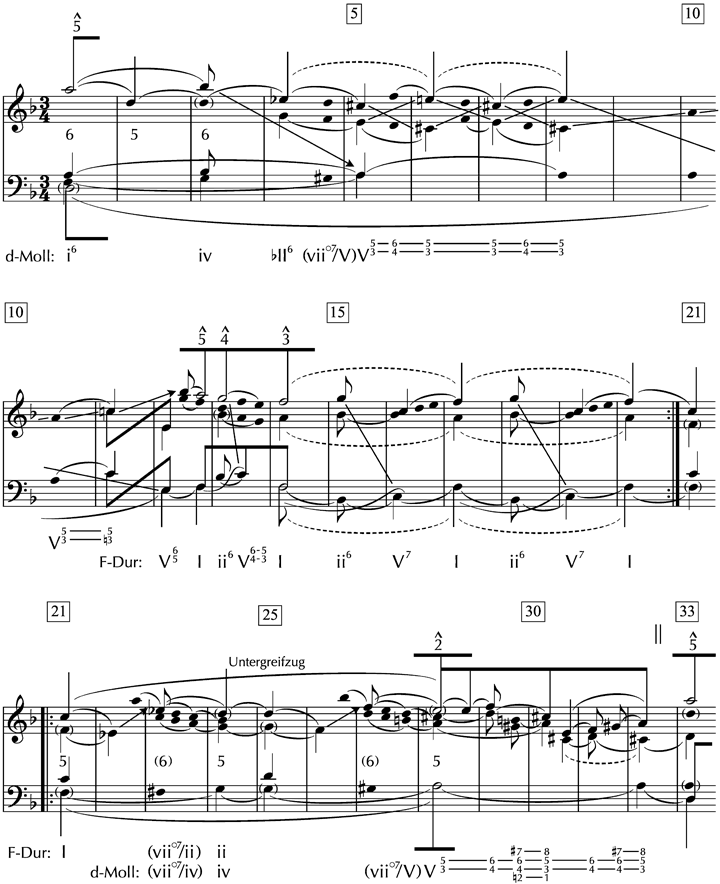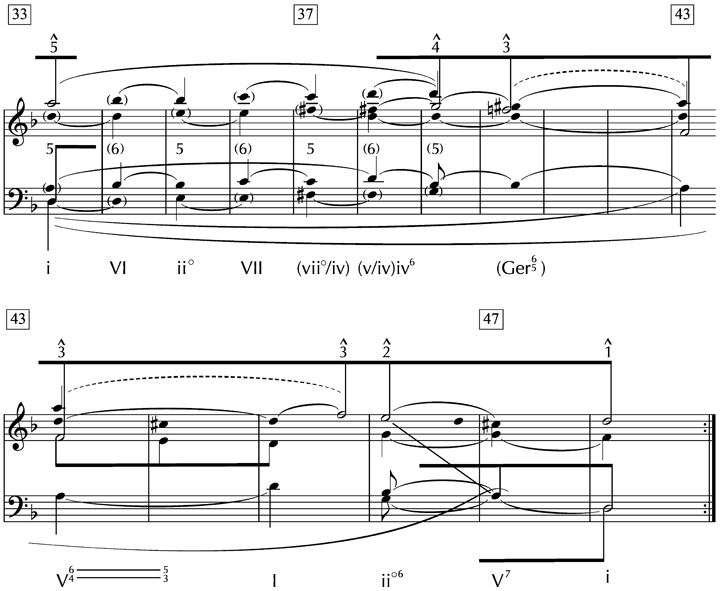Haydn, Schenker, Schönberg
Ein Beitrag zur Eklektizismusdebatte in der Musiktheorie[1]
Oliver Schwab-Felisch
Unterschiedliche analytische Verfahren in der Praxis miteinander zu kombinieren wird durch die Unzulänglichkeiten bestehender Theorien und die Komplexität musikalischer Kompositionen nahegelegt, birgt aber eine Reihe methodologischer Schwierigkeiten. Der Beitrag zeigt dies anhand einer Analyse des III. Satzes aus Joseph Haydns Symphonie in d-Moll Hob. I:26. Er verwendet die Schenkerianische Kategorie der logischen Genese zur analytischen Rekonstruktion eines immanent widersprüchlichen satztechnischen Komplexes und zeichnet die Entstehung eines Narrativs nach, das neben anderen satztechnischen Momenten auch die Schenkersche Struktur integriert. In der methodologischen Reflexion freilich wird deutlich, dass eine derartige Integration gegen Grundprinzipien der beteiligten Theorien verstößt, eine Verknüpfung also nicht ad hoc, sondern nur im Zuge von Theoriebildung geleistet werden kann.
Combining different analytical methods seems to be a natural consequence of the shortcomings of existing theories and the complexity of musical compositions. However, this approach involves a series of methodological difficulties. The article illustrates this by performing an analysis of the third movement of Joseph Haydn’s Symphony No. 26 in d-minor Hob. 1:26. The analysis uses the Schenkerian category of ‘logical genesis’ in order to reconstruct an immanently contradictory structural complex. It traces the emergence of a narrative that, in addition to other compositional aspects, also integrates Schenkerian structure. Methodological reflexion, however, shows that integration of this kind contravenes basic principles of the participating theories. It turns out that a combination of different analytical approaches cannot be achieved ad hoc, but only in the course of theory-building.
Die ästhetische Einheit des musikalischen Gegenstands tritt in der Reflexion in eine Vielzahl von Einzelmomenten auseinander. Zu deren Beschreibung steht keine einheitliche Theorie, sondern nur ein Bündel höchst heterogener Begriffs- und Regelsysteme zur Verfügung – Ergebnis der traditionellen Einteilung der Musiktheorie in einzelne Subdisziplinen ebenso wie der Ausdifferenzierung analytischer Methoden im 20. und 21. Jahrhundert. Wer die Momente eines Werkes in ihrer wechselseitigen Bezogenheit zu beschreiben sucht, kann sich somit vor das Problem gestellt sehen, Zusammenhang durch die Verknüpfung von Unvereinbarem herstellen zu müssen.[2] Dies gilt insbesondere dann, wenn das deskriptive Instrumentarium spezifischer ist als die ›musiktheoretische Umgangssprache‹[3] und das analytische Vorgehen nicht von vornherein einem bestimmten Verfahren folgt.
Die Kombination heterogener analytischer Verfahren ist in der Musikwissenschaft wohl am eingehendsten durch die Theorie der ›multivalenten Analyse‹ methodologisch reflektiert worden – ein Verfahren, das zunächst im Kontext der Opernforschung diskutiert und Anfang der 1990er Jahre von James Webster auf Instrumentalmusik übertragen wurde.[4] Analyse gilt Webster als multivalent, wenn sie die Dimensionen eines Werks unabhängig voneinander erschließt und darauf verzichtet, die Resultate am Maßstab eines vorgängigen Einheitsprinzips auszurichten. Ausdrücklich zugelassen ist damit die Möglichkeit, dass jede Teilanalyse zu einem anderen Ergebnis kommt, etwa im Hinblick auf die Segmentierung einer Komposition. Websters Analysen akzentuieren die Momente des Offenen, Vielschichtigen, Gebrochenen. Die Grundlage dieses Ansatzes bilden Einwände gegen Einheit und Kohärenz, wie sie die ›New Musicology‹ im Anschluss an den französischen Poststrukturalismus seit etwa der Mitte der 1980er Jahre geprägt haben. So argumentierte Jean-François Lyotard, das Prinzip der Einheit verstoße gegen die Gleichberechtigung der heterogenen Perspektiven, wie sie durch inkommensurable Sprachspiele erzeugt werden.[5] Die Übertragung dieser Argumentation auf Musikanalyse befreit zwar von der genuin positivistischen Forderung nach Einheit der Methode[6], zieht aber charakteristische Beschränkungen nach sich. Websters Analysen tendieren dazu, bei der Feststellung separater analytischer Resultate zu verharren. Den »Wechselwirkungen«[7] der musikalischen Momente nachzugehen hieße aber nicht allein, Übereinstimmungen zwischen unterschiedlichen Beschreibungen zu konstatieren, sondern auch, die intrinsischen Bestimmungsprozesse aufzudecken, über die sich die Strukturen geformt haben – anders gesagt: Sprachspiele zu finden, die über die Grenzen bestehender Sprachspiele hinweg lokale Kohärenzen herstellen.
Eben diese Aufgabe führt auf die Frage nach der Vereinbarkeit theoriegeleiteter Deskriptionen. Hierbei gilt es technische wie ästhetische Aspekte zu berücksichtigen. So hat Gianmario Borio den Versuch Janet Schmalfeldts kritisch durchleuchtet, die Verfahren Schenkers und Schönbergs miteinander zu ›versöhnen‹. Borio kann zeigen, dass die Verfahren in einem konkreten Fall zwei Beschreibungen liefern, die den Gegenstand auf zwei unvereinbare Weisen segmentieren.[8] Und Carl Dahlhaus betonte 1985, »das Unterfangen, die Methoden Schenkers, Schönbergs und Riemanns zu kombinieren« sei »eklektisch in des Wortes schlimmster Bedeutung, weil die ästhetischen Prämissen, von denen die Grundkategorien ›Ursatz‹, ›entwickelnde Variation‹ und ›harmonisch-metrische Periode‹ getragen werden, schlechterdings unvereinbar sind.«[9] Wer musikalische Momente in ihrer wechselseitigen Bezogenheit erforschen möchte, hat sich diesen Einwänden zu stellen. Es scheint, als sei eine tragfähige Lösung nicht über die fallweise Kombination verschiedenartiger analytischer Verfahren, sondern allein im Rahmen von Theoriebildung zu finden, in einem Kontext also, der, wo erforderlich, die ›rationale Rekonstruktion‹ der selektierten Theorien[10], die Abstraktion allgemeiner Prinzipien und die Konstruktion eines übergreifenden Theorieraums gestattet. Ein Beispiel gibt die Generative Theory of Tonal Music Fred Lerdahls und Ray Jackendoffs, die bestimmte Grundgedanken der Schichtenlehre Heinrich Schenkers mit Ansätzen aus Musiktheorie, Gestaltpsychologie, Kognitionswissenschaft und Linguistik verbindet, die aber, insofern sie ihre Komponenten verändert, neu begründet und in einen eigenen Systemzusammenhang stellt, etwas anderes als eine bloß synkretistische Fügung darstellt.[11] Eine solche – notwendig wiederum partikuläre – Theorie, die der Interaktion der musikalischen Momente über den Rahmen etablierter Strukturtheorien hinaus nachzugehen versuchte, ist zur Zeit nicht erkennbar. Vorauszugehen hätte ihr eine Exploration des analytischen Potentials, das der Verbindung bestimmter bislang als unvereinbar geltender Herangehensweisen innewohnt. Eben dies versucht dieser Text zu leisten.[12] Sein Aufbau folgt einem einfachen Prinzip. Pro Abschnitt wird zuerst je eine knappe Teilanalyse gegeben, danach folgt je ein methodologischer Kommentar. Zwei Exkurse thematisieren Aspekte der Begriffe der musikalischen Logik und musikalischen Kausalität.
Die Komposition, um die es gehen soll, ist der dritte und zugleich letzte Satz aus Joseph Haydns wahrscheinlich 1768 entstandener Sinfonie Nr. 26 in d-Moll (Beispiel 1), ein Menuett. Die Sinfonie trägt den Beinamen Lamentatione; erster und zweiter Satz verwenden liturgische Choralzitate aus den während der Karwoche aufzuführenden Passions- und Lamentationsgesängen.[13] Das Menuett enthält keine musikalischen Zitate; sein Bezug auf die Semantik der ersten zwei Sätze liegt in seiner Ausdrucksqualität. James Webster betont seine ›drückende Stimmung‹[14], Ludwig Finscher nennt es ›traurig‹ und hebt das Seltsame der Satzfolge hervor.[15] Auch der vorliegende Text wird Bedeutungsaspekte ansprechen, sie aber aus der immanenten Analyse entwickeln und darauf verzichten, eine Verbindung zur Semantik der ersten zwei Sätze herzustellen.
Beispiel 1: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz
Modell
Analyse
Die ersten acht Takte des Menuetts lassen sich als figurierte Instanz[16] einer ansteigenden 5-6-Progression verstehen (Beispiel 2).[17] Eine zweite 5-6-Progression beginnt mit dem C-Dur-Quintsextakkord in den Takten 11/12 (hier als Sextakkord dargestellt), wird in der ersten Hälfte des kontrastierenden Mittelteils chromatisch erweitert (Takte 21–28) und endet mit einem auskomponierten Halbschluss in der Ausgangstonart (Takte 28–32, hier in Quintlage). Der A’-Teil nimmt die 5-6-Progression des Anfangs in veränderter satztechnischer Darstellung wieder auf und führt sie über eine Kadenz zum Schluss.
Beispiel 2: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz; vorläufige analytische Reduktion
Kommentar
Das strukturelle Material dieses Menuetts ist ungewöhnlich einheitlich: Jede seiner Harmonien (bis auf jeweils zwei Harmonien am Ende des A-Teils und des A’-Teils) ist Teil einer von insgesamt drei aufeinanderfolgenden Instanzen der 5-6-Progression. Allerdings liegen die Konstituenzien des Satzmodells nicht immer offen zutage, sondern müssen aus den Figurationen des Tonsatzes rekonstruiert werden.[18] Rekonstruktionen dieser Art spielen in diesem Text eine wichtige Rolle. Ihren epistemologischen Grundlagen soll daher in einem eigenen Exkurs nachgegangen werden.
Exkurs 1: Zum Begriff der ›logischen Genese‹
Die heterogenen Logikbegriffe, die Adolf Nowaks ebenso grundlegende wie umfassende geschichtliche Darstellung des Begriffs musikalischer Logik behandelt[19], lassen sich denkbar grob in zwei Kategorien einteilen. Auf der einen Seite stehen Auffassungen des musikalisch Logischen als einer Relation zwischen aufeinanderfolgenden musikalischen Ereignissen: Zu ihnen zählen Riemanns dialektische Logik der Kadenz, Schönbergs Begriff einer motivischen Logik oder Adornos »Schlussverfahren ohne Begriff und Urteil«.[20] Auf der anderen Seite finden sich Konzepte, die das musikalisch Logische als Beziehung zwischen gleichzeitigen musikalischen Einheiten behandeln. Forkels Bestimmung musikalischer Logik[21] ist die vermutlich bekannteste von ihnen. Um eben diese letzte Kategorie soll es in diesem Exkurs gehen. In Anlehnung an Forkels Bestimmung lässt sich Harmonik als ein Feld auffassen, das die Objekte, die in ihm zu liegen kommen, auf eine bestimmte Weise organisiert: Die Töne einer Harmonie bestimmen, was als Konsonanz und Dissonanz zu gelten hat, sie bestimmen darüber hinaus auch, welche Töne ohne besondere Vorkehrungen erreicht und verlassen werden können und welche anderen eben solcher Vorkehrungen bedürfen. Melodietöne unterscheiden sich voneinander dadurch, dass sie entweder mit Harmonietönen zusammenfallen oder nicht, und die Regeln der Stimmführung besagen im Wesentlichen, wie die einen mit Rücksicht auf die anderen zu behandeln sind. Heinrich Schenkers Begriff musikalischer Logik nun – ein Begriff im Übrigen, den Nowaks Darstellung unbeschadet ihrer sonstigen Qualitäten verfehlt[22] – ist im gegebenen Zusammenhang insofern von Interesse, als er Forkels Logikbegriff der Idee nach aufgreift und um eine Feldbestimmung ergänzt, welche die Reihenfolge der feldkonstitutiven Töne festlegt. In Der freie Satz beschreibt Schenker das Verhältnis benachbarter Schichten als »streng logische Bestimmtheit im Zusammenhang einfacher Tonfolgen mit komplizierten«.[23] Die »logische Bestimmtheit«, die Schenker meint, stützt sich implizit auf die philosophiegeschichtlich alte Unterscheidung des logisch Früheren und Späteren. ›Logisch früher‹ heißt ein Sachverhalt x gegenüber einem Sachverhalt y, wenn der Begriff des Sachverhalts y den Begriff des Sachverhalts x voraussetzt (so dass Sachverhalt x ohne Sachverhalt y bestehen kann, umgekehrt Sachverhalt y aber nicht ohne Sachverhalt x).[24] Was das im Hinblick auf die Sachverhalte bedeutet, die Schenkers Logikbegriff meint, lässt sich anhand der Relation zwischen Modell und Variante exemplifizieren. Wer zuerst ein Modell wahrnimmt und danach eine Variante, kann an der Variante Merkmale unterscheiden, die zum Modell gehören und andere, die nur der Variante zu eigen sind. Die Merkmale des Modells können als logisch früher, die der Variante als logisch später bezeichnet werden: Zur Bestimmung des Begriffspaars ›Modell und Variante‹ gehört es, dass die Variante ohne ihr Modell nicht zu existieren vermag, das Modell ohne seine Variante aber sehr wohl.[25] Enthält das Modell einen Ton ›c‹[26] und die Variante die Umspielung des Tons ›c‹ durch die Töne ›d‹ und ›h‹, ist unmittelbar evident, dass das Vorkommen der umspielenden Töne (als umspielende Töne) den umspielten Ton logisch voraussetzt: Enthielte das Modell keinen Ton ›c‹, entfiele der Bezugspunkt der Umspielung.
Die Differenz zwischen Variante und Modell erscheint demjenigen Betrachter der Variante, der das Modell kennt. Nur wenige musikalische Strukturen freilich sind explizite Variationen bekannter Modelle. In den meisten Fällen entfällt damit dasjenige, was oben als die Bedingung der Unterscheidung logisch früherer und logisch späterer Momente angegeben worden war, nämlich die Kenntnis eines Modells. Gleichwohl kann man an nahezu beliebigen tonalen Strukturen logisch frühere und logisch spätere Momente unterscheiden. Der Grund besteht darin, dass eine solche Unterscheidung bereits auf der Grundlage einer Differenz von Komplexität möglich ist. In ein und derselben Struktur durchdringen sich einfachere und weniger einfache Strukturen. Dabei ist eine strukturell einfachere Variante ein und derselben Struktur gegenüber einer strukturell komplizierteren immer auch die logisch frühere. Während in Exemplaren der Gattung ›Variationen‹ auch Vereinfachungen des logisch Früheren, des Themas, vorkommen – man denke an die XX. Variation der Beethovenschen Diabelli-Variationen[27] – sind simultane Variationen notwendig Komplizierungen: Etwas kommt hinzu, etwas wird im Tonraum oder der Zeit verschoben. Der Grund ist wiederum ein logischer: Da im Komplexeren das Einfachere enthalten ist, nicht aber im Einfacheren das Komplexere, kann man analytisch aus dem Komplexeren auf das Einfachere schließen, nicht aber aus dem Einfacheren auf das Komplexere. Komplizierungen sind über bestimmte Regeln mit den einfacheren Strukturen verknüpft, die sie variieren oder elaborieren. Dies lässt sich anhand eines Ausschnitts aus Beispiel 1 demonstrieren.
Der Abwärtssprung ›c‹-›es‹ in den Takten 21/22 des Haydnschen Menuetts ist motivisch begründet: Er antwortet auf die (mit Sekundschritten ausgefüllte) fallende Sexte ›c‹-›e‹ in den Takten 10/11. Die Schlussharmonie in Takt 20 ist F-Dur. Der Ton ›c‹ ist Teil der F-Dur-Harmonie. Der Ton ›es‹ liegt einen Ganzton unter dem Grundton der F-Dur-Harmonie und bildet mit deren Tönen einen Dominantseptakkord. Denkt man den Ton F als liegend[28], entsteht eine lineare Verbindung von F nach Es. Nun wird der Ton Es in der großen Oktave nicht weitergeführt. Da die Weiterführung qua Satzregel verlangt ist, ist davon auszugehen, dass die Tonqualität ›es‹ in einer anderen Oktavlage sekundweise abwärts geführt wird. In gewisser Hinsicht ist dies in Takt 23 der Fall: Die Oberstimme springt von a2 zu es2 und fällt weiter zu d2. Allerdings lässt sich zeigen, dass die strukturelle Auflösung erst in Takt 24 erfolgt. Der Basston Fis in Takt 23 folgt unmittelbar auf Es in Takt 22. Zwischen beiden Tönen besteht keine lineare Verbindung. Verlängert man den virtuellen Liegeton F über Takt 21.2 hinaus bis zu Takt 22.3 (was der Harmonie entspricht), erweist sich der Schritt zu Fis als chromatischer Halbtonschritt. Fis fungiert als Basston eines zwischendominantischen verminderten Septakkordes. Dessen Akkordtöne es2 und c2 werden in der Oberstimme melodisch verknüpft. Der Ton d2 in Takt 23 stellt mithin einen Durchgang von lediglich lokaler Bedeutung dar. Der Ton es2 bleibt aktiv, bis der verminderte Septakkord in Takt 24 in den g-Moll-Akkord übergeht. Gleichwohl setzt der Ton d2 auf einer früheren Schicht bereits in Takt 23 ein: Der Ton es2, die Septime des verminderten Septakkordes, ist nicht harmonisch, sondern melodisch motiviert: Er verbindet den Grundton der F-Dur-Harmonie, mit welcher der B-Teil beginnt, mit dem Grundton d2 des Quintsextakkordes über Fis. Der Durchgang, den er darstellt, vollzöge sich im Normalfall in Seitenbewegung zum Liegeton F. Dass er hier über dem Basston Fis erscheint, verdankt sich einer horizontalen Verschiebung; seine Verfestigung zum Akkordton beruht auf einer Dehnung auf die Länge eines Taktes. Auf Grundlage dieser Überlegungen lässt sich ein Diagramm erstellen, das die logische Genese der Takte 21–24 in ihrer vorliegenden Gestalt in sechs aufeinanderfolgenden Schritten nachzeichnet (Beispiel 3a–f).
Beispiel 3: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz, T. 21–24; sechsstufige Rekonstruktion der ›logischen Genese‹
Eine Rekonstruktion der logischen Genese eines musikalischen Abschnitts zeigt also, wie aus einem Einfachen durch schrittweise Veränderung ein Kompliziertes wird. Das Bild einer solchen Genese kann viele Schritte umfassen, und das Einfache, von dem sie ausgeht, unterscheidet sich bisweilen sehr viel deutlicher von ihrem Resultat als dies im vorangegangenen Beispiel der Fall ist. Wer mit der Logik reduktiver analytischer Verfahren nicht vertraut ist, könnte nun auf den Einwand verfallen, eine rekonstruktive Analyse treffe Aussagen über den Schaffensprozess, deren propositionaler Gehalt weder empirisch nachweisbar noch – allen Erfahrungen mit Dokumenten kompositorischer Schaffensprozesse nach – überhaupt nur wahrscheinlich sei; die Rede von der ›logischen Genese‹ sei folglich als Versuch einzuschätzen, ein der Sache nach unhaltbares analytisches Procedere terminologisch zu nobilitieren. Dieser Einwand, so sollte nach dem bisher Gesagten klar sein, beruht auf einem schlichten Missverständnis. Das logisch Frühere ist vom empirisch Früheren zu unterscheiden: Ein musikalischer Einfall impliziert für gewöhnlich ungeachtet der Tatsache, dass er ›innerhalb eines Augenblicks‹ erfasst wird, unterschiedliche logische Zeiten. Rekonstruktive Analyse beabsichtigt mithin alles andere als die Erhellung der empirischen Vorgänge, die der Entstehung einer Komposition zugrunde gelegen haben. Auch wenn das, was ein Komponist getan oder zu tun beabsichtigt hat, für das Verständnis einer Komposition von Interesse sein kann[29], ist es doch für das Verständnis der logischen Dependenzen der komponierten Strukturen nicht von Bedeutung.
Struktur
Analyse
Beispiel 4 veranschaulicht die übergeordneten Prinzipien, denen die Verknüpfung der 5-6-Progressionen gehorcht. Wie der Vergleich mit Beispiel 2 zeigt, schlägt sich die lineare Stimmführung der 5-6-Progression primär im Bass des Menuetts nieder. Der ungewöhnliche, wenn auch nicht singuläre Beginn mit einem Sextakkord[30] erfordert es, den ersten Basston im Graphen als impliziten Ton zu notieren: Der strukturelle Basston ›d‹ erklingt zwar nicht in der großen Oktave, wird aber von den Hörnern intoniert und zudem durch den harmonischen Zusammenhang der ersten 8 Takte klar ausgedrückt. Vom Basston ›f‹ (der vom strukturellen Basston ›d‹ aus gesehen eine Mittelstimme darstellt), schreitet die 5-6-Progression bis zur V. Stufe der Haupttonart (Takte 5–8). Diese V. Stufe wirkt sich auf die anschließende Fortschreitung nicht aus: Funktionsharmonisch gesprochen folgt anstelle der Tonika d-Moll unvermittelt die Zwischendominante zur Tonikaparallele F-Dur (Takte 10–11). Wie das Diagramm zeigt, ist der C-Dur-Sextakkord, der die Funktion der Zwischendominante zur Tonikaparallele instantiiert, durch einen steigenden Sekundschritt mit dem impliziten strukturellen Basston ›d‹ verknüpft. Der Sprung von der Quinte ›a-e‹ (Bass und Oberstimme in den Takten 5–8) in die Sexte ›e-c‹ (jeweils die erste Zählzeit der Takte 11 und 12) ist mithin durch eine übergeordnete Linearität motiviert, die im impliziten Basston ›d‹ ihren Ausgang nimmt. In den Takten 33–48 folgt eine Wiederholung des linearen Aufstiegs von ›d‹ zu ›a‹, wobei der zuvor implizite Basston ›d‹ nun explizit zur Darstellung kommt.
Beispiel 4: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz, Analyse nach Heinrich Schenker
Kommentar
Das in Beispiel 4 gegebene analytische Diagramm beleuchtet einen Teil der harmonischen, linearen und registralen Bestimmungen, die bei der Einbettung der drei Instanzen der 5-6-Progression in ihren tonalen Kontext vorgenommen wurden; die dazugehörige wortsprachliche Analyse erläutert strukturelle Aspekte der ersten Takte des Menuetts.[31] Das Verhältnis zwischen Schichtenlehre und historischen Satzmodellen ist (in technischer Hinsicht) eines der Inklusion: alle Informationen, die Beispiel 2 enthält, finden sich auch in Beispiel 4; umgekehrt qualifiziert und ergänzt Beispiel 4 Beispiel 2.[32]
Widerspruch als Setzung
Analyse
Bei genauerer Betrachtung der ersten Takte des Menuetts erschließt sich eine weitere Beschreibungsebene. Die virtuell mehrstimmige Oberstimme der Takte 1–4 pendelt zwischen zwei strukturellen Stimmen: der oberen ›a2-b2‹ und der unteren ›d2-es2‹. Die obere Stimme ist das Resultat einer Hochoktavierung der Mittelstimme der 5-6-Progression, die untere entspricht deren Oberstimme. Die Hochoktavierung erzeugt eine sekundäre ›5-6-Progression‹ zwischen der oberen und der unteren Stimme (Beispiel 5c).
Beispiel 5: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz, T. 1–4; 5-6-Progression a) in enger Lage, b) mit Hochoktavierung von Ober- und Mittelstimme, c) mit zweiter Hochoktavierung der Mittelstimme und resultierender sekundärer 5-6-Progression
In dieser sekundären ›5-6-Progression‹ erklingen Terz- und Sextton eines Terz-Sext-Klangs der primären ›5-6-Progression‹ als Quinte und Basston eines Terz-Quint-Klangs, Terz- und Quintton eines Terz-Quint-Klangs der primären ›5-6-Progression‹ als Sext- und Basston eines Terz-Sext-Klanges. Primäre und sekundäre 5-6-Progressionen teilen sich mithin dieselben Töne. Vergleichen wir ihre Eigenschaften. Die primäre 5-6-Progression ist durchgehend dreistimmig gesetzt, beschreibt mit der Harmoniefolge I6-IV-bII6-V eine reguläre Kadenzformel, setzt sich fort bis zum Halbschluss auf der Dominante A-Dur und liefert die Basstöne der ersten 8 Takte. Die sekundäre 5-6-Progression dagegen bezieht den Bass des Menuetts nicht mit ein und verläuft lediglich zweistimmig. Eben dies markiert ihren Status als bloßes Epiphänomen: Da der Ton ›f‹, der die Töne ›b‹ und ›d‹ zum Sextakkord ergänzte, mit dem Ton ›g‹ der primären ›5-6-Progression‹ nicht vereinbar wäre, muss die sekundäre 5-6-Progression auf ihre Mittelstimme verzichten. Allerdings leidet die primäre 5-6-Progression unter einem gravierenden Manko: Sie exponiert weder den Grundton des Tonikadreiklangs noch den Kopfton des Urlinie-Quintzuges – eben jene Töne also, die durch die sekundäre 5-6-Progression dargestellt werden (vgl. Beispiel 5c). Struktureller und realer Bass sind demnach auf zwei verschiedene satztechnische Komplexe verteilt. In einer vorläufigen Formulierung kann gesagt werden, dass in eben dieser Inkongruenz der Grundwiderspruch dieses Satzes besteht. Von einem Grundwiderspruch lässt sich insofern sprechen, als – so wird im weiteren Verlauf der Analyse deutlich werden – der Ablauf des Menuetts als Spur des Versuchs beschrieben werden kann, eine Lösung dieses Widerspruchs herbeizuführen.
Kommentar
Ein logischer Widerspruch liegt vor, wo einer Aussage und ihrer Negation derselbe Wahrheitswert zugesprochen wird. Musik kennt keine Aussagen im Sinne der Aussagenlogik, sondern allein Elemente und Relationen.[33] Gleichwohl ist der Begriff des Widerspruchs in der Musiktheorie höchst gebräuchlich – zumal dann, wenn man Begriffe wie ›Unruhe‹, ›Konflikt‹, ›Problem‹, ›Ungleichgewicht‹ oder ›Mangel‹ in bestimmten Hinsichten als Synonyme zu akzeptieren bereit ist.[34] Die terminologische Diskussion, derer die Verwendung des Begriffs des Widerspruchs in der Musiktheorie bedürfte, kann hier nicht geleistet werden; dessen unbeschadet sollen im Folgenden drei Arten musikalischer Widersprüche unterschieden werden.
Die erste Art umfasst Widersprüche zwischen einer musikalischen Konstellation und einem Hintergrund. Als Beispiel ließe sich das ›tonale Problem‹ im Schönbergschen Sinne anführen, wie es etwa Severine Neff bei Schubert als Widerspruch zwischen der Haupttonart und der durch bestimmte Töne ausgelösten Tendenz lokaler Prozesse zu anderen Tonarten analysiert hat.[35] Auch abstrakte Normen und Regeln können in gewissem Sinn als ›Hintergrund‹ fungieren: Vor dem Hintergrund des Gebots eines regelrechten Satzes erscheint eine Quintparallele (wiederum in gewissem Sinn) als Widerspruch.
Die zweite Art umfasst Widersprüche zwischen zwei aufeinanderfolgenden musikalischen Konstellationen. Schönbergs Begriff der ›Unruhe‹ etwa meint generell die Störung eines Ersten durch ein kontrastierendes Zweites;[36] auch die ›Dissonanz‹ zwischen einem etablierten und einem folgenden konfligierenden Metrum fällt in diese Kategorie.[37]
Die dritte Art umfasst Widersprüche zwischen zwei gleichzeitigen unterschiedlichen Bestimmungen ein und desselben Gegenstandes. Moritz Hauptmanns dialektische Bestimmung der Tonart wäre hier ebenso zu nennen wie Hugo Riemanns dialektische Logik der Kadenz.[38]
Vor dem Hintergrund dieser traditionellen Bestimmungen musikalischer Widersprüche erscheint Haydns 5-6-Verschachtelung besonders intrikat. In ihr verwirklicht sich kein allgemeines Prinzip (wie bei Riemanns Begriff der Kadenz), sondern eine individuelle Konstellation (wie bei Schönbergs Idee des intitialen Widerspruchs). Während aber in der Literatur vornehmlich Widersprüche zwischen sukzessiven individuellen Konstellationen diskutiert wurden, liegt hier der seltene Fall eines multiplen Widerspruchs zwischen simultanen Konstellationen vor – eines Widerspruchs zwischen unterschiedlichen harmonischen Bestimmungen (d-Moll- vs. F-Dur-Progression), zwischen harmonischer Bestimmung und satztechnischer Funktion (Grundton von d-Moll als Mittelstimme, Grundton von F-Dur als Bass) und zwischen strukturellem und genetischem Primat (Die strukturell primäre d-Moll-Progression geht aus der strukturell sekundären F-Dur-Progression hervor).
Widerspruch als Resultat
Analyse
Ein Sprung zurück zum Beginn des Menuetts. Oben war provisorisch davon ausgegangen worden, die Verzahnung der zwei 5-6-Progressionen sei qua kompositorischer Setzung ins Werk eingeführt worden. Eine genauere Lektüre des Notentextes legt indessen die Vermutung nahe, diese Vorstellung greife zu kurz. Erstens ist bislang ungeklärt, weshalb das Menuett mit einem Sextakkord beginnt. Zweitens erscheint die Rhythmisierung der intialen Harmoniefolge als willkürliche Verzerrung der rhythmischen Gleichförmigkeit des zugrunde liegenden Satzmodells: auf einen Takt d-Moll folgen zwei Takte g-Moll und wiederum ein Takt Es-Dur. Und drittens sticht die um ein Viertel im Takt verschobene Imitiation des melodischen Repetitionsmotivs in Bass und Mittelstimmen ins Auge. Für jede dieser Beobachtungen ließen sich separate Erklärungen finden. Es ist nicht unplausibel, zu vermuten, Haydn habe den Beginn des Menuetts destabilisiert, um zu einer engeren Verzahnung der Sätze zu gelangen[39], die g-Moll-Harmonie um einen Takt vorgezogen, um die initiale Ereignisdichte zu erhöhen und das imitierte Repetitionsmotiv im Takt verschoben, um einen komplementärrhythmisch gleichmäßigen Fluss der Viertel zu erzeugen. Und doch erscheinen diese Erklärungen schwach, sobald man sie an den Kriterien der Spezifität und integrativen Potenz misst. Sie alle treffen auf eine Mehrzahl von Sätzen zu und bleiben den Einzelphänomenen verhaftet, auf die sie sich jeweils beziehen. Eine Erklärung, die sich erstens auf alle drei Phänomene erstreckte und zweitens zu zeigen vermöchte, dass jedes dieser Phänomene Teil einer für dieses und nur dieses Stück spezifischen Konstellation ist, verdiente demgegenüber zweifellos den Vorzug. Eine solche Erklärung soll im Folgenden vorgeschlagen werden. Sie beginnt mit der These, am Anfang des kompositorischen Prozesses, aus dem Haydns Menuett hervorging, habe die Idee gestanden, die Tonartenfolge des II. und III. Satzes in der initialen Akkordfolge des III. Satzes zu wiederholen.[40] Aus dieser These lässt sich folgende Ableitung gewinnen: Die abstrakte Akkordfolge F-Dur - d-Moll wird mithilfe des Kontrapunktmodells ›5-6-Progression‹ (Beispiel 6a) satztechnisch konkretisiert und anschließend zur Sequenz erweitert (Beispiel 6b). Diese Sequenz prägt die Tonart F-Dur aus. Konventionell gefordert ist aber, die Haupttonart d-Moll bereits zu Beginn des Menuetts deutlich werden zu lassen. Die F-Dur-Progression ist mithin so zu verändern, dass sie den Eindruck der Tonart d-Moll vermittelt. Dies geschieht in folgenden Teilschritten: Zuerst wird die Quinte des F-Dur Dreiklangs ausgeblendet, so dass nur die Töne f0 und a0 übrigbleiben – eine Filterung gleichsam von F-Dur durch d-Moll. Dann wird die bisherige Mittelstimme über die bisherige Oberstimme gelegt (Beispiel 6c), die Oberstimme als virtuell mehrstimmige Darstellung der zwei vertauschten Oberstimmen der ›5-6-Progression‹ ausgeführt (Beispiel 6d), die zentrifugale Tendenz der Sequenz durch Einführung des Tones es2 eingedämmt, der sequenzeigene a-Moll-Klang durch den dominantischen A-Dur-Klang ersetzt und die Führung der Mittelstimme angepasst (Beispiel 6e). Weitere Elaborationen folgen: die Präzisierung der Oberstimme durch ein Auftaktmotiv, die Übertragung des Auftaktmotivs in Bass und Mittelstimmen, die Ausfüllung der verminderten Terz es2-cis2 durch den Ton d2, die Kontrapunktierung des Tons d2 durch den Basston gis0 und die Prolongation der Dominante durch entsprechende Durchgangsbildungen (Beispiel 6f). Schließlich wird der Auftakt in der Begleitung um ein Viertel erweitert, so dass sich die Harmonie der Auftakte auf eben den Takt ausdehnt, in dem sie stehen. Die auf einer früheren Elaborationsstufe als Fragment eines F-Dur-Klangs eingeführte Terz f0-a0 wird so in ein Element eines d-Moll-Klangs umgedeutet (Beispiel 6g).
Beispiel 6: Joseph Haydn, Sinfonie Hob. I:26, III. Satz, T.1–5; siebenstufige Rekonstruktion der ›logischen Genese‹
Kommentar
Die Analyse lässt die widerspruchsvolle Verschränkung zweier Satzmodelle nicht als irreduzible Setzung, sondern als Resultat einer Vermittlung zwischen einer Setzung elementareren Charakters und der abstrakten kompositorischen Norm ›Tonart‹ erscheinen. Mit der satztechnischen Konkretisierung der Norm, die über die Vermittlung erreicht wird, kehren sich die Verhältnisse um: Im Phänomen wirkt der realisierte Tonsatz vergleichsweise problemlos, die ursprüngliche F-Dur-Progression irritiert nur unterschwellig. Die Anpassung der F-Dur-Progression an die darzustellende Tonart vollzieht sich nicht in der ›Breitendimension‹ des chronologischen Ablaufs des Werkes, sondern in der ›Tiefendimension‹ seiner logischen Genese: Alle Umformungen gehorchen dem Zweck, die Differenz zwischen einem Ist- und einem Sollzustand zu überbrücken, sind also teleologisch respektive final motiviert. Dabei liegt ihr Ziel nicht jenseits der Mittel, die zu seiner Erreichung eingesetzt werden, sondern emergiert aus deren Konstellation: Der Halbschlussklang in Takt 8, mit dessen Erreichen die Tonart d-Moll erst hinreichend deutlich wird, macht die vorangegangenen Akkorde nicht überflüssig, sondern verbindet sich mit ihnen zu einem zeitlich ausgedehnten Zusammenhang, der allein als ganzer die Tonart auszudrücken vermag. Insofern ist das Ziel ein Feld, eine Konstellation aufeinander bezogener Einzelmomente. Und da eine Tonart auf verschiedene Weisen dargestellt werden kann, bleiben die Mittel, über die das Ziel erreicht wird, a priori undeterminiert: Alle Mittel, die dasselbe Ziel zu erreichen erlauben, sind funktional äquivalent.[41]
Exkurs 2: Strukturale Dialektik und Kausalität bei Schenker
Die Vermittlung zwischen der F-Dur-Progression und der Tonart d-Moll, die oben gezeigt wurde, erfolgt zu Teilen als Ausdifferenzierung einer zugrunde liegenden einfachen Struktur. Dieser Vorgang ist allerdings mit einer Schenkerschen Auskomponierung nicht gleichzusetzen: Erstens setzt er nicht bei einer globalen, sondern bei einer lokalen Struktur an, und zweitens bildet der Ursatz in ihm nicht den diastematisch konkreten Ausgangspunkt, den er in einer Analyse nach Schenker darstellt, sondern ein Abstraktum, das zuallererst über die Differenzierung der F-Dur-Progression seine Konkretisierung (als Ursatz mit Urlinie-Quintzug) erfährt. Der wichtigste Unterschied aber betrifft die jeweiligen Begründungsstrukturen: Was die Camouflage der F-Dur-Progression motiviert, ist allein die Differenz zwischen einem Ist- und einem Sollzustand. Anders bei der Auskomponierung des Ursatzes: Zwar sieht Schenker auch hier teleologische Anteile. So betont er in Der freie Satz, »der Inhalt der zweiten und der folgenden Schichten [richte sich] nach dem der ersten Schicht, zugleich aber nach dem geheimnisvoll geahnten und verfolgten Ziele im Vordergrund.«[42] Die Entstehung einer musikalischen Komposition aber darauf zurückzuführen, dass ein Komponist unter den Bedingungen eines allgemeinen musikalischen Regelsystems eine spezifische Werkvorstellung realisiert habe, greift für ihn zu kurz. Zentral für Schenkers Werkbegriff ist der Gedanke einer Eigengesetzlichkeit des Musikalischen, die sich nicht erst in den strukturellen Relationen, sondern bereits im Prozess ihrer logischen Genese manifestiert. Beim Versuch, dieses Moment konzeptuell zu fassen, spielt der Begriff der ›Kausalität‹ ein wichtige Rolle. Schenker, der die Idee einer musikalischen Kausalität in einer frühen Schrift als illusionär zurückgewiesen hatte[43], vertrat sie dafür in späteren Schriften um so prononcierter. Dieser Wandel – und um einen solchen handelt es sich, auch wenn William Pastilles plakative These, Schenker, der spätere ›Erz-Organizist‹, habe seine Laufbahn als ›Anti-Organizist‹ begonnen, in der amerikanischen Schenker-Community kritisch diskutiert wurde[44] – steht in engem Zusammenhang mit Schenkers im Verlauf der 1920er Jahre entwickelten Konzept der Schichten, einem Konzept, das es erlaubte, das Wirken ›kausaler Prozesse‹ nicht mehr in der physikalischen Zeit der Komposition, sondern der logischen Zeit ihrer Ausdifferenzierung anzusiedeln.[45] Worin das spezifisch Kausale der Relation von einfachen zu komplizierten Schichten besteht, kommt in Schenkers Publikationen allerdings nicht explizit zum Ausdruck. Die graphischen Anteile der Analysen Schenkers beschreiben, aber erklären nicht: Sie zeigen die Struktur als Faktum, aber nicht, weshalb sie so und nicht anders ausgefallen ist. Und die wortsprachlichen Anteile der Analysen Schenkers, die die graphische Präsentation von Strukturen um die Deskription von Begründungszusammenhängen ergänzen, beziehen sich in aller Regel auf zeitliche Relationen, auf das Früher und Später des erklingenden Ablaufs.[46]
Bernhard Haas und Veronica Diederen haben demonstriert, wie sich die Idee einer ›Kausalität‹ der Schichten konkret verstehen ließe. Die Entwicklung einer ›späteren‹ oder ›vorderen‹ Schicht bei Bach, so die Autoren, wird stets »durch Mängel der je hinteren Schicht hervorgerufen« – beispielsweise durch zu großen Abstand zwischen benachbarten Stimmen, Parallelen perfekter Konsonanzen oder dissonante Sprünge in einer Stimme.[47] Diese Mängel seien »nicht etwa Kompositionsfehler Bachs, sondern die entscheidenden Triebkräfte der Entwicklung, die die Geschichte der Schichten in Gang bringen und halten.«[48] Haas und Diederen übertragen das Prinzip des Widerspruchs, dessen Manifestation in anderen theoretischen Ansätzen durchwegs die Existenz zeitlich sukzessiver Ereignisse voraussetzte, auf Schenkersche Schichten – mithin zeitlich simultane, aber logisch sukzessive Zusammenhänge.[49] Im Hinblick auf das eingangs genannte Ziel, zur Formulierung ›übergreifender Theorieräume‹ zu gelangen, ist dies insbesondere deshalb von Interesse, weil die Kategorie des Widerspruchs eine formale Beschreibung zumindest bestimmter Sorten intrinsischer Bestimmungsprozesse unabhängig davon erlaubt, ob sie sich in ›axialer‹ oder ›horizontaler‹ Richtung erstrecken.[50]
Konsequenzen
Analyse
Ein erster Schritt zur Lösung des Widerspruchs der 5-6-Progressionen erfolgt in Takt 10. Kaum ist die Tonart d-Moll qua auskomponierter Halbschlussstufe A-Dur mit hinreichender Deutlichkeit entfaltet, setzt sich die sekundäre 5-6-Progression an die Stelle der primären. Nach der Quinte ›es-b‹ (Takt 4) lautete ihr nächstes Intervall in unalterierter Fassung ›e-c‹. Eben diese Sexte erscheint nun in den Takten 11 und 12. Ihre Fortschreitung zur Quinte ›f-c‹ (Takt 12) bezieht den Bass mit ein; die Sexte wird zum Quintsextakkkord, die Quinte zum F-Dur-Dreiklang ergänzt. Damit ist das konventionelle Modulationsziel dieses Formteils erreicht. Anders, als es zunächst den Anschein hatte, wird die sekundäre 5-6-Progression also über Takt 4 hinaus fortgeführt. Ab Takt 9 übernimmt sie die Aufgabe, die Basstöne des Mittelgrundes darzustellen (Beispiel 4).
Der B-Teil führt die 5-6-Progression in einer chromatischen Variante fort (Beispiel 2). Die verminderten Quinten ›fis-c‹ in Takt 23 und ›gis-d‹ in Takt 27 werden dabei wie üblich in Gegenbewegung zur Terz geführt (Beispiel 1).[51] In Takt 28 ist A-Dur ein zweites Mal erreicht – nunmehr über die d-Moll-Progression und, am Ende des kontrastierenden Mittelteils, in adäquater formaler Position. Der anfängliche Konflikt der 5-6-Progressionen bleibt allerdings ungelöst. Daraus zieht die Reprise die Konsequenz: Sie wiederholt den A-Teil, blendet die deplatzierte F-Dur-Progression aber aus. An ihrer Stelle erklingt die d-Moll-Progression in Engführung (Beispiel 1, ab Takt 33). Der neue Kontext motiviert zwei Veränderungen. Da die Progression von einem grundständigen d-Moll-Klang bis zur Dominante A-Dur geführt werden soll, entfällt die Tiefalteration des Tones e2 zu es2. Daraus resultiert eine erste verminderte Quinte ›e-b‹. Und da die Reprise nicht moduliert und die Tonart F-Dur im A-Teil bereits zur Darstellung kam, wird der F-Dur-Klang durch Erhöhung von ›f‹ zu ›fis‹ übergangen. Daraus resultiert eine zweite verminderte Quinte ›fis-c‹. Die Imitiation im eintaktigen Einsatzabstand bringt die verminderten Quinten übereinander. Eine schneidende, nachgerade alarmierende Klanglichkeit ist die Folge. Die Sorgfalt, mit der das Intervall der verminderten Quinte bis da vermieden oder qua Gegenbewegung in die Terz geführt wurde, scheint nunmehr obsolet. Und dies ist nicht die einzige werkeigene Norm, die der entfesselten Dynamik der enggeführten Progressionen zum Opfer fällt. Bis einschließlich Takt 36 hatte der 6. Ton (als obere Nebennote b2 zum Urlinie-Kopfton a2 oder als Superposition h2 in Takt 26) als höchster Ton des Satzes gedient. Nun durchbrechen Oboen und erste Violinen diese Grenze. In Takt 37 steigen sie zum Ton c3, in Takt 39 zum Ton d3 (Beispiel 4). Das Projekt, den A-Teil in der Reprise strukturell rein zu verwirklichen, läuft aus dem Ruder. Das kompositorische Subjekt reagiert darauf mit einem Bündel kompensatorischer Maßnahmen. In Takt 39 schreitet der Bass nicht zum G, sondern springt in den Terzton B (Beispiel 1). Der Sog der übersprungenen Töne motiviert den Gang zum Ton A, mithin die Umkehr der Anstiegsbewegung. So setzt sich der Bass der ungebrochenen Aufwärtstendenz der Oberstimmen entgegen. Wie unter dem Einfluss des Basses ändert die Melodiestimme ihr bisheriges Muster, steigt schrittweise abwärts. Der Ton gis2, den sie in Takt 40 erreicht, schließt an den Ton g2 an, mit dem die Sechzehntelgruppe im Auftakt zu Takt 40 begann: nichts anderes als der übersprungene, nun in die zweigestrichene Oktave verlegte Basston G in seiner neuen Funktion als vierter Ton der Urlinie. Der Ton gis2 entspricht dem chromatischen Durchgangston des Basses in Takt 4. Mit dem Sukzessivintervall d3-gis2 (Takt 39/40) erscheint die dritte und letzte verminderte Quinte. Während g2 zu gis2 fortschreitet, steigt die Urlinie im Inneren des Satzes weiter zum f2 ab (Beispiel 4).[52] Das Kräfteverhältnis verschiebt sich damit weiter zu Ungunsten der Melodiestimme. Der Antagonismus von Melodiestimme und Bass kulminiert im übermäßigen Quintsextakkord (Takte 40/41). Dessen gespannte Balance wird für die Dauer zweier Takte gehalten, ein Takt Generalpause schließt sich an. Der Ton e3 wird nicht erscheinen. Die Spannung löst sich, beide Stimmen erreichen die Oktave A-a2. Das Menuett schließt mit einer Folge zweier auffällig lakonischer Kadenzen.[53]
Kommentar
Die beschriebene Abfolge musikalischer Ereignisse lässt sich allein durch strukturelle Faktoren nicht hinreichend erklären. Verständlich wird sie dagegen, sobald sie als musikalische Erzählung aufgefasst wird. Deren Plot könnte in knapper Form wie folgt lauten: Eine Instanz des Satzmodells 5-6-Progression verkörpert zentrale Momente der tonalen Struktur des d-Moll-Menuetts, an dessen Anfang sie steht, wird strukturgenetisch aber lediglich als Epiphänomen eines tonartfremden Gebildes, einer 5-6-Progression in der Tonart F-Dur, eingeführt. Der Widerspruch zwischen struktureller Funktion und Ableitungszusammenhang motiviert die d-Moll-Progression erfolgreich, sich an die Stelle der F-Dur-Progression zu setzen und damit die Handlungsträgerschaft zu gewinnen.[54] Allerdings bleibt der Anfang des Stückes mit dem Makel des falschen Beginns behaftet. Allein die Reprise des A-Teils bietet eine Möglichkeit zur Korrektur. Zunächst scheint es, als gelänge der d-Moll-Progression eine widerspruchsfreie Variante des A-Teils. Allerdings erfolgt die Wiederholung unter den Bedingungen eines A’-Teils, insbesondere unter jener des Schließen-Müssens. Dadurch kommt es zu einer Reihe neuer Konflikte. Der triumphal begonnene Versuch, den Makel auszuräumen, muss daher kurz vor seiner Vollendung abgebrochen werden.[55]
Es kann als verbreitete Auffassung gelten, ein musikalisches Narrativ verdanke sich der »elementaren ästhetischen Aktivität, einer Geschichte zu folgen«[56], einer Aktivität, die – als ästhetische – einen Bezug auf die sinnliche Außenseite von Musik voraussetzt.[57] Musikalische Narrative beruhen demnach auf der Zuschreibung von Handlungsrollen oder Erzählfunktionen zu auditiv wahrnehmbaren musikalischen Elementen oder dem Wechsel der Emotionen, die im Zuge der ästhetischen Erfahrung eines Werkes induziert respektive im Ablauf seiner Gestalten exemplifiziert werden.[58] Von diesen Konzepten weicht das oben umrissene Narrativ in mehrfacher Hinsicht ab:
Die Träger der Erzählung sind Strukturen und keine metaphorisch exemplifizierten Qualitäten[59] oder emotionalen Zustände des Hörers.
Was die Erzählung motiviert, sind Bedeutungen, die Strukturen dadurch erhalten, dass sie in bestimmten Relationen zu anderen Strukturen oder zu strukturellen Normen stehen.
Bedeutungen, die aus diesen Relationen resultieren, kommen dem Hörer nur dann zu Bewusstsein, wenn sie an der ästhetischen Außenseite der Musik in Erscheinung treten. Dies ist keineswegs zwangsläufig der Fall. So sind die Widersprüche zwischen (a) der regulären Funktion der Tonqualität ›d‹ als Basston und der tatsächlichen Lage und Instrumentierung ihrer Instanzen, (b) dem logisch-genetischen Primat der F-Dur-Progression und ihrer Subordination unter die Tonart d-Moll sowie (c) der Strukturbedeutung der d-Moll-Progression und ihrer Genese als Epiphänomen eines tonartfremden Satzmodells ästhetisch unwirksam, weil die Konstellation der zwei ineinandergeschachtelten 5-6-Progressionen weder eine sensorische (intervallische, metrische) noch eine auditiv induzierte kognitive Dissonanz impliziert.[60]
Auch wenn das Narrativ die Hörbarkeit seiner Konstituenten nicht voraussetzt, vermag es doch qualitative Momente zu integrieren.
Phänomen und Struktur
Analyse
Das oktavierte Unisono in den Takten 10–12 ist eine texturale Komponente, besitzt aber auch eine strukturelle Funktion. Die Oktavierung ist nicht effizient, sondern final begründet: Sie hat den Zweck, den Ton e2, der als Komponente der d-Moll-Progression dient, in den Bass zu bringen – zentrale Bedingung dafür, dass die d-Moll-Progression die strukturelle Rolle der F-Dur-Progression übernimmt. Das Resultat der Oktavierung überzeugt durch minimale Differenz zu seinem Ausgangspunkt: Oktavierung heißt Wiederholung in der Vertikalen. Da nun ›e‹, der untere Ton des Intervalls ›c-e‹, im Bassregister erscheint, liegt es nahe, ›f‹, den nächsten Basston der d-Moll-Progression, ebenfalls ins Bassregister zu setzen. Was die Tieferlegung plausibel erscheinen lässt, sind die Prinzipien der Wiederholung und der Nähe.
Die Momente Tieferlegung, Oktavverdopplung, Generalpause und forte erfüllen je verschiedene Zwecke. Während die Tieferlegung der Sexte ›e-c‹ und die Oktavverdopplung des Unisonos primär strukturell motiviert sind, gehorchen die Generalpause und das forte primär rhetorisch-gestischen Prinzipien. Dabei hängt die Auffassung von der Perspektive ab: Der ›Schritt ins Leere‹, den ein unbefangener Hörer, der die quadratische Regularität der ersten acht Takte fortzuschreiben versucht, in Takt 9 erfährt, öffnet ein Feld der Indetermination, vor dessen Folie der unvermittelte Einsatz des forte-Unisonos umso drastischer hervortritt. Aus Sicht musikalischer ›agency‹[61] dagegen erscheint die Generalpause in Takt 9 als Moment des Zögerns, das forte-Unisono als Zeichen eines Entschlusses, entschiedenes Aufnehmen des initialen Motivs und Negation jenes vorsichtigen piano, mit dem das Menuett begann.
Kommentar
Die Ereignisse der Takte 9–12 besitzen eine doppelte Funktion: In der Logik des Narrativs führen sie jene entscheidende Wendung herbei, durch die sich die d-Moll-Progression von einem bloßen Epiphänomen zum handelnden Subjekt dieses Menuetts erhebt. Zugleich erscheinen sie dynamisch, textural, metrisch, motivisch und harmonisch markiert. Ihre Ereignisqualität ist das ästhetische Korrelat des narrativen Vorgangs, sie macht die abstrakten Vorgänge, die sich ›im Inneren‹ des Tonsatzes vollziehen, musikalisch sinnfällig.
Die Entsprechung von struktureller Innen- und ästhetischer Außenseite ist alles andere als selbstverständlich. Das Narrativ funktioniert über die Unterscheidung von Widerspruch und Übereinstimmung, es besteht aus einer Kette von Handlungen, die den Ausgangszustand unter ständiger Berücksichtigung des jeweiligen Jetztzustands mit dem Zielzustand vermitteln. Eine Beschreibung qualitativer Aspekte dagegen spräche von Intensitäten und Nuancen, Gesten und Bewegungsformen, geschichtlich geprägten Bedeutungen und metaphorisch exemplifizierten Qualitäten. Da die beiden Beschreibungsebenen distinkte Operationen der musikalischen Analyse voraussetzen, ist eine Korrelation wie die oben beschriebene ein nicht-triviales analytisches Resultat. Beide Beschreibungen stützen sich gegenseitig: Das Narrativ erklärt die ästhetisch markierten Phänomene, indem es die ›Außenperspektive‹ auf qualitative Aspekte des Satzes durch eine ›Innenperspektive‹ ergänzt, in der das warum dieser Aspekte verständlich wird. Die Beschreibung qualitativer Aspekte beglaubigt das Narrativ, indem sie den in ihrer handlungslogischen Begründung weitgehend unanschaulichen Teilhandlungen eine ästhetische Außenseite verleiht, deren Ausdrucksqualität der Psychologie des narrativen Geschehens auf nachvollziehbare Weise entspricht.[62] Die Tatsache, dass ein strukturanalytisch konstituiertes Narrativ die Auffassung der ästhetischen Außenseite eines Werkes auf diese Weise zu beeinflussen vermag, relativiert im Übrigen die verbreitete Auffassung, strukturanalytische Interpretationen hätten a priori die Hörbarkeit ihrer Ergebnisse im Auge zu haben. Es ist die Unabhängigkeit der einzelnen Beschreibungsebenen, die ebenenübergreifende Beziehungen als echte Resultate der Analyse zu begreifen erlaubt.
Auswahl und Verknüpfung
Die narrative Deutung des Haydnschen Menuetts konstruiert einen Zusammenhang von Zusammenhängen – eine Metastruktur, die quer zu den Grenzen analytischer Verfahren verläuft. Die Verknüpfung der heterogenen Elemente allerdings, die sie vornimmt, birgt – wenn nicht technisch, so doch theoretisch – einige Schwierigkeiten:
Die Analyse beginnt mit einer lokalen Struktur in den ersten Takten der Komposition, nicht mit der globalen Struktur des Ursatzes. Dahinter stehen zwei konträre Logikbegriffe: Kaum vorstellbar scheint, dass Schenker einen Konflikt zweier Modellinstanzen als generatives Movens akzeptiert hätte. Selbst wenn er der dialektischen Deutung gefolgt wäre, ein und dieselbe Tonhöhenstruktur enthalte in sich einen Widerspruch, hätte er sich doch geweigert, sie der Interpretation eines globalen Strukturzusammenhangs zugrunde zu legen.
Der Formbegriff, den die Analyse in Anspruch nimmt, beruht wesentlich auf der Unterscheidung ähnlicher und unähnlicher Oberflächenereignisse. Gegen eben diesen – traditionellen – Formbegriff aber polemisierte der späte Schenker.[63]
Schönberg sieht musikalische Prozessualität als Ergebnis einer Vermittlung individueller struktureller Ungleichgewichte, Schenker dagegen als Eigenschaft des Ursatzes und der mit ihm vermittelten Strukturen.[64] Lokale Prozesse sind vor dem Hintergrund des Ursatzes lediglich Digressionen im Ablauf eines Vorbestimmten[65], nicht aber generative Instanzen, aus deren Wirken das Ganze erwächst.
Zwar widerspricht die Vorstellung, der Ablauf einer Komposition trage Züge einer Erzählung, dem Denken Schenkers keineswegs grundsätzlich.[66] In der skizzierten Analyse aber kommen tonale Struktur und Narrativ nicht zur Deckung. Erstens integriert das Narrativ Aspekte, die in die Struktur zwar auf irgendeine Weise eingehen, aber gleichwohl nicht zu den Prinzipien gehören, die die Struktur als System logisch qua Komplexitätsdifferenz aufeinander bezogener Schichten allererst konstituieren – Aspekte wie Metrik, Motivik, Textur und Dynamik.[67] Zweitens fungiert das Narrativ gleichsam als eine Modulation der Struktur, eine Modulation, in der Aspekte des musikalischen Satzes, die aus der Perspektive der Struktur lediglich Möglichkeiten darstellen, die auch anders hätten ausfallen können, semantisch aufgeladen und damit zugleich individualisiert werden. Die Struktur formt den narrativen Prozess, wird aber zugleich durch ihn geprägt und qualitativ bestimmt. Die Komposition ist damit als Ganze das Resultat einer Interaktion (wenigstens) zweier Systeme. Es ist mehr als fraglich, ob dies mit Schenkers Monismus der Struktur vereinbar wäre.
Welche Konsequenzen sind nun aus der Feststellung zu ziehen, dass das Narrativ in einem Einzelfall heterogene Beschreibungen zu integrieren vermag, von einer Integration der Theorien, die den Beschreibungen zugrunde liegen, aber gleichwohl nicht gesprochen werden kann? Fragt man nach der Generalisierbarkeit des oben durchgespielten Verfahrens, wird rasch klar, dass Narrative zwar mögliche, aber keineswegs universelle Instrumente der Integration heterogener analytischer Methoden sind: Nicht jedes analytische Resultat eignet sich zur Einbindung in ein Narrativ, nicht jedes Narrativ operiert intermethodologisch und nicht jede Komposition lässt sich sinnvoll als auskomponiertes Narrativ lesen.[68] Eine generelle Lösung des eingangs diskutieren Problems ist, so scheint es, überhaupt nur auf folgende zwei Weisen möglich: Die erste besteht in der Entscheidung, die Verknüpfung heterogener Theoriebruchstücke nicht weiter zu reglementieren und alle daraus entstehenden Widersprüche zuzulassen. Eine solche Entscheidung lässt sich begründet vertreten, soll hier aber nicht weiter diskutiert werden.[69] Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Resultate unterschiedlicher analytischer Perspektiven und Verfahrensweisen kontrolliert miteinander zu konfrontieren.[70] Die Einheit des Gegenstandes wird so weder vorausgesetzt noch gewaltsam konstruiert, Bezüge können sich zwanglos im Vergleich der analytischen Resultate herstellen. Zugleich versteht sich von selbst, dass der beziehenden Aktivität des Lesers zu überantworten, was eigentlich Sache der Theorie ist, keine dauerhafte Lösung sein kann.
Alle anderen Möglichkeiten einer Integration heterogener Theorien sind an spezifische Theorien und ebenso spezifische methodologische Fragestellungen gekoppelt. Der Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse etwa bestand darin, ein Schenkersches Verfahren – die Abhebung unterschiedlicher Schichten der logischen Genese – zur Rekonstruktion eines Widerspruchs zu verwenden (und damit in den Dienst eines ›dialektischen‹ Modells struktureller Entwicklung zu stellen) und zugleich die Schenkersche Struktur in einen über eben dieses dialektische Modell konstruierten narrativen Zusammenhang einzubinden. Das eingangs allgemein formulierte Problem der Verbindung unvereinbarer Theorien wurde mithin von vornherein über die spezifische Frage diskutiert, wie zwei Konzepte von Generativität – ein Schenkersches und ein Schönbergsches – im Zuge einer konkreten Analyse miteinander verknüpft werden können. Diese Frage steht vor dem Hintergrund der seit mehreren Jahrzehnten diskutierten allgemeineren Frage nach der Vereinbarkeit der Theorien Schönbergs und Schenkers;[71] in ihrer Spezifik ist sie durch die Beobachtung motiviert, dass Theorien, die inkommensurabel scheinen, wenn sie als unterschiedliche Antworten auf ein und dieselbe Frage (wie etwa die nach den Faktoren musikalischen Zusammenhangs) aufgefasst werden, tendenziell in ein Verhältnis der Komplementarität treten, sobald man ihren Geltungsbereich strikt auf diejenigen Momente beschränkt, über die sie auch tatsächlich Aussagen treffen.[72] Das methodologische Problem besteht nun allerdings darin, dass eine solche Auffassung niemals vollständig gelingt: Komplementarität ist eine Relation von Gegenstandsbereichen; was Theorien ausmacht, geht aber über die Bestimmung von Gegenstandsbereichen weit hinaus. Ein einheitlicher Theorieraum ist daher nur zu konstruieren, wenn diskrepante Theorieelemente neu gefasst werden. Als Beispiel kann der Begriff des Widerspruchs in seiner obigen Funktion dienen. Anstatt wie Gianmario Borio bestimmte analytische Probleme in historischer Perspektive als Manifestation zweier unvereinbarer Ästhetiken – der dialektisch-diskursiven Schönbergs und der ›vitalistischen‹ Schenkers – auszuweisen[73], führt die obige Analyse mit dem Begriff des Widerspruchs ein formales tertium ein, das die Theorien auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt hin ausrichtet und zugleich gegeneinander differenziert. Diese Operation verwandelt die Unvereinbarkeit der ästhetischen Prämissen, die Dahlhaus akzentuierte, in eine Komplementarität der analytischen Prinzipien. Mit einer solchen Operation ist es freilich nicht getan. Eine Theorie, die ein horizontales und ein axiales Prinzip der Generation musikalischer Zusammenhänge integrierte, entspräche weder der Theorie Schenkers noch jener Schönbergs. Ohne ein hinreichendes Maß vorgängiger Theoriebildung wäre sie nicht denkbar.[74] Die Aussichten für die musikalische Analyse bleiben damit unspektakulär. Theoriebildung ist ein langwieriger und eng umgrenzter Prozess. Wer – unter welcher Fragestellung auch immer – verschiedene analytische Methoden in der Praxis miteinander kombinieren möchte, wird sich in der Mehrzahl der Fälle auch künftig mit den bekannten provisorischen Verfahren begnügen müssen.
Anmerkungen
Ich danke Stefan Rohringer für eine Vielzahl hilfreicher Anmerkungen zu früheren Fassungen dieses Textes. | |
Siehe etwa Dahlhaus 1971, 222–225; ders. 1984, 313–317. | |
»Von einer musiktheoretischen Umgangssprache zu reden, die einem Historiker zur Verfügung steht und für die Zwecke, die er verfolgt, in der Regel genügt, mag zwar ungewöhnlich sein; daß sie existiert, läßt sich jedoch kaum leugnen. Wenn Musikwissenschaftler, die die Musikgeschichte als Kultur-, Stil- oder Geistesgeschichte interpretieren, von Tonika, Subdominante und Dominante sprechen, setzen sie im allgemeinen keine Theorie voraus, weder eine monistische noch eine dualistische, sondern nennen Akkorde beim Namen, zwischen denen sie einen Zusammenhang empfinden: Akkorde, die ebenso triftig durch die Stufenziffern I, IV und V chiffrierbar wären, ohne daß sich, wie Historiker glauben, der Sachverhalt, der ausgedrückt werden soll, durch den Wechsel der Nomenklatur im geringsten ändert. Die Annahme, es existiere ein musikalischer ›Sachverhalt‹, der unabhängig von den Theoriesprachen, die man benutzt, immer ›derselbe‹ sei, ist allerdings nichts weniger als selbstverständlich.« (Dahlhaus 1984, 391). – Das Problem der Beschreibung methodenübergreifender Strukturzusammenhänge stellt sich nicht erst dort, wo vollständige Analysen angestrebt werden; es lässt sich daher über die Begrenzung analytischer Fragestellungen auch nicht grundsätzlich lösen (vgl. Danuser 2010, 45). | |
Siehe Webster 1991, 4f. | |
Lyotard 2009. | |
Vgl. etwa Habermas 1973, 97. | |
Dahlhaus 1971, 226. | |
Borio 2001, 260–265. | |
Dahlhaus 1985, 375. Zum Eklektizismusproblem siehe auch Dahlhaus 1984, 316. | |
Vgl. etwa Brown 2005. | |
Lerdahl/Jackendoff 1983. – Zur Unterscheidung von Eklektizismus und Synkretismus siehe Albrecht 1994, passim. | |
Es wird hier also erklärtermaßen etwas anderes versucht als in musikalischen Analysen, die verschiedene Perspektiven auf ein Werk lediglich juxtaponieren. Siehe etwa Roth 2010. | |
Göllner 1992; Finscher 2000, 266. | |
»The interlocking rhythmic motives, the offbeat accompaniment, the Neapolitan in mm. 3–4, and the ambiguous phrase rhythm leading to the dominant arrival in the fifth bar, all create an oppressive mood.« (Webster 1991, 243) | |
Finscher 2000, 267. | |
Eine ›Instanz‹ ist, verkürzt gesagt, ein konkretes singuläres Exemplar eines abstrakten Allgemeinen, etwa einer Klasse, eines Typus‘ oder eben einer harmonischen Funktion. | |
Dem musiktheoretischen Common Sense widerstrebt es völlig zu Recht, die Fortschreitung ›neapolitanischer Sextakkord - Dominantakkord‹ (Takt 4/5) als 6-5-Progression im Sinne des Stimmführungsmodells aufzufassen: Der kontradirektionale chromatische Schritt von es2 zu e2 und der übermäßige Sekundschritt von b1 zu cis2 sprechen dagegen. Im weiteren Verlauf des Textes wird deutlich werden, weshalb ich gleichwohl die dargestellte Lösung vertrete. | |
Die Figuration der Takte 21–32 orientiert sich an einer zugrunde liegenden 5-6-Progression, auch wenn diese im musikalischen Vordergund nicht immer klar in Erscheinung tritt. | |
Nowak 2005. | |
Adorno 1973, 205. | |
»Harmonie und Melodie sind in einer guten musikalischen Zusammensetzung so unzertrennlich, als Wahrheit der Gedanken, und Richtigkeit des Ausdrucks in der Sprache. Sprache ist das Kleid der Gedanken, so wie Melodie das Kleid der Harmonie. Man kann in dieser Rücksicht die Harmonie eine Logik der Musik nennen, weil sie gegen Melodie ungefähr in eben dem Verhältnis steht, als in der Sprache die Logik gegen den Ausdruck, nemlich sie berichtigt und bestimmt einen melodischen Satz so, daß er für die Empfindung eine wirkliche Wahrheit zu werden scheint. In diesem Verstande würde sich also Harmonie zur Melodie verhalten, wie richtig und wahr musikalisch denken, zum richtigen Ausdrucke musikalischer Gedanken.« (1788, 24) | |
Nowak 2005. Nowak rekurriert ausnahmslos auf Schenkers frühe Schriften (ebd., 11f.). Vgl. Schwab-Felisch i.V.a. | |
Schenker 1956, 49. | |
Vgl. Aristoteles 1995, 106 (Buch V, Kap. 11, 1018b–1019a): »In solcher Bedeutung also wird in diesen Fällen Früher gebraucht, in einer andern heißt früher das, was für die Erkenntnis früher ist, als sei es früher schlechthin. Und hierbei wieder unterscheidet sich das dem Begriffe nach und das der sinnlichen Wahrnehmung nach Frühere. Dem Begriffe nach nämlich ist das Allgemeine früher, der sinnlichen Wahrnehmung nach das Einzelne. […] In solchem Sinne also heißt dies früher und später, anderes heißt so der Natur und dem Wesen nach; früher nämlich heißt dann etwas, was ohne anderes sein kann, während dies nicht ohne jenes […]. Gewissermaßen wird alles, was früher und später heißt, nach dieser Bedeutung genannt; denn einiges kann der Entstehung nach ohne das andere sein, z.B. das Ganze ohne die Teile, anderes dem Vergehen nach, z.B. der Teil ohne das Ganze«. | |
Dies gilt unabhängig davon, dass einem Gebilde, zu dem keine Variante (Kopie, etc.) existiert, auch kein Modell-Status zuzusprechen ist. | |
Tonbuchstaben, die spezifische Tonhöhen indizieren, erscheinen im Folgenden kursiviert und mit Index versehen, Tonbuchstaben, die Tonqualitäten indizieren, in einfachen Anführungszeichen. Basstöne werden nach ihrer klingenden Tonhöhe bezeichnet, also eine Oktave tiefer als im Notentext angegeben. | |
In welcher Hinsicht die XX. Variation keine Vereinfachung des Diabellischen Walzers darstellt, muss hier nicht diskutiert werden. | |
Es gehört zu den Grundprinzipien der Analyse nach Schenker, dass Töne einer Harmonie als liegend gedacht werden, solange die Harmonie in Kraft ist, auch wenn die Töne de facto nicht erklingen. | |
Die Kategorie der auktorialen Intention ist bekanntlich problematisch (Wimsatt/Beardsley 1946); gleichwohl erschließt sich das, was ein Komponist getan hat, bisweilen nur über einen Begriff davon, was er beabsichtigt hat. | |
Vgl. Webster 1991, 127–133. | |
Auf weitere Aspekte der Schenker-Analyse wird in späteren Abschnitten dieses Textes eingegangen. | |
Das Inklusionsverhältnis lässt sich zweifach begründen: Historisch basiert Schenkers Theorie auf einer eingehenden Rezeption von Kontrapunkt- und Generalbasstraktaten des 18. Jahrhunderts. In systematischer Hinsicht gehören sowohl Satzmodelle als auch Schenkersche Strukturen zur Modellklasse der ›intertextuellen, generellen, diminuierbaren und mehrstimmigen Intervallstrukturen‹ (Schwab-Felisch 2007, 299). – Historische Satzmodelle sind in den letzten Jahren wiederholt als eine Alternative zur Analyse nach Schenker vorgeschlagen worden: Sie erlauben die Berücksichtigung linearer Zusammenhänge, ohne zugleich sämtliche musikalischen Teilstrukturen dem Hierarchizitätsprinzip zu unterwerfen (Eybl 1995, Gjerdingen 2007). Die Diskussion, die dieser Vorschlag erforderte, kann hier auch nicht ansatzweise geführt werden. Das obige Beispiel lässt allerdings erkennen, dass eine analyische Methode, die sich auf die Identifikation von Satzmodellen und die Beschreibung ihrer satztechnischen und harmonischen Einbettung beschränken wollte (Eybl 2005), an integrativer Potenz hinter der Schenkerianischen zurückbliebe: 5-6-Progression und Halbschluss erklären die Progression der Takte 1–8; der Hinweis auf die Tonartenverwandtschaft von d-Moll und F-Dur beleuchtet die Akkordverbindung A-Dur, a-Moll, C-Dur (Takte 8–12) – eine aus strikt lokaler Sicht willkürlich erscheinende Abfolge von Ausgangsakkord, Geschlechtswechsel und diatonischem Terzstieg. Beide Teilerklärungen bleiben aber gegeneinander indifferent: Ihre schlichte Juxtaposition übersieht ebenso die lineare Beziehung zwischen dem impliziten Grundton ›d‹ (Takt 1) und dem Basston ›e‹ (Takt 12) wie die Einbettung des Grundtons der Nebentonart F-Dur in den linearen Aufstieg des Basses zur V. Stufe in den Takten 28–32. | |
Vgl. Nowak 1999, 179. | |
Siehe etwa Tarasti 2002, 23: »Usually a piece begins with a certain lack, which can be of a purely musical nature; for instance, a gap in a scale, an asymmetrical motive, a syncopated rhythm, and so forth. This problem is often left hanging, so to speak, until resolved at the very end. The irresolution of this situation creates suspense or tension that prevails throughout the whole piece, propelling the latter toward resolution.« – Modelle für Tarastis Narrativitätskonzept finden sich ebenso in der Musiktheorie wie in Tzvetan Todorovs strukturalistischer Erzähltheorie: »An ideal narrative begins with a stable situation which is disturbed by some power or force. There results a state of disequilibrium; by the action of a force directed in the opposite direction, the equilibrium is re-established; the second equilibrium is similar to the first, but the two are never identical« (Todorov 1977, 111). | |
Neff 1993, 418–429. | |
»Durch die Verbindung von Tönen verschiedener Höhe, Dauer und Betonung (Stärke???) entsteht eine Unruhe: eine Ruhe wird in Frage gestellt durch einen Kontrast … Von dieser Unruhe geht eine Bewegung aus, die nach Erreichung eines Höhepunktes wieder zur Ruhe führen wird oder zu einer neuen (neuartigen) Befestigung, welche einer Ruhe gleichkommt. Wenn nur ein einziger Ton angeschlagen wird, so erweckt er den Glauben, dass er eine Tonika darstellt. Jeder darauffolgende Ton bestreitet dieses Tonikagefühl« (Schönberg 1995, 102). – Vgl. Schönberg 1967, 102: »Each succession of tones produces unrest, conflict, problems […]. Every musical form can be considered as an attempt to treat this unrest either by halting or limiting it, or by solving the problem. […] The unrest in a melody need not reach below the surface, while the problem of a theme may penetrate to the profoundest depths.« – Siehe Jacob 2005, 122f. und 167ff. | |
Krebs 1994, passim. – Widersprüche bestehen hier zwischen den Implikationen eines musikalischen Gebildes und seiner faktischen Fortsetzung. Besteht im Fall der Schönbergschen ›Unruhe‹ eine Eigenschaft eines ersten Tons darin, eine abgeschlossene Einheit zu bilden, so widerspricht die Existenz eines zweiten Tons der Implikation dieser Eigenschaft, keine Relation zu einem anderen Ton auszubilden. Im Fall der metrischen Dissonanz besteht die Eigenschaft des etablierten Metrums im aktiven Mitvollzug einer regelmäßigen Abfolge unterschiedlich gewichteter Zählzeiten (vgl. London 2004, 9–26); das konfligierende Metrum widerspricht der Implikation dieser Eigenschaft, in genau der einmal etablierten Form aufrechterhalten zu werden. | |
Siehe etwa Hauptmann 1873, 27; Riemann 1874, 52. | |
Webster 1991, 127–133, 243. | |
Auch in diesem Fall gilt, dass die Qualität einer analytischen Erklärung nicht zuallererst darin zu suchen ist, ob ihr propositionaler Gehalt historisch wahrscheinlich ist oder nicht, sondern darin, welche strukturbezogenen Fragen sie wie stichhaltig zu beantworten vermag. Ob Haydn eine Idee wie die oben konstruierte tatsächlich gehabt hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ließen sich aber vor dem Hintergrund seiner nachweislichen Experimente mit der Komposition durchkomponierter Sonatenzyklen (Webster 1991) sehr wohl Argumente finden, die die vorgeschlagene Erklärung auch historisch stützen könnten. | |
Siehe etwa Luhmann 1970, 14ff. – Das Prinzip der funktionalen Äquivalenz erlaubt es in vielen Fällen, von lösungsbedürftigen satztechnischen Problemen zu sprechen, ohne einem offenkundig falschen Determinismus zu verfallen; es vermag damit den Einwand der ›organic fallacy‹ zu entkräften (Kabisch 2009, 82ff.) und bewahrt zudem vor der schwachen Alternative zwischen einem quasi-kausalistischen Determinismus und einer Reduktion musikalischer Logik auf ästhetische Notwendigkeit (vgl. etwa Leichtentritt 1979, 233). | |
Schenker 1956, 112. – Schenker fährt fort: »Deutlicher schon als die erste läßt die zweite Schicht die Abzweigung in das Besondere des Werkes erahnen. Doch wiederhole ich, daß es zu den unlösbaren Geheimnissen des Schaffens gehört, wie der Komponist zu seiner ersten Anregung kommt, ob er sie aus einer früheren oder späteren Schicht holt, vielleicht sogar aus dem Vordergrunde – was aber an der logischen Folge der Schichten nichts ändert, vielmehr von einer Hellseherei zeugt, die eine fernere Schicht erspäht, bevor die frühere deutlich im Bewußtsein ist. Ein solches Zurück und Voraus beherrscht freilich das Genie allein.« (Ebd.) | |
»In der That ist kein musikalischer Inhalt organisch. Es fehlt ihm jeglicher Causalnexus, und niemals hat eine erfundene Melodie einen so bestimmten Willen, dass sie sagen kann, nur jene bestimmte Melodie darf mir folgen, eine andere nicht.« (1895, 148.) | |
Siehe Schenker 1895; Pastille 1984; Keiler 1989; Korsyn 1993; Eybl 1995, 68; Cook 2007, 63–71; Schwab-Felisch i.V.a. | |
Nicholas Cook (2007, 71) bezeichnet das Prinzip, das der Inhaltserzeugung durch schrittweise Diminution des Ursatzes zugrunde liegt, als ›axiale Kausalität‹. Cook entnimmt den Ausdruck ›axial‹ der englischen Übersetzung des Schenkerschen Meisterwerk-Jahrbuchs (1930, 20). Im Original lautet die fragliche Stelle: »Nur der Tiefe-Zusammenhang vom Hinter- zum Vordergrunde ist auch der Breite-Zusammenhang in der Horizontale des Vordergrundes«. Die englische Übersetzung gibt diesen Satz folgendermaßen wieder: »But the axial cohesion that extends from background to foreground is at the same time the lateral cohesion that functions horizontally at foreground level.« (1997, 7) – Das Epitheton ›axial‹, das durch Prägnanz überzeugt, wird im Folgenden zur Bezeichnung von Prozessen zwischen Schichten unterschiedlicher Komplexität übernommen. | |
Siehe Schwab-Felisch i.V.b. | |
Haas/Diederen 2008, 153. | |
Ebd. – Da jede Operation, die zu Mängeln führt, ihrerseits motiviert sein muss, ziehen die Autoren die Konsequenz, den Ursatz als ein ›Unwahres‹, ›Ungegründetes‹ zu verstehen, »bei dem das Werk nicht stehenbleiben kann« (ebd.). | |
Insbesondere die oben zuerst genannte Form, der Widerspruch zwischen einem musikalischen Sachverhalt und einem normativen Hintergrund wie etwa einer Satzregel oder einem Gattungsprinzip, scheint hier relevant. Haas’ und Diederens Begriff des Mangels ist im Übrigen weit zu fassen. Denn neben Sachverhalten, die generativ wirken, weil sie gegen Regeln verstoßen oder als »Häßlichkeiten« begegnen (2008, 167), stehen auch solche, die deshalb zur Auskomponierung motivieren, weil es ihnen an Eigenschaften mangelt, die das fertige Stück besitzen soll: Die Schicht der ›Ausstreuung‹ etwa »hat die Aufgabe, die Stimmverteilung des Originals herzustellen.« (Ebd., 168. – Siehe hierzu auch Polth 2008) Anstatt beide Formen unter den Begriff des ›Mangels‹ zu bringen, könnte man differenzieren, dass manche Sachverhalte motivieren, weil sie als unhaltbar, und andere, weil sie als erstrebenswert gelten. Im einen Fall reagiert der Komponist auf ein Gegebenes, im anderen arbeitet er auf die Erreichung eines konkret bestimmten Zieles hin. | |
Der Kausalitätsbegriff scheint in einem Diskurs, der Schenker nicht allein aus seinen eigenen Voraussetzungen zu verstehen, sondern die Resultate seiner Forschung für heutiges Analysieren fruchtbar zu machen sucht, nicht mehr am Platz. Haas und Diederen betonen, jedes Stück etabliere seine je eigene Kausalität – eine nicht unproblematische Annahme. Trotz aller Divergenzen besteht in der Wissenschaftstheorie weitgehende Einigkeit darüber, dass von Kausalrelationen nur sinnvoll zu sprechen ist, wo das ›Determinismusprinzip‹ erfüllt ist (Stegmüller 1983, 501–582; Meixner 2001, 55–60; Baumgartner/Graßhoff 2004, 68). Eine Kausalität, »die nur im vorliegenden Stück gilt« (Haas/Diederen 2008, 27), muss vor diesem Hintergrund als contradictio in adjecto gelten. Ein lediglich metaphorischer Kausalitätsbegriff aber sollte im Interesse terminologischer Präzision durch angemessenere Begriffe abgelöst werden. | |
Der Schritt von der Quinte f-c zur Sexte fis-d erfolgt demnach durch Setzung eines neuen Oberstimmentons – Schenker bezeichnet dies als ›Übergreifen‹. | |
Der Urlinieton f2 erklingt in der zweiten Oboenstimme (siehe Beispiel 1). | |
Siehe Webster 1991, 152. | |
Der anthropomorphisierende Zug der Beschreibung mag befremden, dient aber in vielen Beiträgen zum Thema musikalische Narrativität als ein bewusst gewähltes Darstellungsmittel. Siehe etwa Treitler 1989, Maus 1991, 7f. | |
Der Frage, inwieweit dieser Erzählzusammenhang im Sinne Anthony Newcombs (1987, 165) als ›paradigmatic plot‹, also als standardisierte Reihe funktionaler Ereignisse in vorgeschriebener Anordnung (»a standard series of functional events in a prescribed order«) zu gelten hat, soll hier nicht weiter nachgegangen werden. | |
»The basic aesthetic activity of ›following a story‹« (Newcomb 1987, 166.) | |
Siehe etwa Cook 2006, 112. | |
Vgl. Maus 1997, 297ff. | |
Vgl. Thorau 2000, 204ff. | |
Eine auditiv induzierte kognitive Dissonanz impliziert die initiale Konstellation des Menuetts deshalb nicht, weil nicht genügend viele Tonsätze vorliegen, aus denen sich ein bestimmtes Schema der Zuordnung struktureller Funktionen zu Tönen des 5-6-Modells induktiv-statistisch extrahieren ließe. | |
Der Terminus ›agency‹ bezeichnet in der englischsprachigen Musiktheorie eine einem musikalischen Sachverhalt zugeschriebene Handlungsträgerschaft. Vgl. Maus 1989; Newcomb 1997; Hatten 2004, passim. | |
Es sei hervorgehoben, dass es sich hier um eine interpretationsinterne Begründungsstruktur handelt, die für sich genommen die Qualität einer Interpretation nicht garantiert: Wahnsysteme können vergleichbare interne Begründungsstrukturen ausbilden. – Das Verfahren unterscheidet sich grundsätzlich von Verfahren, musikalische Bedeutungszusammenhänge anhand von Deskriptionen der musikalischen Oberfläche zu rekonstruieren, etwa dem Versuch Ferdinand Zehentreiters (1996), die Warum-Frage durch den Rekurs auf eine ›Ausdruckslogik‹ zu beantworten, die durch eine Verknüpfung von Beschreibungen qua Einfühlung erschlossener Ausdrucksqualitäten allererst konstituiert wird. | |
Schenker 1956, 205. Zu Schenkers Motivbegriff siehe etwa Redmann i.V. | |
Prozessual ist der Ursatz, weil der imperfekte Ausgangsklang 3/I über die 2/V, also die kombinierte Spannung aus Durchgangston und Oberquintbass, mit der Zwangsläufigkeit und Kohärenz sowohl des Linearen als auch des Quintfalls in den perfekten Schlussklang strebt. – Zur impliziten Dialektik des für die Schichtenlehre fundamentalen Konzepts des Durchgangs siehe Snarrenberg 1997, 67. | |
»Auf dem Wege zum Ziel gibt es in der Kunst der Musik wie im Leben Hindernisse, Rückschläge, Enttäuschung, weite Wege, Umwege, Dehnungen, Einschaltungen, kurz Aufhaltungen aller Art. Darin liegt der Keim all der künstlichen Aufhaltungen, mit denen ein glücklicher Erfinder immer neuen Inhalt ins Rollen bringen kann. In diesem Sinne hören wir im Mittel- und Vordergrund fast einen dramatischen Verlauf.« (Schenker 1956, 20) | |
Vgl. Maus 1991, 12f.; Cook 2006, 112. | |
Eine Darstellung des Narrativs, die auch diesen Aspekten nachginge, ist hier lediglich in Ausschnitten gegeben worden. | |
Im vorliegenden Fall funktioniert das Narrativ, weil es eine Ausgestaltung des Schönbergschen Gedankens der initialen Unruhe darstellt, also auf ein dialektisches Entwicklungsmodell zurückgeht, das selbst wiederum einen narrativen Topos bildet. Siehe etwa Todorov 1977, 111. | |
Zur Diskussion des Eklektizismusproblems in anderen Disziplinen siehe etwa Boenigk 1999, Baumgärtler 2005, Flick 2008. | |
Dazu gehören die separate Durchführung und Präsentation der Teilanalysen sowie die methodologische Reflexion der Resultate. Siehe Cadwallader 2008, Darcy 2008, Roth 2010. | |
Siehe Schwab-Felisch 2005, 356f. | |
Der Typus eines Quintzuges etwa determiniert diastematische Relationen und die grundsätzliche Möglichkeit, dass Instanzen dieses Typus nach bestimmten Regeln auskomponiert werden, lässt aber offen, wie die Auskomponierung konkret beschaffen ist, welche Wiederholungsstrukturen etwa auf der motivischen Ebene realisiert werden und in welchen Proportionen die Zeitspannen, die einzelne Abschnitte des Quintzuges auskomponieren, zueinander stehen. Umgekehrt determiniert der Typus ›Periode‹ bestimmte Ausprägungsklassen unter anderem der Eigenschaften Harmonik, Motivik, Proportion und Wiederholungsstruktur, besagt aber nichts über die kontrapunktisch-linearen Qualitäten eines Gebildes, das den Typus ›Periode‹ instantiiert. | |
Borio 2001, 271ff. | |
Aus diesem Grund wäre eine Reformulierung der Schichtenlehre mit der sprichwörtlichen Amerikanisierung Schenkers, also der unreflektierten Anpassung seiner Theorie an die epistemologischen Grundlagen eines positivistischen Wissenschaftsbetriebs nicht gleichzusetzen; sie widerspräche auch nicht der Erkenntnis, dass Schenker auf Probleme zu antworten gesucht hat, die nicht ausschließlich solche der Musiktheorie waren. – Die Arbeit der Reflexion und Reformulierung ist im Übrigen nichts, was eine einzelne Theorie von Grund auf neu zu leisten hätte: Schenkers Theorie unterliegt diesem Prozess bereits seit etlichen Jahren und in vielerlei Hinsicht (Siehe Brown 2005; Schwab-Felisch 2005, 371–376; 2006; 2008; Polth i.V.). |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1973), Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Albrecht, Michael (1994), Eklektik. Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart: frommann-holzboog.
Aristoteles (1995), Metaphysik (= Philosophische Schriften in sechs Bänden 5), nach der Übersetzung von Hermann Bonitz bearbeitet von Horst Seidl, Hamburg: Meiner.
Baumgärtler, Marcel (2005), Wissenschaftstheoretische und multidisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis, Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang.
Baumgartner, Michael / Gerd Graßhoff (2004), Kausalität und kausales Schliessen. Eine Einführung mit interaktiven Übungen (= Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Educational Materials 6), Bern: Universität Bern.
Böhnigk, Volker (1999), Weltversionen. Wissenschaft zwischen Relativismus und Pluralismus, Wien: Passagen.
Borio, Gianmario (2001), »Schenker versus Schoenberg versus Schenker: The Difficulties of a Reconciliation«, Journal of the Royal Musical Association 126, 250–274.
Brown, Matthew (2005), Explaining Tonality: Schenkerian Theory and Beyond, Rochester: University of Rochester.
Cadwallader, Allen (2008), »Intersections between Two Analytical Perspectives on Sonata Form: The Schenkerian Approach«, in: Essays from the Fourth International Schenker Symposium, Bd. 1, hg. von Allen Cadwallader, Hildesheim u.a.: Olms, 85–102.
Cook, Nicholas (2006), »Uncanny Moments: Juxtaposition and the Collage Principle in Music«, in: Approaches to Meaning in Music, hg. von Byron Almén und Edward Pearsall, Bloomington und Indianapolis: Indiana University Press, 105–134.
––– (2007), The Schenker Project. Culture, Race, and Music Theory in Fin-de-siècle Vienna, New York: Oxford University Press.
Dahlhaus, Carl (1971), »Musiktheorie«, in: Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 2, hg. von Hermann Danuser u.a., Laaber: Laaber 2001, 209–232.
––– (1984), Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Erster Teil. Grundzüge einer Systematik, in: Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 4, hg. von Hermann Danuser u.a., Laaber: Laaber 2002, 237–410.
––– (1985), »Was heißt ›Geschichte der Musiktheorie?‹«, in: Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 2, hg. von Hermann Danuser u.a., Laaber: Laaber 2001, 344–375.
Danckwardt, Marianne (1990), »Zu zwei Haydnschen Sinfoniesätzen mit liturgischer Melodie (Sinfonien Nr. 30, 1. Satz, und Nr. 26, 2. Satz.)«, in: Festschrift Rudolf Bockholdt zum 60. Geburtstag, hg. von Soren Meyer Eller und Norbert Dubowy, Pfaffenhofen: Ludwig 1990, 193–200.
Danuser, Hermann (2010), »Die Kunst der Kontextualisierung. Über Spezifik in der Musikwissenschaft«, in: Musikalische Analyse und kulturgeschichtliche Kontextualisierung. Für Reinhold Brinkmann, hg. von Tobias Bleek und Camilla Bork, Stuttgart: Steiner, 41– 63.
Darcy, Warren (2008), »Intersections between Two Analytical Perspectives on Sonata Form: The Sonata Theory Approach«, in: Essays from the Fourth International Schenker Symposium, Bd. 1, hg. von Allen Cadwallader, Hildesheim u.a.: Olms, 103–109.
Eybl, Martin (1995), Ideologie und Methode. Zum ideengeschichtlichen Kontext von Schenkers Musiktheorie (= Wiener Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 32), Tutzing: Schneider.
––– (2005), »Tonale Musik als vernetztes Stückwerk. Ein Merkmalskatalog der harmonischen Tonalität«, in: Zwischen Komposition und Hermeneutik. Festschrift für Hartmut Fladt, hg. von Ariane Jeßulat u.a., Würzburg: Königshausen & Neumann, 54–66.
Finscher, Ludwig (2000), Joseph Haydn und seine Zeit, Laaber: Laaber.
Flick, Uwe (2008), Triangulation. Eine Einführung (= Qualitative Sozialforschung 12), 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Gjerdingen, Robert (2007), Music in the Galant Style, New York: Oxford University Press.
Göllner, Theodor (1992), »Passions- und Lamentationston in Haydns Sinfonie Nr. 26«, in: Festschrift Hubert Unverricht zum 65. Geburtstag, hg. von Karlheinz Schlager, Tutzing: Schneider 1992, 93–100.å
Haas, Bruno (i.V.), »Die Logik der Schenkerschen Musikanalyse und ihre Bedeutung für die allgemeine Ästhetik« in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, 2 Bde., Hildesheim u.a.: Olms.
Haas, Bernhard / Veronica Diederen (2008), Die zweistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach, Bd. 1 (Text), Hildesheim u.a.: Olms.
Habermas, Jürgen (1973), Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Hatten, Robert S. (2004), Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert, Bloomington und Indianapolis: Indiana University Press.
Hauptmann, Moritz (1873), Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik, 2. Aufl., Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Hepokoski, James / Warren Darcy (2006), Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, Oxford: Oxford University Press.
Huron, David (2006), Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation, Cambridge/Mass: MIT Press.
Jacob, Andreas (2005), Grundbegriffe der Musiktheorie Arnold Schönbergs, Bd. 1, Hildesheim u.a.: Olms.
Jakob, Christian (2008), Wissenschaftstheoretische Grundlagen sozial- und geschichtswissenschaftlicher Erklärungen, Bern: Bern Studies in the History and Philosophy of Science.
Kabisch, Thomas (2009), »Hans Kellers Functional Analysis und die Voraussetzungen des differentiellen Hörens«, Musik & Ästhetik 13/49, 72–86.
Keiler, Allan R. (1989), »The Origins of Schenkers Thought: How Man is Musical«, Journal of Music Theory 33/2, 273–298.
Kerman, Joseph (1980), »How We Got into Analysis, and How to Get Out«, Critical Inquiry 7, 311–331.
Korsyn, Kevin (1993), »Schenker’s Organicism Reexamined«, Integral 7, 82–118.
Krebs, Harald (1994), »Rhythmische Konsonanz und Dissonanz«, Musiktheorie 9/1, 27–37.
Leichtentritt, Hugo (1979), Musikalische Formenlehre, 11. Aufl., Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Lerdahl, Fred / Ray Jackendoff (1983), A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge/Mass.: MIT Press.
London, Justin (2004), Hearing in Time. Psychological Aspects of Musical Meter, New York: Oxford University Press.
Luhmann, Niklas (1970), »Funktion und Kausalität«, in: ders., Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln und Opladen: Westdeutscher Verlag, 9–30.
Lyotard, Jean-François (2009) Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, 6. Aufl., hg. von Peter Engelmann, Wien: Passagen.
Maus, Fred Everett (1989), »Agency in Instrumental Music and Song«, College Music Symposium 29, 31–43.
––– (1991), »Music as Narrative«, Indiana Theory Review 12, 1–34.
––– (1997), »Narrative, Drama, and Emotion in Instrumental Music, Journal of Aesthetics and Art Criticism 55/3, 293–303.
Meixner, Uwe (2001), Theorie der Kausalität. Ein Leitfaden zum Kausalbegriff in zwei Teilen, Paderborn: mentis.
Neff, Severine (1993), »Schoenberg and Goethe. Organicism and Analysis«, in: Music Theory and the Exploration of the Past, hg. von Christopher Hatch und David W. Bernstein, Chicago: University of Chicago Press, 409–433.
Newcomb, Anthony (1987), »Schumann and the Late Eighteenth-Century Narrative Strategies«, 19th-Century Music 11/2, 164–174.
––– (1997), »Action and Agency in Mahler’s Ninth Symphony, Second Movement«, in: Music and Meaning, hg. von Jenefer Robinson, Ithaca: Cornell University Press, 131–153.
Nowak, Adolf (1999), »Musikalische Logik – philosophische Logik«, in: Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis von Musik und Philosophie, hg. von Christoph Asmuth u.a., Frankfurt a.M. und New York: Campus, 175–192.
––– (2005), Art. »Musikalische Logik«, in: Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, hg. von Hans Heinrich Eggebrecht und Albrecht Riethmüller, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
Pastille, William Alfred (1984), »Heinrich Schenker, Anti-Organicist«, 19th-Century Music 8/1, 28–36.
Polth, Michael (2008), »Satztechnische und strukturelle Stimmführung im frühen 18. Jahrhundert. Zur Bedeutung des Fugensoggettos für den musikalischen Zusammenhang«, ZGMTH 5/2–3, 249–286.
––– (i.V.), »›Sonatenform‹ als Funktionalität. Formbildung um 1775 aus post-Schenkerscher Perspektive«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, 2 Bde., Hildesheim u.a.: Olms.
Redmann, Bernd (i.V.), »Zum Problem des Motivischen bei Schenker«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, 2 Bde., Hildesheim u.a.: Olms.
Riemann, Hugo (1874), Musikalische Logik. Hauptzüge der physiologischen und psychologischen Begründung unseres Musiksystems, Leipzig: C.F. Kahnt.
Roth, Markus (2010), »Les Ombres Errantes. Vier Sichtweisen auf Satztechnik und Kombinatorik bei François Couperin«, ZGMTH 7/2 (2010). http://gmth.de/zeitschrift/artikel/514.aspx
Schenker, Heinrich (1895), »Der Geist der musikalischen Technik«, in: Heinrich Schenker als Essayist und Kritiker. Gesammelte Aufsätze, Rezensionen und kleinere Berichte aus den Jahren 1891–1901, hg. von Hellmut Federhofer, Hildesheim u.a.: Olms 1990, 135–154.
––– (1910), Kontrapunkt. Erster Halbband: Cantus firmus und zweistimmiger Satz (= Neue musikalische Theorien und Phantasien 2), Wien und Leipzig: Universal Edition, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1991.
––– (1930), Das Meisterwerk in der Musik. Ein Jahrbuch, Bd. 3, München: Drei Masken, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1974.
––– (1956), Der freie Satz (= Neue musikalische Theorien und Phantasien 3) [1935], 2. Aufl. hg. von Oswald Jonas, Wien: Universal Edition.
Schönberg, Arnold (1967), Fundamentals of Musical Composition, hg. von Gerald Strang und Leonard Stein, London: Faber and Faber.
––– (1995), The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, hg. von Patricia Carpenter und Severine Neff, New York: Columbia University Press.
Schurz, Gerhard (2008), Einführung in die Wissenschaftstheorie, 2. Aufl., Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Schwab-Felisch, Oliver (2005), »Zur Schichtenlehre Heinrich Schenkers«, in: Musiktheorie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft 2), hg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch, Laaber: Laaber, 337–376
––– (2006), »Vorwort«, in: Essays from the Third International Schenker Symposium, hg. von Allen Cadwallader, Hildesheim u.a.: Olms, ix–xi.
––– (2007), »Umriss eines allgemeinen Begriffs des musikalischen Satzmodells«, ZGMTH 4/3 (2007), 291–304. http://gmth.de/zeitschrift/artikel/262.aspx
––– (2008), »Vorwort«, in: Essays from the Fourth International Schenker Symposium, Bd. 1, hg. von Allen Cadwallader, Hildesheim u.a.: Olms, ix–xiii.
––– (2009), »Wie totalitär ist die Schichtenlehre Heinrich Schenkers?«, in: Systeme der Musiktheorie, hg. von Clemens Kühn und John Leigh, Dresden: Sandstein, 33–55.
––– (i.V.a), »Die ›streng logische Bestimmtheit im Zusammenhang einfacher Tonfolgen mit komplizierten‹. Zu Heinrich Schenkers Begriff musikalischer Logik«, in: Musikalische Logik und musikalischer Zusammenhang, hg. von Patrick Boenke und Birger Petersen, Hildesheim u.a.: Olms.
––– (i.V.b), »Bild und Wort. Wege der Erklärung in Analysen Heinrich Schenkers«, in: Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. Bericht über den internationalen Schenker-Kongress in Berlin, Sauen und Mannheim, 4.–12. Juni 2004, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Michael Polth und Hartmut Fladt, 2 Bde., Hildesheim u.a.: Olms.
Snarrenberg, Robert (1997), Schenker’s Interpretive Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Stegmüller, Wolfgang (1983), Erklärung, Begründung, Kausalität (Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie 1), Berlin u.a.: Springer.
Tarasti, Eero (2002), Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics (= Approaches to Applied Semiotics 3), Berlin und New York: Mouton de Gruyter.
Thorau, Christian (2000), »Invasion der fremden Prädikate – Struktur und Metapher in der Musikbeschreibung (Beethoven, Klaviersonate op. 31,2)«, in: Klang – Struktur – Metapher. Musikalische Analyse zwischen Phänomen und Begriff, hg. von Michael Polth, Oliver Schwab-Felisch und Christian Thorau, Stuttgart und Weimar: Metzler, 199–218.
Todorov, Tzvetan (1977), The Poetics of Prose, Oxford: Blackwell.
Treitler, Leo (1989), »Mozart and the Idea of Absolute Music«, in: Music and the Historical Imagination, hg. von dems., Cambridge/Mass. und London: Harvard University Press, 176–214.
Webster, James (1991), Haydn's »Farewell« Symphony and the Idea of Classical Style. Through-Composition and Cyclic Integration in His Instrumental Music (= Cambridge Studies in Music Theory), Cambridge: Cambridge University Press.
––– (2009), »Formenlehre in Theory and Practice«, in: Musical Form, Forms, and Formenlehre. Three Methodological Reflections, hg. von Pieter Bergé, Leuven: Leuven University Press, 123–139.
Wimsatt, William K. / Monroe C. Beardsley (1946), »The Intentional Fallacy«, Sewanee Review 54, 468–488.
Zehentreiter, Ferdinand (1996), »Bruch und Kontinuität in Beethovens späten Quartetten. Einige Überlegungen zur Werk- und Bedeutungsanalyse«, Musiktheorie 11/3, 211–240.
Technische Universität Berlin [Technische Universität Berlin]
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.