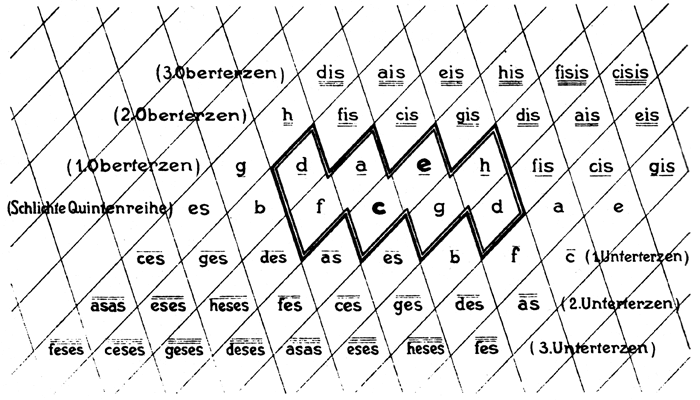Von unten und von oben?
Hugo Riemanns reflexive Theorie in der Moderne
Hermann Danuser
Hugo Riemann repräsentiert mit seinem die Grenzen von Musiktheorie, Musikwissenschaft und Musikgeschichte übergreifenden Schaffen ein Wissenschaftsverständnis, dem man seine Zeitgebundenheit heute – nach 100 Jahren – anmerkt. Im Zentrum der Moderne um 1900 stehend, ist sein Verhältnis zur zeitgleichen ästhetischen Moderne gespannt bis ablehnend. Wenn Riemanns Theorie in ihren selbstreflexiven Zügen, in ihrem ordnenden, alles vermessenden Zugriff und in ihrem Systemanspruch durchaus Zeichen von Modernität trägt, so kann seine fehlende Sensibilität für das ästhetische Moderne heute, in der postmodernen Moderne, doch als Signum für die Begrenztheit seines Ansatzes gelten. Der Beitrag kontextualisiert den Wissenschaftler Riemann mit Blick auf die Terminologie, auf Aspekte von Reflexivität in den Bereichen der Theorie, der Philosophie und der Musik und formuliert abschließend eine Kritik an Riemanns totalisierender Kartographie der Musik.
Hugo Riemann’s oeuvre surpasses the borders of music theory, musicology and music history and therefore represents a conception of scholarship that seems – after 100 years – not timely any more. Located in the center of modernity around 1900, his relationship to aesthetic modernism remains fraught and dismissive. Against the background of its self-reflective aspects, its regulative and cartographic approach, and its systematic outlook, Riemann’s theory carries signs of modernity. On the other hand, his approach seems to lack a sensibility for aesthetic modernity, which amounts today – in postmodern modernity – to a sign for the narrowness of his approach. The essay contextualizes the ‘Wissenschaftler’ Riemann with regard to terminology, aspects of reflexivity in the realms of theory, philosophy and music and finally formulates a critique of Riemann’s totalizing cartography of music.
Wer in Riemanns Musik-Lexikon aus dem Jahre 1900 die Artikel »Theorie« und »Wissenschaft« sowohl miteinander als auch mit den heutigen Inhalten der Begriffe vergleicht, wird auf interessante und gravierende Differenzen stoßen, über die die Tatsache nicht hinwegtäuschen darf, dass beide Begriffe auf etymologischen Quellen beruhen, die indogermanisch ›betrachten‹ bzw. ›sehen‹ bedeuten.[1] Die »Theorie« (der Musik), eingeteilt in praktische und spekulative, wird als ehrwürdige Disziplin vorgestellt, deren Jahrhunderte alte Traditionen der Urheber des Lexikons in eine »endgültige« Fassung brachte; die »Wissenschaft« dagegen als eine sehr junge Disziplin innerhalb der im 19. Jahrhundert neu begründeten, damals weltweit führenden deutschen Universitätslandschaft, auf deren noch zu erschließendem Terrain der Lexikograph seinen Platz suchte und letztlich fand. Aufgrund ihres unverzichtbaren, höheren Praxisbezugs war die Theorie schwerpunktmäßig an Konservatorien und Musikhochschulen, die Wissenschaft hingegen aufgrund ihres von Praxis losgelösten Erkenntnisanspruchs an Universitäten angesiedelt[2], doch banden sekundäre Funktionen das andere Gebiet an beiden Institutionen ebenfalls ein: die Theorie als Propädeutik und Theoriegeschichte auch an Universitäten, die Wissenschaft als Historie und praxisbezogene Forschung auch an Musikhochschulen. An dieser grundsätzlichen Situation hat sich bis heute wenig geändert, wenngleich die Methoden, Inhalte und Aufgaben der Fachgebiete eine weite Entwicklung vollzogen haben und die Lage in einzelnen Regionen, Ländern und Kontinenten naturgemäß sehr unterschiedlich ist. In den letzten Jahrzehnten wuchs die Wissenschaft beispielsweise an Musikhochschulen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, und parallel dazu entwickelte sich auch die Theorie durch Gründung einer Gesellschaft für Musiktheorie (im Jahre 2000) sowie einer Fachgruppe »Musiktheorie und Analyse« innerhalb der Gesellschaft für Musikforschung (im Jahre 2010) stärker in eine wissenschaftliche Richtung. Während Bemühungen des Autors, in der Zeit seiner Mitherausgeberschaft der Zeitschrift Musiktheorie um 1990 eine solche Fachgruppe zu gründen, noch erfolglos geblieben waren, scheinen heute die Disziplinen teilweise sogar zu konvergieren: Die Zeitschrift Musiktheorie trägt seit einigen Jahren den Untertitel »Zeitschrift für Musikwissenschaft«, und entsprechende Synergien haben in der mehrbändigen Geschichte der Musiktheorie des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz Berlin und der einbändigen Cambridge History of Western Music Theory ihren Niederschlag gefunden.[3]
Was Riemanns eigene Forschungs- und Publikationstätigkeit betrifft, so fand die Frage, wie sich die Bereiche ›Theorie‹ und ›Wissenschaft‹ in seinem umfangsmäßig jeden Versuch einer Übersicht sprengenden Schaffen zueinander verhielten, unterschiedliche Antworten. Riemann habe sich, meinte sein Schüler Wilibald Gurlitt, »immer nur zum Musiktheoretiker, nicht aber zum Musikhistoriker berufen gefühlt«, und weil er zu musikgeschichtlichen Studien »allererst durch die Vorarbeiten zu seinem Musiklexikon gekommen« sei, sei es »kein eigentlich speziell musikgeschichtliches, sondern ein mehr enzyklopädisches Anliegen, das ihn zur Musikgeschichte hingeführt« habe.[4] Alfred Einstein dagegen erkannte bei Riemann zwischen beiden Disziplinen ein komplementäres, wechselweise sich ergänzendes Verhältnis: »Die Einheitlichkeit seines Schaffens ist außerordentlich: der Theoretiker steht im Dienst des Historikers, der Historiker schafft dem Theoretiker Stoff aus allen, den nächsten und entlegensten Gegenden herbei. Man muß, will man ihm ganz folgen und ihn ganz verstehen, ihn auch ganz kennen.«[5]
Kann Riemanns Schaffen als paradigmatisch für jene ›Moderne‹ gelten, die Carl Dahlhaus mit begrenzter Bedeutung – als eigene Epoche von 1880 bis 1920 – in die Musikhistoriographie eingeführt hat? Inwiefern steht die damals entwickelte Modernitätsidee jüngeren Vorstellungen, zumal einer »postmodernen Moderne«[6], entgegen, inwieweit lassen sich umgekehrt über die Zeiten hinweg Verwandtschaftsbezüge ausfindig machen? Und vor allem: Kann eine Doppelung der Tätigkeitsfelder in der Art, wie Einstein sie für Riemann – ob zu Recht oder zu Unrecht – reklamiert, für eine aktuelle Musikwissenschaft, die Theorie mit sich führt, sie sogar notwendig in ihre Untersuchungen einbezieht, ohne indessen auf sie im Sinne einer alles erklärenden Universallehre zu zielen[7], noch wichtig sein? Im Horizont solcher Fragen vollzieht mein Gedankengang mehrere Schritte. Ich beginne mit einleitenden Überlegungen zur Begrifflichkeit der Riemannschen Schriften und diskutiere einige Beispiele im Licht gegenwärtiger Debatten um Begriffsgeschichte und Metaphorologie. Dann schildere ich in Grundzügen selbstreflexive Aspekte von Riemanns Musiktheorie, denn das Maß an Selbstreflexivität ist auch hier ein untrügliches Signum für Modernität. Und schließlich ziehe ich in zwei weiteren Abschnitten eine kritische Bilanz des Riemannschen Erbes, indem ich – an Alexander Rehding anknüpfend[8] – den historischen Ort des Theoretikers im Horizont seiner Moderne-Vision umreiße, die sich dadurch, dass nunmehr die »Neo-Riemannians« eine wichtige Richtung zeitgenössischer Musiktheorie markieren, als eine fruchtbare, wenngleich korrekturbedürftige ›Legacy‹ erwiesen hat.
1. Metaphern oder Begriffe? Einleitendes zur Terminologie
Zum Wissenschaftler bzw. Theoretiker wurde Hugo Riemann, weil er als Komponist erfolglos blieb, und zur Komposition wiederum kam er erst, nachdem sein Wunsch, sich als Dichter zu etablieren, gescheitert war.[9] Sind seine Schriften also aufgeladen mit verdrängten Energien eines Komponisten und dem schwachen Nachhall von Poesie? Nicht unbedingt, aber die Frage, wie ein solcher Autor seine Terminologie formte, ist damit gestellt, und es kann nicht verwundern, dass die Debatte um Begriff und Metapher auch bei ihm fortgesetzt wird. Immerhin widersprechen sich Riemann-Forscher bei den zentralen Ausdrücken ›musikalische Logik‹ und ›musikalische Syntax‹: Adolf Nowak – in der musikphilosophisch-deutschen Tradition – nennt sie »Begriffe«, Alexander Rehding dagegen – im angelsächsischen Horizont – vorsichtiger »Metaphern«.[10] Macht dies einen großen Unterschied aus? Immerhin hat Nowak einen Artikel »musikalische Logik« für das Handwörterbuch der musikalischen Terminologie (HmT) verfasst, welches keine Metaphern, sondern nur kulturell etablierte Musiktermini behandelt. Grundsätzliche Aspekte dieser Differenzen waren bei der Begründung der begriffsgeschichtlichen Großprojekte Historisches Wörterbuch der Philosophie und Geschichtliche Grundbegriffe diskutiert worden, in denen man auf Metaphern-Lemmata bewusst verzichtet hatte.[11] Nunmehr aber, da die Werke abgeschlossen vorliegen, hat die Blumenbergrezeption das Interesse an Metaphorologie wieder entfacht, und auch musikwissenschaftlich zeichnet sich in der Begriffsforschung Neues ab.[12] Ohnehin gelangten die allermeisten Termini, die oft seit Jahrzehnten und Jahrhunderten sprachlich verankert sind, ursprünglich als Metaphern aus anderen Gebieten, insbesondere der Sprach- und Stillehre, in die Musiktheorie, so dass der Metaphern-Status ihre Genese treffend chiffriert.[13] Angesichts solcher Ambiguitäten haben beide Seiten Recht: Die Ausdrücke der Musiktheorie, jedenfalls die beiden genannten, sind einerseits ›weiche‹, flexible Begriffe, die man mit philosophischen, naturwissenschaftlichen oder juristischen Begriffen nicht gleichsetzen darf, andererseits sind sie so tief und dauerhaft etabliert, dass sie die Überraschungskraft neuer, kreativer Metaphern schon längst verloren haben.
Vor dem Hintergrund solcher Diskussionen zeigt sich Riemanns Bild in der Moderne gegenüber seinem Antipoden Hermann Kretzschmar – Riemann, der Theoretiker und Systematiker, stehe auf Seiten des Begriffs, der in der Praxis wurzelnde Kretzschmar dagegen auf Seiten der Metapher – deutlich verschoben. Riemanns eigene Begriffswelten haben ihr Fundament in der Sache eingebüßt und erscheinen ihrerseits als metaphorische Konstrukte. Seine Theorie ist rund einhundert Jahre nach ihrer Ausformulierung zu einem Teil jener Geschichte geworden, als deren Zielpunkt sie der Autor anvisiert hatte, und die Forschung hat die Verflechtungen im Kontext der Theorie und Philosophie seiner Zeit vielfach aufgewiesen.[14] Drei Prägungen – Begriffe oder Metaphern – seien nun am Beispiel beleuchtet.
Wie ist ›Reflexion‹ in Riemanns Vokabular eingesetzt, positiv, negativ oder neutral? Ein unbegrenztes Reflektieren – im Sinne einer ins Unendliche strebenden progressiven Universalpoesie – entspräche gewiss nicht seinem System, trotzdem kommen Ansätze des späten Riemann, der für Schaffen und Hören eine aktive Tätigkeit der Reflexion betont, dem Begriff direkt entgegen. Im Vorwort zum dritten Band der Großen Kompositionslehre (1913) heißt es:
Auch ist wohl zu erwägen, daß doch die geschlossene Melodiebildung gegenüber der frei deklamatorischen eine höhere Stufe der Entwicklung repräsentiert, auch nach Wagner und in Wagners Musikdramen selbst, und daß die Auflösung der geschlossenen Melodie in die ›unendliche‹ Melodie das Ergebnis einer späten künstlerischen Reflexion ist, welche in keiner Weise die Bedeutung der geschlossenen Formen als gesteigerter Bildungen in Frage stellen kann.[15]
Die Art und Weise, wie Riemann hier den Reflexionsbegriff mit den Attributen »spät« und »künstlerisch« verknüpft, zeigt eine Unentschiedenheit zwischen einer von ihm vermiedenen Abwertung der Reflexion als etwas ›Intellektuellem‹ und einer pejorativen Apostrophierung der »unendlichen Melodie« als einem misslichen Resultat der Moderne.[16] Allerdings vermag der Versuch, die »unendliche Melodie« mit einer »geschlossenen Melodiebildung« zu versöhnen, für deren Grundriss – die Quadratur der musikalischen Syntax – Wagner selbst nur Hohn und Spott erübrigt hatte, schwerlich zu überzeugen. Wenngleich Wagners Ansehen drei Jahrzehnte nach seinem Tod eine billige Polemik verbot, beharrte Riemann – nicht anders als Schenker – auf seinen Prinzipien.
Ähnliche Unentschiedenheiten verdeutlicht ein weiteres Beispiel. Im letzten Kapitel (»Musikalische Logik«) der Geschichte der Musiktheorie findet sich folgende Wendung:
Das ist das eigentliche System des konstruktiven Theoretikers Rameau, eine, wenn auch nicht unpraktische, so doch gewiß äußerst hausbackene und trockene Lehre, die im Grunde nicht einmal neu war, sondern unausgesprochen seit Aufkommen der Generalbaßbezifferung in der Praxis der Cembalisten allmählich so weit sich herausgebildet hatte […], daß nur die deutliche Hinstellung in Gestalt kurzer Lehrsätze als neu wirkte.[17]
Die Formulierung bildet kein Entréebillet in Sphären eines methodologischen ›Konstruktivismus‹, das Riemann auf dem Boden der aufgeklärten Moderne sicher verankerte, denn das Attribut ›konstruktiv‹ ist im gegebenen Zusammenhang keineswegs positiv gemeint. Das Wort übersetzt vielmehr den zuvor angeführten, von Riemann abgelehnten »Terzenaufbau der Akkorde«[18] in einen lateinischen Terminus. Offensichtlich wollte Riemann seine Theorie, die in heutiger Sicht einem wissenschaftlichen ›Konstruktivismus‹ stark ähnelt, aus der ›Natur‹ des Tonsystems, nicht über ›konstruktive‹ Wege begründen.
Ein weiterer Ausdruck, der beleuchtet zu werden verdient – »Manipulation« –, findet sich mehrfach in Riemanns Schriften. In den »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹« z.B. lautet eine Passage:
Der Verwandtschaftsgrad der Tonikaprimen stellt sich aber durch diese Manipulation heraus als (Q = Quintschritt nach oben, T = Terzschritt nach oben […]. Das Gesetz möglichster Ökonomie des Vorstellens zeigt hier also seine zwingende Kraft mit großer Deutlichkeit.[19]
Heutzutage schleppt in der deutschen Sprache ›Manipulation‹ als Verfahrensweise mit dem Ziel einer Fälschung unzweifelhaft negative Konnotationen mit sich, bei Riemann indes war dies noch anders. Zu den Kunst- und Zugriffen, die dieser Autor an den Materialien als Quellen der Theoriegeschichte bzw. an den Werken als Quellen der Musikgeschichte vornahm, fühlte er sich offenbar legitimiert. Historisch bedeutete ›Manipulation‹ zu Riemanns Zeiten noch schlicht ›Handhabung‹.[20]
2. Reflexion der Musik in ihrer Theorie
»Daß das Musikhören nicht nur ein passives Erleiden von Schallwirkungen im Hörorgan sondern vielmehr eine hochgradig entwickelte Betätigung von logischen Funktionen des menschlichen Geistes ist, zieht sich als leitender Gedanke durch meine sämtlichen musiktheoretischen und musikästhetischen Arbeiten seit meiner Dissertation.«[21] Der bekenntnishafte Anfangssatz der »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹« suggeriert in Riemanns Entwicklung als Musikwissenschaftler und -theoretiker eine große Kontinuität. Ungeachtet der Frage, ob diese Selbsteinschätzung triftig sei oder nicht, verdient die Akzentuierung unser Interesse. Sie siedelt das Hören dort an, wo die Reflexionstätigkeit menschlicher Rationalität ihre Arbeit vollzieht, und hat somit wesentlichen Anteil daran, dass Musik aus einer Sphäre bloßen ›Genießens‹ – »mehr Genuss als Kultur«, hieß es über sie noch bei Kant[22] – geholt und in Regionen des ›Geistes‹ versetzt wird.
›Musik als Erkenntnis‹ funktioniert freilich, Simone Mahrenholz hat es in ihrer Dissertation gezeigt[23], nicht wie ein kognitives Begreifen; ohnehin steht dieser Reflexionsvorgang in einem schwierigen Verhältnis zur Wortsprache. Während Kretzschmar der Tonkunst durch metaphorische Kontextualisierungen eine ›Welthaftigkeit‹ zu sichern sucht – aufgrund ihrer Verbindung mit anderen Künsten und Medien sei Musik eine »geborene Hilfskunst«[24] –, steht für Riemann die Musik weit von der Verbalsprache entfernt, ja sie bildet in vielem eine andere Sphäre als diese aus, wenngleich auch sie von einer ›Logik‹ der Knoten und Folgen getragen wird.
Dieses aktive Element – die ›Verknüpfung‹ der sinntragenden Einheiten im Hörvorgang, in welchem sich die Phantasie des schaffenden Künstlers spiegelt – begründet hier in Bezug auf den Rezipienten eine psychische Reflexion der Musik. Den Abschnitt »Tonhöhe und absolutes Ohr« beschließt Riemann, ein Spross der Epoche um 1900, mit den Sätzen:
So ergibt sich also vermöge der Wertung der Tonhöhenbewegung als wechselnde Erhebung und Senkung, als Anstreben und Entsagen, Wollen und Verzichten, ein seelisches Erleben, das einem Aufsteigen in lichtere Regionen und einem Zurücksinken in dunklere gleicht, wie der Flug des Vogels in der Luft oder das Schwimmen des Fisches im Wasser, aber nicht als etwas Angeschautes, sondern als etwas Selbsterlebtes. Das Vorstellen dieser Bewegungen ist ein wirkliches Mitmachen derselben mit dem Willen; die Seele, der lebendige Menschengeist, führt selbst diese Bewegungen aus und erfreut sich in ihnen seines Daseins, seiner Wirkungskräfte. […][25]
Indem die Klangbewegung gedeutet wird als Allegorie des menschlichen Lebens, rückt die Passage ihren Autor in die Nähe psychophysischer Interpreten der Tonkunst.[26] Dem Begriff »Anschauung«, den Hanslick der Theorie absoluter Musik zugewiesen hat[27], scheint aktives Handeln zu fehlen, ein Mangel, den an dieser Stelle die Partizipialform »Angeschautes« unterstreicht[28], demgegenüber bei »Selbsterlebtes« eigene Subjektivität mitschwingt. »Selbsterleben«, wie es hier fassbar wird, schillert somit nach zwei Seiten: Als Indikator einer ›absoluten Musik‹ meint der Begriff einerseits, dass die Tonkunst losgelöst von jedem Bezug zu anderen medialen Dimensionen, zum Sichtbaren, Theatralen, Fühl- und Spürbaren, vorausgesetzt werden soll, als Indikator einer auf den hörenden Menschen bezogenen Musik verweist er andererseits darauf, dass die Spiegelungen nicht einem mechanischen Widerhall, einer optischen Reflexion, passiven Vorgängen also vergleichbar sind, sondern im Gegenteil – parallel zur Mise en abyme[29] – eine ›aktive‹ Tätigkeit des Geistes implizieren. Von diesem Ort aus öffnen sich Beziehungen zu Dahlhaus’ Wissenschaft – Theorie und Historiographie zugleich –, welche die Musik immer in einem selbstreflexiven Sinne zu verstehen und zu begründen suchte, wie zu Adornos Hörertypologie, die ein »gänzlich adäquates«, »strukturelles« Hören, das unter Selbstreflexion fiele, an oberste Stelle setzte.[30]
Wenn Riemann am Schluss der Geschichte der Musiktheorie behauptet, sein Standpunkt habe ein »felsenfestes Fundament«[31], so gründet diese These auf dreierlei: der Theorie, der Philosophie und der Musik.
Theorie
Carl Dahlhaus’ berühmter Satz, das »System der Ästhetik« sei »ihre Geschichte«[32], löst den Systemanspruch der Ästhetik auf und deutet ihn in eine Anzahl dogmatischer Normen um; bei Riemann verhält es sich, zu einer anderen Zeit, gerade umgekehrt: Die Geschichte dient hier der Erkenntnis eines – seines – Systems. Am Ende der Geschichte der Musiktheorie schreibt Riemann, nahezu alle von ihm in sein Universum eingefügten Theoreme seien schon einmal früher gedacht worden und dann meist in Vergessenheit geraten, so dass er selbst, einem Archäologen vergleichbar, die theoretische Reflexion aus ihrer Geschichte in ein allgemeines, dauerhaftes System zu bringen gehabt habe. Er empfiehlt daher, die »historische Arbeit besonders in ihrem dritten Teile [scil. der ›Harmonielehre‹] zugleich als einen Rechenschaftsbericht über die Herkunft meiner Ideen zur Theorie der Musik« anzusehen.[33] Dies nötigte ihn mehrfach zu einer Revision früherer Thesen, indem die für den Dualismus zentrale Untertonreihe zunächst dem Hören, dann nur noch dem Wissen und schließlich einem hypothetischen Meinen zugewiesen wurde, ohne dass sie dadurch an Relevanz eingebüßt hätte.[34] Wichtiger aber als diese persönlichen Modifikationen war die Einsicht, dass die Geschichte der Musiktheorie, jedenfalls in ihrer neueren Zeit, eine Stationenkette zunehmend selbstreflexiver Akte bilde, die schließlich in die eigene Theorie der Musik münde. Mit dieser Auffassung zeigt sich Riemann, auch Peter Rummenhöller hat es betont[35], als typischer Exponent einer Wissenschaft der Gründerzeit, die – von Zweifeln nicht angekränkelt – die Geschichte zur Suprematie emportrieb, bis die Katastrophen des Ersten und später des Zweiten Weltkriegs den Wahn in Stücke rissen.
Philosophie
Die philosophischen Hintergründe Riemanns haben Rummenhöller, Nowak und Rehding bereits umfassend ausgeleuchtet, wobei man freilich zwischen expliziten Referenzen und mutmaßlichen Verweisen, deren Identifikation schwieriger ist und vage bleiben muss, zu unterscheiden hat. Pate steht Fichtes Dialektik des Selbst: »Ich – nicht-Ich – limitierend Ich-nicht-Ich«.[36] Moritz Hauptmann hatte zuvor, um musiktheoretische Vorgänge in einem philosophischen Rahmen zu verankern, sich auf Hegels Logik gestützt.[37] Aber auch zeitgenössische Philosophen sind für Riemanns Theoriebildung wichtig: Christoph Sigwart (zweibändige Logik, 1873 und 1878), Hermann Lotze (Logik. Drei Bücher vom Denken, vom Untersuchen und vom Erkennen, 21880), Hans Vaihinger (Philosophie des Als-Ob, 1876-77, publ. 1911), und Gustav Theodor Fechner (Vorschule der Ästhetik, 21897). Basal blieben die Modelle der idealistischen Dialektiker, die aus der Spaltung einer unreflektierten, unmittelbar gegebenen Entität im Prozess der Reflexion zunächst in die Antithese – beim Kadenzmodell von der Tonika zur Subdominante – und danach durch Synthese zur vermittelten Einheit – von der Dominante zur Tonika zurück – führen.
Dass man mit der dialektischen Bewegung ein Modell der Vernunft, das an alte Traditionen anschließt, sie aber umformuliert, dem musikalischen Klangvorgang zugrunde legte, trug zur ›Nobilitierung‹ der Tonkunst ungemein bei. Doch warum schloss Riemann explizit weniger an Hegel als an Fichte an? Hängt dies mit musikexternen, nationalen Aspekten der Theorie zusammen, war Fichte doch weit stärker noch als Hegel ein Deutsch-Nationaler? Oder mit der Tatsache, dass Riemann der Wende zum Selbstbewusstsein, zur Subjektivität, die sich bei Fichte stärker als bei Hegel abzeichnete, eine besonders große Bedeutung beimaß?[38]
Wie immer man die Riemannsche Systematik philosophiegeschichtlich auch kontextualisieren mag – wir werden weiter unten auf solche Fragen zurückkommen –, sie präsentiert sich nach allen Seiten ausgefaltet in mächtiger Vollständigkeit. Der Eingangssatz des Kapitels 16 der Geschichte der Musiktheorie lautet: »Fragt man sich, worin eigentlich die Aufgabe der Theorie einer Kunst bestehe, so kann die Antwort nur lauten, dass dieselbe die natürliche Gesetzmäßigkeit, welche das Kunstschaffen bewußt oder unbewußt regelt, zu ergründen und in einem System logisch zusammenhängender Lehrsätze darzulegen habe«.[39] Dieser Satz zeigt eine philosophisch-wissenschaftliche Inklination, die bald an Grenzen der Geschichte stoßen sollte; im Lichte des aktuellen Wissensstandes kann sie nicht aufrechterhalten werden. An anderer Stelle evoziert Riemann emphatisch »neuere höhere Gesetze«, die er im Vergleich zu seinen Vorgängern und deren Unternehmen formuliert habe, um sie als Bollwerk gegen eine Kunstanarchie der entfesselten Moderne in Stellung zu bringen:
Der Schüler der Komposition muß sich, nachdem die Praxis die Gesetzestafeln der alten Schulregeln durchbrochen hat, neuerer höherer Gesetze bewusst werden, nach denen er schaffen, nach denen er die Schöpfungen der Meister beurteilen kann: nur so ist es möglich, der Richtung unserer modernen Theoretiker und Praktiker auf Formlosigkeit und Willkür zu begegnen.[40]
Musik
Den dritten Pfeiler, die Musik, repräsentieren bei Riemann zahlreiche Editionen und Analysen. Diese Aktivitäten verfolgen das Ziel, seine Theorie zum Leuchten, zum Glänzen, zum Strahlen zu bringen – auszublenden waren demnach sämtliche Elemente, die in Widerspruch zu ihr aufgefasst werden konnten. Dass Riemanns Analysen weniger dazu dienen, Musikwerke in ihrer Individualität zu verstehen, als ihre Übereinstimmung mit den Regeln des Systems – dem Boden sinnvoller Musik – aufzuzeigen, ist oft behauptet und gelegentlich erwiesen worden. Wir brauchen den Nachweis nicht noch ein weiteres Mal zu führen, solche Meta-Analysen finden sich bei Dahlhaus, Rehding und anderen in Fülle – doch was bedeuten sie für eine Reflexion der Musik?
Hierdurch scheint sich nämlich der letzte Pfeiler, die Musik selbst, zu verschieben. Meinte er zunächst die Gesamtheit aller Praxis und ihrer Grundsätze, jenseits derer Musik nicht existieren könne, so wird dieses Fundament, Basis einer systemimmanenten Selbstreflexion im Sinne des Gesetzgebers Hugo Riemann, ausgehöhlt und von einer Tendenz abgelöst, die durch Mehrfachstudien den Reflexionsvorgang musikalischer Analyse überhaupt in Bewegung hält und damit eine Selbstreflexion der Musik als offenen, unendlichen Prozess ihrer Bewusstwerdung durch Analyse begründet. Typische Beispiele, Signum ihrer Klassizität, bieten Beethovens Sonaten op. 31 Nr. 2 und op. 53.[41] Riemann analysiert die Waldstein-Sonate; Rehding bemerkt, dass dessen Systemzwang – das Verstehen von Musik innerhalb des Fundamentalmodells nach dem philosophisch approbierten Dialektik-Schema T → S → D → T – nur »funktioniere«, wenn wesentliche Evidenzen dieser Musik wie die parallelen Sequenzglieder der Anfangstakte mit den Halbschlüssen nach G- bzw. F-Dur außer Acht bleiben; Jan Philipp Sprick zieht es für seine Abhandlung zur Theoriegeschichte der Sequenz heran[42]; etc. etc. So wird musikalische Analyse, die im übrigen gar nicht von Riemann ausgeht, sondern aus noch älteren Quellen schöpft – beispielsweise Adolf Bernhard Marx[43] –, zum unendlichen Prozess einer Selbstreflexion von Musik.
3. Domizilierung des Unbehausten oder Die Scheuklappen wilhelminischer Moderne
Hugo Riemanns musiktheoretisches System beruht auf einem monozentrischen Konzept, das er äquidistant aus einem stabilen Mittelpunkt aufwärts – als Oberquint-Raum von Dominantrelationen – und abwärts – als Unterquint-Raum von Subdominantrelationen – auffächerte und mit einer symmetrischen, auftaktigen Matrix der Metrik koppelte. Es ist dies ein grandioses Bild künstlerischer Möglichkeitsräume bzw. musikalischer Potentialitäten, die wie Insekten von einem Zentrum aus in nähere und fernere Regionen ihre Netze, Gewebe und Verknüpfungen spinnen.[44] Kunst erscheint somit als ein Ordnungssystem. Damit wird Riemann einer Seite künstlerischer Aktivität gerecht, er verfehlt jedoch die gegenteilige, denn Ordnung und Unordnung gefährden nach Paul Valéry die Welt gleichermaßen. Sofern in der Moderne der surrealistische Impuls mehr als nur ein vorübergehendes Aufwallen bedeutete, er vielmehr in der Zerstörung von Ordnung seine eigentliche Triebkraft hatte, tritt uns in Riemanns früher Theorie eine andere, gegensätzliche Mentalitätsstruktur vor Augen, welche sehr direkt Impulse der gesellschaftlichen Moderne aufgreift und mit einem herrschaftlichen Ordnungssystem die kaiserliche Gründerzeit spiegelt. Diese Struktur drängt die aus Traumwirren geborene, romantisch-avantgardistische Gegenwelt umgestülpter Ordnungen zurück, schirmt die Gefahr einer aus den Fugen gehobenen, ins Nicht-Mimetische verzerrten Sphäre ab und schiebt damit die ästhetische Moderne als ihr antithetisches Pendant mit zäher Pedanterie beiseite.
An Riemanns Modernität mit ihrer Nähe zu Topographie und Mathematik wird ein Zug zu dem sichtbar, was man aktuell ›Mapping‹[45] nennt: eine Öffnung zur Bildrepräsentation von Strukturen, eine Darstellungsweise, welche die Theorie der Musik in Räume einer non-verbalen, um so stärker aber graphisch-figürlichen Schriftlichkeit setzt. Dies zeigen Diagramme in vielen Schriften Riemanns bis zu den »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹«, deren bildwissenschaftliche Deutung im Sinne Gottfried Boehms, Horst Bredekamps oder John Michael Krois’ sich geradezu aufdrängt.
Durch die Begriffe der Dominanten (Oberdominante und Subdominante), der Parallele und der Variante sind zweifellos für eine ganze Reihe von Tonarten engere Beziehungen festgelegt und Gemeingut, d. h. wir können wohl als feststehend annehmen, daß alle Musiker C dur als quintverwandt mit G dur und F dur vorstellen und daß A moll durch die Gemeinsamkeit aller Töne (Parallelität) ebenfalls C Dur sehr nahe steht […]. Die bekannte Verwandtschaftstabelle:
die in sämtlichen Horizontalreihen beliebig weiterzuführen ist (durch weitere Quintschritte), führt synoptisch eine große Zahl verschiedener Tonbestimmungen durch Quintschritte nach oben (rechts) oder unten (links) oder Terzschritte nach oben (aufwärts) oder unten (abwärts) vor.[46]
Die Welt von Riemanns Theorie vollzieht ihre kartographische Arbeit mit dem Ziel, dasjenige, was in den Räumen des Klingenden sich ankündigen, plötzlich sogar hereinbrechen mag, zu lokalisieren, zu verorten, bzw. zu »domizilieren«. Wer oder was muss »domiziliert« werden? Alle Klänge, die erscheinen, sofern sie, weil der Kunst fähig, überhaupt Anrecht zu solchem Auftreten haben. Was ohne dieses erklingt, was ohne Recht sich an Land begibt, was ohne mögliche Platzierung im System sich zu Gehör meldet – all dies entbehrt solcher Legitimität und wird von Riemann mit kräftigsten Worten in den Orkus geschickt. Dahinter steckt die richtige Erkenntnis, dass das Material der Musik, sofern diese zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt Kunst werden will, sich durch strikte Selektion des Bestandes auszeichnen muss, dass willkürlich Klingendes in keiner Weise zu den Grundlagen eines Tonsystems gerechnet werden darf. Dahinter, so vermute ich, steckt aber auch die erinnerte biographische Situation eines Privatdozenten an einer deutschen Universität, der darauf brannte, eine ordentliche Professur – oder zumindest den Professorentitel – zu erlangen, und der erst 1901 – über fünfzigjährig – zu einem »nicht planmäßigen außerordentlichen Professor« ernannt wurde[47], der also während sehr vieler Jahre in academicis einen persönlichen Domizilierungsdrang verspürte. Demgegenüber hat Baudelaire in einem seiner Gründungswerke der ästhetischen Moderne, dem posthum publizierten Spleen de Paris (1869), Einsamkeit und Masse verschränkend, außer einem »goût du travestissement et du masque« vor allem »la haine du domicile et la passion du voyage« gepriesen (in XII: Les Foules)[48] und somit die Leidenschaft zu reisen mit dem Hass auf einen Wohnsitz verknüpft. Eine Studie zur Moderne muss, will sie nicht hinter deren Idee zurückfallen, sich dieser Dimension versichern, andernfalls bleibt in der Geschichte der Künste Wesentliches unbemerkt, hinter einem technokratischen Vorhang verborgen.
Ein Bild von dem, was »domiziliert« werden soll, vermittelt die Beschreibung der symmetrischen Akkorde – zumal des verminderten Septakkordes und des übermäßigen Dreiklangs – in Schönbergs Harmonielehre, deren metaphorische Sprache sehr direkt auf das Volk der Unbehausten, der Obdachlosen, der Wanderer und Zigeuner abhebt.[49] Die Akkorde, die er »vagierende«, also streunende, herumziehende Akkorde nennt, entbehren des Mittelpunkts, entbehren einer klaren, vom Kompass diktierten Richtungslenkung und erscheinen somit als Vagabunden einer modernen Welt. Riemann hatte solche ›Unbehaustheit‹ sowohl in der vormodernen Welt einer noch unabgeschlossenen Rationalität des Systems als auch in der nachmodernen Welt einer dem Orientierungsgefüge entronnenen Musik wahrgenommen, sie mit einer Nicht-Identisches schnöde ignorierenden Antenne gewittert und als totalitärer Systematiker vehement, ja gnadenlos bekämpft. Ein Ordnungspolizist duldet solche Obdachlosen nicht: Sie werden entweder ›ver-ortet‹ oder aber ›e-liminiert‹, d.h. in ein Gebiet jenseits der Grenzen des Systems verbannt, wo sie weiterhin existieren mögen, wo sie aber, weil sie nicht mehr Teil des Systems sind, keinen Schaden anrichten, keinen Einfluss auf die Kunst ausüben können.[50]
4. Jenseits des Systems: Riemann heute
Die Konjunktion ›und‹ im Titel dieses Textes (»Von unten und von oben?«) schiene verfehlt, zeigte das Fragezeichen kein rhetorisches, sondern ein ernstgemeintes Fragen an. Sobald zwei gegensätzliche methodologische Verfahren wie ›von unten nach oben‹ bzw. ›von oben nach unten‹ in den Blick kommen, kann die logisch sinnvolle Konjunktion nur ›oder‹ lauten. Tatsächlich aber hat Hugo Riemann beide Postulate zu verschiedenen Zeiten seines Wirkens selbst formuliert. Hat er sich also, wenn der eine Weg richtig und der andere falsch ist, bei einer der Positionen ›geirrt‹, oder hat er, wenn beide Wege möglich sind, eine tiefgreifende Entwicklung vollzogen, die aus einer methodologischen Position »von unten« zur gegenteiligen »von oben« führte? Zwei Zitate aus unterschiedlichen Phasen lauten nebeneinandergestellt:
Wenn wir konsequent den eingeschlagenen Weg von Unten verfolgen, so werden sich uns alle diese Prinzipien von selbst ergeben, welche eine apriorische Deduktion schwerlich zu entwickeln vermöchte.[51]
Rückblickend halte ich es nicht für einen Fehler, daß ich dabei nicht den Weg ›von unten nach oben‹, die ›induktive Methode‹ gewählt habe, sondern vielmehr den Weg von oben nach unten, die ›deduktive Methode‹, d. h. daß ich mich bewußt auf den Standpunkt der im Vollbesitz ihrer Mittel befindlichen Kunstübung der Gegenwart gestellt und von ihr aus die letzten Elemente zu finden und zu begreifen gesucht habe.[52]
Riemann hat den Vektor seiner Systembildung hier als eine Bewegung »von oben nach unten« gekennzeichnet, in Antithese zu Gustav Theodor Fechners Ästhetik »von unten«, die im ersten Zitat von 1878 anklingt. Es scheint, als würde er sein Prisma allen Phänomenen der Musik und ihrer Theorie überstülpen, um so ein einheitliches Bild, eine geordnete Welt der Kunst herzustellen und dem Leser die Existenz einer systemkonformen Sphäre zu suggerieren. Eine Ästhetik, die wirklich »von unten« her erst allmählich zu Resultaten gelangte, erst tentativ zu Zielen vorstieße, hätte wenig Aussicht, eine solche Einheitlichkeit zu erreichen. Und umgekehrt stieße eine Systembildung »von oben« her auf große Schwierigkeiten, die historisch, geographisch, kulturell so außerordentlich vielfältigen Phänomene der gesamten musikalischen Wirklichkeit, wie sie bereits damals und noch sehr viel mehr heute in Erscheinung treten, treffend zu erfassen.[53] In beiden entgegengesetzten Fällen – dem Weg des frühen ebenso wie jenem des späten Hugo Riemann – verharrt die Ästhetik in der multi- oder jedenfalls pluripolaren Welt der Kunst.
Die Doppelung hängt mit Moderne-Kategorien zusammen, die zu Riemanns Zeiten eine völlig andere Bedeutung besaßen als heute – nach der Postmoderne –, da Pensiero debole, dichte Beschreibung und Ähnliches einschlägige Stichworte bilden. Die postmoderne Moderne weiß, dass Gegensätze, wie im angezeigten Casus, sehr wohl zusammenfallen können. Riemanns Gabelstruktur mit einander ausschließenden Alternativen jedoch bricht in sich zusammen, da die Kluft zwischen den Enden – universelle Abstraktion einerseits, vereinzelte Konkretion andererseits – anders als durch Fiktionen, Reparaturen, Konstruktionen, Manipulationen nicht geschlossen werden kann, ob ›von unten‹ oder ›oben‹ ausgehend, ob ›nach oben‹ oder ›unten‹ strebend.
Das musiktheoretische Denken Hugo Riemanns entstand nicht zufällig dann, als Deutschland – und zwar nicht mehr das »Heilige Römische Reich deutscher Nation«, sondern das von Bismarck unter Preußens Führung gegründete ›kleindeutsche‹ Kaiserreich – imperiale Anstrengungen unternahm, indem es versuchte, einer späten, ungünstigen Ausgangslage zum Trotz ein ›Imperium‹ zu bilden.[54] Auch Riemanns Theorie bildet ein solches ›Imperium‹, denn alle Elemente, die in diesem Reich der Ordnung sich befinden, sind ›angemeldet‹, es gibt keine ›ohne festen Wohnsitz‹, alles und jedes ist, wie wir sahen, ›domiziliert‹. Und die Grenzen werden mit einer Vehemenz verteidigt, die der imperialistischen Fremdabwehr nicht nachsteht. Fast in jeder wichtigen Schrift wettert Riemann gegen die Intrusionen, gegen die »Kunstfeindlichkeit« einer missverstandenen Kontrapunktlehre[55], polemisiert gegen »Das Neue an dem Neuesten« und beklagt beim Modernen »destruktive« Tendenzen, eine »Verwirrung der Begriffe«.[56]
Hier zeigt sich ein problematischer Zug an Riemanns Reflexion der Musik: Sie ist nicht fähig, zum Anderen ernsthaft vorzustoßen, sie erkennt nur das Selbe im Anderen, lässt es nicht als etwas Fremdes gelten und bezahlt diese Strategie mit dem Preis des Scheiterns. Aber selbst im Scheitern ist die Reflexion noch aussagekräftig: Riemanns Korrektur, eine pedantische Um-Notation, die theoretisches Recht über praktischen Sinn stellt, macht Regers Lied Drängen op. 97 Nr. 3 bekannter, als es sonst wäre.[57] Bestätigt sie damit die These, vom obersten Rang des Kunstschaffens, der Komposition, zum untersten bloßer Vermittlung, der Kunstpädagogik, führe eine Spirale abnehmenden Wertes unaufhaltsam abwärts – nach dem Muster: Komposition → Interpretation → Theorie → Wissenschaft → Lehre? Oder bietet sie im Gegenteil ihre Revision an? Denn immerhin dürfte gelten: Wer kennt Tinctoris’, wer Fux’, wer Matthesons, wer Riemanns, wer Adornos Kompositionen? Wer jedoch nicht – und sei es nur zum Teil – ihre Schriften?
Riemanns Theorie, auch was ihre selbstreflexiven Züge betrifft, ist in ihrer ursprünglichen Gestalt ›veraltet‹, rezeptionsgeschichtlich aber lebt sie auf der pädagogisch-pragmatischen Ebene der Funktionsbezeichnungen weiter[58], und in der Forschung verschaffen ihr die mathematischen Weltentwürfe der Klang-Topologen neuen Auftrieb, wobei die Neo-Riemannians paradoxerweise genau zu jener Musik vordringen, die ihr Namenspatron als »unbehauste Gesellen« in die Verbannung geschickt hatte: die chromatische Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Für Selbstreflexion im Sinne einer postmodernen Moderne taugt ein universaler Zugriff à la Riemann nicht mehr, das einheitlich-moderne Raster einer ›Verortung‹ ist obsolet, der Glorienschein dieser Modernität verblasst; weder Musiker noch Theoretiker sollten das frühere System weiter pflegen. Statt gewaltsamer Gesamttheorien, die an der unendlichen Vielfalt der musikalischen Welten zerbrechen, ist vielmehr eine Fülle mannigfacher Felder liebevoll-kritisch zu hegen, in je besonderen Perspektiven, die ihre konkreten, meist historisch limitierten Horizonte systematisch abzustecken vermögen, und mit einer Reflexionsbreite, die, gerade weil sie um die eigene Begrenzung weiß, kräftig und valide erscheint.
Anmerkungen
Artikel »Theorie (griech.), ›Betrachtung‹« (Riemann 1900, 1131), bzw. »Wissenschaft der Musik« (Riemann 1900, 1255). »Theorie« ist aus griechisch-lateinisch theoria »das Zuschauen; die Betrachtung, die Untersuchung; die wissenschaftliche Erkenntnis« entlehnt, »Wissenschaft« bzw. »wissen« (eigentlich: »gesehen haben«) aus indogermanisch *ueid- »erblicken, sehen, erkennen« (griechisch: idein, lateinisch: videre). So Duden. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache (Duden Bd. 7), Mannheim u.a.: Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 1963, 708 und 768f. | |
Aufgrund der Tradition der artes, die auch Handwerk oder Technik bezeichneten, lag der Praxisbezug noch im 18. Jahrhundert eher auf Seiten der »Wissenschaft« als der »Theorie«, wie Joseph Haydns Lob gegenüber Leopold Mozart zeigt, dessen Sohn Wolfgang habe »Geschmack und überdies die größte Compositionswissenschaft« (Brief vom 14./16. Februar 1785. Vgl. Deutsch/Paumgartner 1936, 67f. und Schäfer (Hg.) 1999). | |
Christensen (Hg.) 2002; Zaminer/Ertelt (Hg.) 1984ff. | |
Gurlitt 1950, 1880. | |
Einstein 1919. | |
Welsch 1987, Welsch (Hg.) 1988. | |
Vgl. hierzu Danuser 2010. | |
Rehding 2003, insbesondere Kapitel 4 »Musical syntax, nationhood and universality«, 113–161. | |
Vgl. Rathert 2005, Sp. 64f.; Arntz 1999. | |
Nowak 1999, 177ff.; Nowak 2001; Rehding 2003, 113. | |
Ritter (Hg.) 1971ff.; Brunner/Conze/Koselleck (Hg.) 1972ff. | |
Koselleck 2006, Gumbrecht 2006, Konersmann (Hg.) 2007. Vgl. die Rezension des von Konersmann herausgegebenen Wörterbuches durch Uwe Justus Wenzel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. September 2007. In Italien gibt es seit geraumer Zeit ein Forschungsprojekt Storia dei concetti musicali, in dessen Rahmen bisher – hg. von Gianmario Borio e Carlo Gentili – drei Bände (Roma: Carocci, 2007ff.) erschienen sind. | |
Vgl. Danuser 1998. | |
Außer den bereits erwähnten Titeln von Alexander Rehding, Wolfgang Rathert und Adolf Nowak (siehe Anmerkungen 8, 9, 10) hebe ich vor allem Peter Rummenhöller und Carl Dahlhaus hervor: Vgl. Rummenhöller 1967, 95–108 und Dahlhaus 1974. | |
Riemann 1913, IV–VIII, hier VI. | |
Riemanns ambivalentes Verhältnis zur Moderne, dass er im Zusammenhang der Philosophie seiner Zeit ein Teil von ihr ist und andererseits ihre radikalen künstlerischen Tendenzen, das Streben nach einem »Neuen des Neuesten«, verabscheut und bekämpft, hat Alexander Rehding sehr gut herausgestellt (Rehding 2003, 39–46), wo es heißt: »It must be remembered that modernity invokes the category of the ›new‹ not so much for its own sake, but rather as a function of its reflexivity. Situated thus, music theory can be seen as one of the institutions on which the modernity of music rests.« (43) | |
Riemann 1921, 470–529, hier 485, Kursivierung original. | |
Riemann 1921, 485, Kursivierung nicht original. | |
Riemann 1914/15, 1–26, hier 21. | |
In einem öffentlichen, vom Rundfunk mitgeschnittenen Gespräch mit Roland Wächter beim Lucerne Festival 2006 über ein am selben Tag (am 19. September) zur Aufführung vorgesehenes Vokalwerk von Luciano Berio – Calmo für Sopran und 12 Instrumente –, dessen Solopart Luisa Castellani gestaltete, bekannte Pierre Boulez verschmitzt lächelnd, er habe, um es erfolgreich zu realisieren, daran etwas »manipulieren« müssen. Damit meinte er ganz erhebliche Eingriffe in seine musikalische Struktur und Form – erstaunlich für einen Interpreten, der lange ein authentisches, nicht auf rhetorische Wirkung schielendes Reproduktionsideal repräsentierte. In der französischen Sprache ist also noch heute, wie damals bei Hugo Riemann, der Begriff ›Manipulation‹ ohne negativen Beigeschmack verwendbar. | |
Riemann 1914/15, 1; am Ende des zitierten Satzes verweist Riemann in Klammern auf den Titel seiner Dissertation: Musikalische Logik (1873). | |
Kant 1924, § 53 (»Vergleichung des ästhetischen Werts der schönen Künste untereinander«), 183–188, hier 185. | |
Mahrenholz 1998, 186–323. | |
Hermann Kretzschmar, »Anregungen zur Förderung musikalischer Hermeneutik« (1911); zit. nach Heidenreich 2001, 155. | |
Riemann 1914/15, 15. | |
Vgl. dazu Schubert (Hg.) 1997. | |
Hanslick 1854, 120–140, hier 131. | |
Vgl. Nowak 1980. | |
Vgl. Dällenbach 1977. Zum philosophischen Horizont der Selbstreflexion bei Riemann vgl. Nowak 2001. | |
Adorno 1962, 16f. – Zu Dahlhaus vgl. die Carl Dahlhaus gewidmete Ausgabe von Musik & Ästhetik: Carl Dahlhaus. Gegenwart und Historizität (12. Jg., Heft 47, Juli 2008), sowie Carl Dahlhaus und die Musikwissenschaft: Werk, Wirkung, Aktualität, hg. von Hermann Danuser, Peter Gülke und Norbert Miller, Redaktion: Tobias Plebuch, Schliengen: Argus, 2011. | |
Riemann 1921, 529. | |
Dahlhaus 1967, 10. | |
Riemann 1921, 529, Kursivierung original. | |
Rehding 2003, 34f. Vgl. zu diesem Thema auch den Text von Albrecht Schneider in dieser Ausgabe. | |
Rummenhöller 2001, 31. | |
Rehding 2003, 70, bezogen auf Riemann 1873, 52. Wie Rehding schreibt, ist das Fichtesche Modell ein Zusatz in der Buch-Fassung des Textes, der bei der früheren Aufsatzfassung »Musikalische Logik« [pseudonym: Hugibert Ries, NZfM, XL, 1872, abgedruckt in: Riemann 1901, 1–22) noch fehlt und dort durch einen Verweis auf Hauptmann ersetzt ist. Vgl. hierzu Seidel 1966, 48. | |
Hauptmann 1853, 1–14. | |
Herbert Schnädelbachs Darstellung der nachhegelschen Philosophie in Deutschland lässt vermuten, dass Riemann damit Hermann Lotze folgte, der statt auf Hegel auf Fichte zurückgriff. Siehe das Kapitel »Die werttheoretische Umdeutung des Idealismus (Hermann Lotze)« in Schnädelbach 1983, 206–218. | |
Riemann 1921, 471, Kursivierung original. | |
Riemann 1877, 120. | |
Vgl. Danuser 1988, Bergé (Hg.) 2009. | |
Sprick 2010, 90ff. | |
Vgl. auch Burnham 32000, 69–81. | |
Vgl. Hubig 2006; 2007. Solche Ansätze sind in jüngerer Zeit insbesondere von mathematisch-topologisch orientierten Musiktheoretikern der USA aufgegriffen und weiterentwickelt worden. Vgl. etwa Cohn 1997. | |
Vgl. die zahlreichen Exempla in Christensen (Hg.) 2002. Vgl. dazu auch die Rezension des Verfassers (Danuser 2005). | |
Riemann 1914/15, 19f. | |
Vgl. für detaillierte Betrachtungen zu Riemanns Biographie Arntz 1999. | |
Baudelaire 1995, 34f., Kursivierung nicht original. | |
Vgl. Schönberg 1911, insbesondere das Kapitel »An den Grenzen der Tonart«, 287–322, vor allem 310ff. | |
Vgl. in diesem Zusammenhang Riemanns Behandlung der ›vagierenden‹ Akkorde im Handbuch der Harmonielehre (1917, 166–172). Riemann bemerkt, dass der »verminderte Septimenaccord […] von einer grossen harmonischen Unbestimmtheit« ist (166f.), sieht aber gerade darin einen ästhetischen Mangel: »[…] so ist er doch kein künstlerisch hoch anzuschlagendes [Mittel], zumal die enharmonische Verwechslung [die die Ursache der Unbestimmtheit ist, H.D.] eine Täuschung der Auffassung ist, die nur bei seltener Anwendung von guter Wirkung sein kann.« Zum übermäßigen Dreiklang bemerkt Riemann, »dass die musikalische Logik zweiklängige Accorde«, d.h. Akkorde, die zwischen zwei Haupttönen vagieren, »nicht kennt« (169). | |
Riemann 1878, 50. Etwas zuvor heißt es im Text: »Es fehlt zwar nicht an solchen, die noch im alten Schlendrian fortgehen und sich in der nebeligen Begriffswelt Hegel’scher Dialektik wohl fühlen, ja glücklicher, höher, größer als die am Boden kriechenden Empiriker: im Ganzen ist aber die Thatsache nicht wegzuleugnen, dass der Schematismus in der Kunstbetrachtung immer mehr an Boden verliert und wie auf allen Gebieten menschlicher Geistesthätigkeit auch auf dem der Ästhetik die naturwissenschaftliche Methode durchdringt und dieselbe zu einer exakten Wissenschaft zu machen sucht, soweit das möglich ist.« (47). Vgl. hierzu Grimm 2001. | |
Riemann 1914/15, 1. | |
Vgl. Riemann 1917. | |
Zur politischen Allegorese bei Felix Draesekes Schrift Die Konfusion in der Musik (Stichwort »Sozialdemokraten«) sowie zu Riemanns Lob der Wagnerschen Meistersinger vgl. Rehding 2003, 64, bzw. 137. | |
Riemann 1902, 3. | |
Riemann 1913, VII. Der Autor schreibt im »Vorwort«: »Vielleicht werden manche in meiner Darstellung eine reichlichere Heranziehung von Beispielen aus der allerjüngsten Literatur vermissen; ihnen kann ich nur entgegenhalten, daß das Neue an dem Neuesten so gut wie gänzlich negierender und destruktiver Natur ist und sich in absichtlichen Gegensatz zu dem durch hartes Ringen von Jahrhunderten erreichten Normativen setzt, daß es eben darum sich einer systematischen Darstellung entzieht und nicht Gegenstand einer schulmäßigen Lehre sein kann. Die Verwirrung der Begriffe, welche die antiformalen Tendenzen der Neutöner à tout prix in der jugendlichen Phantasie anzurichten geeignet sind, durch eingehendere Berücksichtigung in Lehrbüchern noch zu verstärken, ist ein Verbrechen.« | |
Vgl. u.a. Rathert 2005, Sp. 71 und Rehding 2003, 12f. | |
Vgl. hierzu Holtmeier 1997 und Holtmeier 2005. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1962), Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Arntz, Michael (1999), Hugo Riemann (1849–1919): Leben, Werk und Wirkung, Köln: Concerto-Verlag.
Baudelaire, Charles (1995), Le Spleen de Paris, Les Paradis artificiels, Paris: Bookking International.
Bergé, Peter (Hg.) (2009), Beethoven’s Tempest Sonata: Perspectives of Analysis and Performance (Analysis in Context. Leuven Studies in Musicology), Leuven: Peeters.
Böhme-Mehner, Tatjana / Klaus Mehner (Hg.) (2001), Hugo Riemann (1849–1919): Musikwissenschaftler mit Universalanspruch, Köln: Böhlau.
Brunner, Otto, Werner Conze / Reinhart Koselleck (Hg.) (1972ff.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart: Klett-Cotta.
Burnham, Scott (32000), Beethoven Hero, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Christensen, Thomas (Hg.) (2002), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Cohn, Richard (1997), »Neo-Riemannian Operations, Parsimonious Trichords, and their Tonnetz Representations«, Journal of Music Theory 41/1, 1–66.
Dahlhaus, Carl (1967), Musikästhetik, Köln: Hans Gerig.
Dahlhaus, Carl (1974), »Zur Kritik des Riemannschen Systems«, in: Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 2, hg. von Hermann Danuser u.a., Laaber: Laaber 2001, 246–269.
Dällenbach, Lucien (1977), Le récit spéculaire. Essai sur la Mise en abyme, Paris: Seuil.
Danuser, Hermann (1988), »Beethoven als Klassiker der Klaviersonate«, in: Gattungen der Musik und ihre Klassiker im Wandel der Geschichte, hg. von dems., (= Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover 1), Laaber 1988, 197–220.
Danuser, Hermann (1998), »Der Text und die Texte. Über Singularisierung und Pluralisierung einer Kategorie«, in: Musik als Text. Bericht über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung Freiburg im Breisgau 1993, hg. von Hermann Danuser und Tobias Plebuch, Bd. 1: Hauptreferate, Symposien, Kolloquien, Kassel u.a.: Bärenreiter, 38–44.
Danuser, Hermann (2005), Rezension von History of Western Music Theory (hg. von Thomas Christensen), Music Analysis 24/1–2, 265–282.
Danuser, Hermann (2010), »Die Kunst der Kontextualisierung. Über Spezifik in der Musikwissenschaft«, in: Musikalische Analyse und kulturgeschichtliche Kontextualisierung. Für Reinhold Brinkmann, hg. von Tobias Bleek und Camilla Bork, Stuttgart: Steiner, 41–63.
Deutsch, Otto Erich / Bernhard Paumgartner (Hg.) (1936), Leopold Mozarts Briefe an seine Tochter [Maria Anna (Nannerl)], Salzburg und Leipzig: Pustet.
Einstein, Alfred (1919), »Hugo Riemann zum 70. Geburtstag«, Zeitschrift für Musikwissenschaft 1, S. 569f.
Grimm, Hartmut (2001), »›Ästhetik von unten‹ – Hugo Riemanns Konzept der Musikästhetik«, in: Böhme-Mehner/Mehner (Hg.) 2001, 117–130.
Gumbrecht, Hans Ulrich (2006), Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte, München/Paderborn: Fink.
Gurlitt, Wilibald (1950), Hugo Riemann (1849–1919), Mainz: Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1950 (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1950, Nr. 25). Zit. nach Ellen Jünger u.a., Musik + Wissenschaft = Hugo Riemann, Ausstellungskatalog der Bibliotheca Albertina 13. November 2008 – 14. Februar 2009 (= Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig 14), 2008, 37.
Hanslick, Eduard (1854), Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst (16. Aufl. 1966), Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Hauptmann, Moritz (1853), Die Natur der Harmonik und Metrik. Zur Theorie der Musik (2. Aufl. 1873), Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Heidenreich, Achim (2001), »›Die Ungeheuerlichkeit dieser Art von Hermeneutik…‹. Ein Disput zwischen Hugo Riemann und Hermann Kretzschmar“, in: Böhme-Mehner/Mehner (Hg.) 2001, 153–157.
Holtmeier, Ludwig (1997), »Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft? Zur Lage der Musiktheorie«, Musik & Ästhetik 1, 119–136.
Holtmeier, Ludwig (2005), »Grundzüge der Riemann-Rezeption«, in: Musiktheorie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 2) hg. von Helga de la Motte-Haber und Oliver Schwab-Felisch, Laaber: Laaber, 230–262.
Hubig, Christoph (2006/2007), Die Kunst des Möglichen. Grundlinien einer dialektischen Philosophie der Technik. Bd. 1: Technikphilosophie als Reflexion der Medialität (2006), Bd. 2: Ethik der Technik als provisorische Moral (2007), Bielefeld: transcript.
Kant, Immanuel (1924), Kritik der Urteilskraft, hg. von Karl Vorländer, Hamburg: Felix Meiner.
Konersmann, Ralf (Hg.) (2007), Wörterbuch der philosophischen Metaphern, Darmstadt:: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Koselleck, Reinhart (2006), Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Mahrenholz, Simone (1998), Musik und Erkenntnis. Eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symboltheorie, Stuttgart und Weimar: J.B. Metzler.
Nowak, Adolf (1980), «Anschauung als musikalische Kategorie«, in: Anschauung als ästhetische Kategorie, hg. von Rüdiger Bubner u.a. (neue hefte für philosophie 18/19), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 103–117.
Nowak, Adolf (1999), »Musikalische Logik – philosophische Logik«, in: Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis von Musik und Philosophie, hg. von Christoph Asmuth, Gunther Scholtz, Franz-Bernhard Stammkötter, Frankfurt/New York: Campus, 175–192.
Nowak, Adolf (2001), »Wandlungen des Begriffs ›musikalische Logik‹ bei Hugo Riemann«, in: Böhme-Mehner/Mehner (Hg.) 2001, 37–48.
Rathert, Wolfgang (2005), Artikel »Riemann, Hugo«, in: MGG, Personenteil, Bd. 14, hg. von Ludwig Finscher, Kassel u.a.: Bärenreiter, Sp. 64–78.
Rehding, Alexander (2003), Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought, Cambridge: Cambridge University Press.
Riemann, Hugo (1873), Musikalische Logik, Leipzig: C.F. Kahnt.
Riemann, Hugo (1877), Musikalische Syntaxis, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1877, Reprint Niederwalluf: Dr. Martin Sändig, 1971.
Riemann, Hugo (1878), »Der gegenwärtige Stand der musikalischen Ästhetik«, in: Präludien und Studien. Gesammelte Aufsätze zur Ästhetik, Theorie und Geschichte der Musik, Bd. 2, Leipzig: Seemann, 1900, 46–55.
Riemann, Hugo (51900), Musik-Lexikon (5. Auflage), Leipzig: Max Hesse.
Riemann, Hugo (1901), Präludien und Studien, Gesammelte Aufsätze zur Ästhetik, Theorie und Geschichte der Musik, Bd. 3, Leipzig: Seemann.
Riemann, Hugo (1902), Große Kompositionslehre, Bd. 1: Melodie- und Harmonielehre, Berlin: Spemann.
Riemann, Hugo (1913), Große Kompositionslehre, Bd. 3: Der Orchestersatz und der dramatische Gesangstil, Stuttgart: Spemann.
Riemann, Hugo (1914/15), »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹«, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1914/15, hg. von Rudolf Schwartz, 21. und 22. Jg., Leipzig 1916.
Riemann, Hugo (1917a), Handbuch der Harmonielehre, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Riemann, Hugo (1917), »Neue Beiträge zu einer Lehre von den Tonvorstellungen«, Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1916, hg. von Rudolf Schwartz, 23. Jg., Leipzig: C. F. Peters, 1–21.
Riemann, Hugo (1921), Geschichte der Musiktheorie im 9.–19. Jahrhundert, 2. Auflage, Berlin: Hesse, Reprint: Hildesheim u.a.: Olms 1990.
Ritter, Joachim u.a. (Hg.) (1971ff.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel u.a.: Schwabe.
Rummenhöller, Peter (1967), Musiktheoretisches Denken im 19. Jahrhundert. Versuch einer Interpretation erkenntnistheoretischer Zeugnisse in der Musiktheorie (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 12), Regensburg: Gustav Bosse.
Rummenhöller, Peter (2001), »Der fluktuierende Theoriebegriff Hugo Riemanns. Musiktheorie zwischen Idealismus und Naturwissenschaft«, in: Böhme-Mehner/Mehner (Hg.) 2001, 31–36.
Schäfer, Ursula (Hg.), (1999) Artes im Mittelalter, Berlin: Akademie Verlag.
Schnädelbach, Herbert (1983), Philosophie in Deutschland. 1831–1933, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Schönberg, Arnold (1911), Harmonielehre, Wien: Universal Edition 71966.
Schubert, Giselher (Hg.) (1997), Biographische Konstellation und künstlerisches Handeln (= Frankfurter Studien. Veröffentlichungen des Paul-Hindemith-Institutes Frankfurt a.M. VI), Mainz u.a.: Schott.
Seidel, Elmar (1966), »Die Harmonielehre Hugo Riemanns«, in: Studien zur Musiktheorie des neunzehnten Jahrhunderts, hg. von Martin Vogel, Regensburg: Gustav Bosse, 39–92.
Sprick, Jan Philipp (2010), Die Sequenz in der deutschen Musiktheorie um 1900, unveröffentl. Diss. Humboldt-Universität zu Berlin.
Welsch, Wolfgang (1987), Unsere postmoderne Moderne, Weinheim: VCH, Acta Humanoria.
Welsch, Wolfgang (Hg.) (1988), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim: VCH, Acta Humanoria.
Zaminer, Frieder / Thomas Ertelt (Hg.) (1984ff.), Geschichte der Musiktheorie, Bde. 1–11, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.