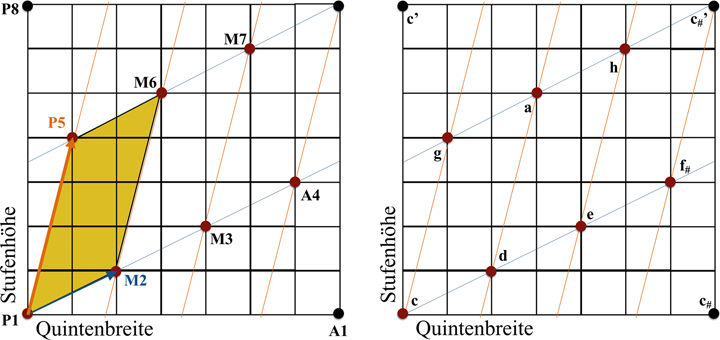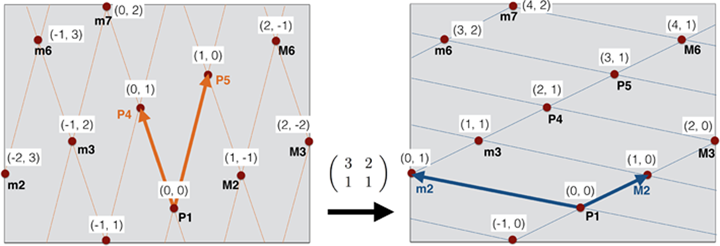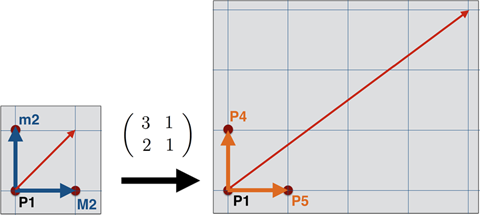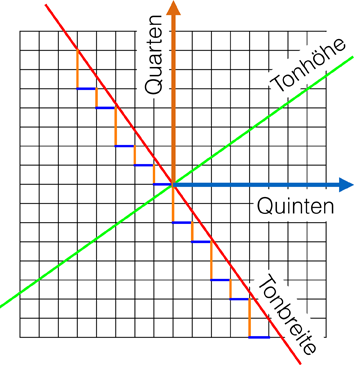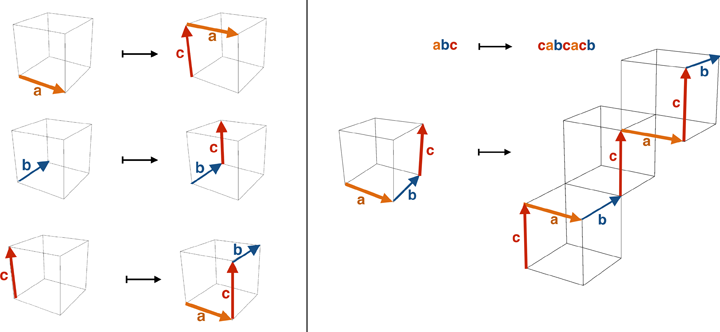Handschins ›Toncharakter‹
Plädoyer für einen neuen Anlauf, ausgehend von neueren musiktheoretischen und kognitionspsychologischen Untersuchungen zu den tonalen ›Qualia‹[1]
Thomas Noll
Mit dem Begriff des ›Toncharakters‹ verbindet Jacques Handschin (1948) die musikalische Qualität des Tons, die mit dessen Position im quint-generierten Tonsystem korrespondiert. In den heutigen Ansätzen der kognitiven Psychologie (David Huron 2006) und der Musiktheorie (Steven Rings 2011), die sich der Aufgabe widmen, den subjektiven Erlebnisgehalt der Wahrnehmung musikalischer Töne – die ›Skalenstufen-Qualia‹ oder ›tonalen Qualia‹ – empirisch bzw. phänomenologisch zu erfassen – spielen Handschins Ideen bislang keine Rolle. Die erste Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ist es daher, die in allen drei Ansätzen entwickelten Auffassungen nachzuzeichnen und zueinander ins Verhältnis zu setzen (Abschnitte 1 und 2). Die von Rings bereits etablierte Verkoppelung des Forschungsthemas mit der transformational theory wird sodann vertieft, um Handschins inhaltliche Vorschläge zu aktualisieren und weiter auszudifferenzieren (Abschnitt 3). Dabei wird im Intervallraum orthogonal zur Tonhöhenrichtung ein als ›Tonbreite‹ bezeichneter Unterraum gewählt, auf den sich verschiedene Konstruktionen zum Toncharakter beziehen lassen. Zu den Ergebnissen der Untersuchung zählt die Beobachtung, dass die Charaktere eines Tons, die er in den verschiedenen Manifestationen eines Modus innehaben kann, selbst eine Struktur in der Gestalt eines Modus bilden.
Jacques Handschin (1948) explains the musical quality of a tone with the concept of ›tone character‹. It corresponds to the position of this tone within the fifth-generated tone system. Handschin’s ideas are not reflected within the contemporary approaches of cognitive psychology (David Huron 2006) and music theory (Steven Rings 2011), which are dedicated to the task to empirically or phenomenologically understand the subjective content of the mental experience of musical tones – their ›scale degree qualia‹ or ›tonal qualia‹. The first goal of the present article is therefore to recapitulate the perspectives inherent to these three approaches and to position their relationships with respect to each other (sections 1 and 2). In order to actualize and refine Handschin’s proposals regarding the tone character, the connection to transformational theory, which Rings already established for his own approach, is developed further, choosing a subspace within the interval space. This subspace is oriented orthogonally to the direction of pitch height and is called ›pitch width‹. Several constructions around the tone character are related to this subspace. It turns out, among other things, that the various characters a tone occupies in the different manifestations of a mode in turn are forming the structure of a meta-level mode.
Gleich zwei Jubiläen haben unlängst Musikwissenschaftler*innen in St. Petersburg mit dem Ziel zusammengeführt, das Wirken des Musikgelehrten Jacques Handschin anhand neu erschlossener Quellen und vor dem Hintergrund heutiger Forschungsinteressen zu würdigen: sein 60. Todestag am 25. November 2015 und sein 130. Geburtstag am 5. April 2016. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beitrag soll noch an ein drittes Jubiläum erinnert werden: Vor 80 Jahren, im April 1936, hielt Handschin auf dem 3. Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress in Barcelona einen Vortrag mit dem Titel La notion de ›qualité‹ dans la psychologie du son. Franz Michael Maier sieht in diesem Text eine Keimzelle für das zwölf Jahre später erschienene Buch Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie.[2] In Ergänzung zu Maiers Untersuchungen zu den Bedingungen der Entstehung von Handschins Buch werden im vorliegenden Beitrag Möglichkeiten für dessen Interpretation und Fruchtbarmachung im Rahmen aktueller Forschung erschlossen. Konkret geht es um ein Wiederaufgreifen von Handschins Konzept des ›Toncharakters‹ im Kontext der aktuellen Diskussion zu den ›Skalenstufen-Qualia‹. Zu nennen wären die Kognitionsforscher David Huron (2006) und Clair Arthur (2016) sowie die Musiktheoretiker Steven Rings (2011), Eytan Agmon (2013) und Benjamin Hansberry (2013). Hinsichtlich der Interpretation von Handschins Ideen im Rahmen der transformational theory knüpft der Beitrag an David Clampitt und Thomas Noll (2011) sowie Noll (2016) an.
Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich also mit der Frage nach dem Erlebnisgehalt der Wahrnehmung musikalischer Töne und widmet sich dabei der Integration von mehreren Ansätzen zur Erforschung dieses weitgehend noch unerschlossenen Gegenstandsbereichs, für den sich in jüngerer Zeit sowohl Musikpsycholog*innen als auch Musiktheoretiker*innen interessieren. Ein besonderes Anliegen ist dabei die Aufarbeitung und Weiterverfolgung des bereits von Handschin (1948) unternommenen Anlaufs, ein solches Forschungsgebiet abzustecken und in der musiktheoretischen Tradition zu verankern. Dabei unterscheiden sich die musikwissenschaftlichen Erkenntniserwartungen, die der Musikhistoriker Handschin damals mit dem Terminus des ›Toncharakters‹ verband, sowohl in ihrer Ambitioniertheit als auch in inhaltlicher Hinsicht von denen, die heute der Musikkognitionsforscher David Huron (2006) oder der Musiktheoretiker Steven Rings (2011) mit den Termini der ›Skalenstufen-Qualia‹ bzw. der ›tonalen Qualia‹ verbinden. Auch diese beiden neueren Ansätze könnten unterschiedlicher kaum sein. Hurons empirisch ausgerichtete Untersuchungen deuten die unterschiedlichen Erlebnisqualitäten von Skalenstufen als Konsequenzen statistischen Lernens. Rings’ phänomenologisch motivierter Ansatz zielt auf die Etablierung einer passenden Theoriesprache zur deskriptiven Vermittlung musikalischer Erfahrung in der Analyse tonaler Musik ab.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, von der musiktheoretischen Seite aus systematisch auf eine transdisziplinäre Erforschung dieses Gegenstandsbereichs hinzuarbeiten und die in den Abschnitten 1.1 (Handschin), 2.2 (Huron) und 2.3 (Rings) porträtierten Ansätze zueinander und in Bezug auf den Gegenstand zu positionieren. In diese Systematisierung einbezogen werden auch Einwände, die von Carl Dahlhaus (1968) gegen Handschins Ansatz vorgebracht worden sind (Abschnitt 1.2).
Zwei Beobachtungen deuten auf ein entsprechendes Synergiepotential hinter den genannten Ansätzen. (1) Handschin und Huron erheben beide den Anspruch, einen geeigneten Erklärungsansatz für das Zustandekommen von Skalenstufen-Qualia bzw. Toncharakteren zu präsentieren. Die dabei jeweils zum Einsatz gebrachten musiktheoretischen Beschreibungsebenen erweisen sich als einander ergänzende Seiten einer Dichotomie: Während Hurons kognitiver Erklärungsansatz einer ›syntagmatischen‹ Perspektive folgt, welche sich auf die typischen Abfolgen von Tonereignissen in Melodien stützt, nimmt Handschin eine ›paradigmatische‹ Perspektive ein, welche sich auf Tonbeziehungen stützt, die in der Musiktheorie als konstitutive Eigenschaften des Tonsystems erachtet werden. Auch Rings verfolgt einen paradigmatischen Zugang zu den tonalen Qualia, ohne daran einen Erklärungsanspruch zu binden. (2) Handschin und Rings heften die Toncharaktere bzw. tonalen Qualia an bestimmte Parameter des Tonsystems. Dabei wählen sie zwei einander ergänzende Dimensionen von Tonbedeutungen, nämlich Handschin die durch die Tonsilbenfolge fa-do-so-re-la-mi-ti ausdrückbare abstrakte Quintenkette und Rings die durch die Ziffernfolge 1-2-3-4-5-6-7 ausdrückbaren generischen diatonischen Skalenstufen.
Die Agenda für den dritten Teil der vorliegenden Arbeit besteht in einer sukzessiven Ausdifferenzierung der zweiten dieser beiden Beobachtungen. Geeignete Methoden dazu hält die bereits von Rings an die Untersuchungen herangetragene transformational theory bereit. Im Stile eines Gradus ad Parnassum werden die von Eric Regener (1973) betrachteten Transformationen des Systems der Notenintervalle auf verfeinerte Beschreibungsebenen des Tonsystems angehoben, und zwar einerseits auf die Quint- und Quartgattungen der pseudoklassischen Modi, sowie andererseits auf die Gattungen der Dreiklangsintervalle (große Terz, kleine Terz, Quarte) der Dur- und Molltonarten der harmonischen Tonalität. Mit diesen Beschreibungsebenen werden zwei Aspekte des Toncharakters erschlossen, die Handschin nur unvollständig behandelt hat – und welche Dahlhaus entsprechend kritisch kommentierte.
1. Das vernachlässigte Erbe eines Querdenkers
Über den äußerlichen Anlass der Jubiläen hinaus soll zunächst eine Grundmotivation für die in diesem Artikel ergriffene Initiative gegeben werden, und zwar anhand einer Synopsis der für Handschins Toncharakter zentralen Ideen und einer Erinnerung an deren bisherige Rezeption.
1.1 Musikalische Töne leben naturgemäß in Gesellschaft. Eine Rückbesinnung auf Handschins zentrales Anliegen
Handschins Buch ist ein ausgedehntes Plädoyer zugunsten einer Integration musiktheoretischen Wissens in die Theoriebildung der Psychologie. Handschin wagte dabei den Vorstoß in den wohl zentralsten und zugleich unzugänglichsten Bereich, auf den sich das Forschungsinteresse an Musik überhaupt richten kann – auf die Frage nämlich nach der musikalischen ›Qualität‹ des Tons. Für jemanden, der mit harmonisch-tonaler Musik vertraut ist, hat das musikalische Hören eines Tons a als Leitton in B-Dur einen anderen Erlebnisgehalt als das Hören eines Tons a als Grundton in A-Dur. Dieses Phänomen bezeichnet der Begriff der ›Tonqualität‹. Was ist die Quelle für dieses Phänomen?
Handschin näherte sich der Frage nach der musikalischen Qualität des Tons vor allem als Historiker, um seine Antworten als Substrat einer jahrhundertealten Tradition des Nachdenkens über Musik zu präsentieren. Parallel dazu setzte er sich in historischer Rückschau auch mit den Beiträgen auseinander, die Psychologen seit dem 19. Jahrhundert zu diesem Thema geleistet hatten. Mit der herausfordernden Wahl seines Untertitels Eine Einführung in die Tonpsychologie verband er wohl die Hoffnung, dass der von ihm betrachtete Gegenstand als fehlendes Gegenstück zu einer großen Lücke in Carl Stumpfs unvollendeter Tonpsychologie erkannt werden würde.[3] Handschin war sich nämlich darüber im Klaren, dass es zur Beantwortung der Frage nach der musikalischen Qualität der Töne einer Brücke zwischen Musiktheorie und Tonpsychologie bedurfte, und eine solche hatten die großen Vordenker in diesen Disziplinen – Hugo Riemann und Carl Stumpf – ungeachtet erster verdienstvoller Schritte in dieser Richtung noch nicht zu schlagen vermocht. Den zeitgenössischen Psychologen bescheinigte Handschin hinsichtlich des von ihm anvisierten Untersuchungsgegenstands »weitgehende[.] Ratlosigkeit«, und den Musiktheoretikern warf er »vollständige[s] Beiseitestehen[.]«[4] vor. Während der Untertitel des Buchs die einfache lehrbuchartige Synopsis eines gut erschlossenen Wissensgebiets zu versprechen scheint, findet der Leser indes eine schwer überschaubare und verzweigte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und den sich um seine Bestimmung rankenden Argumenten mit vielen Exkursen in die Ideengeschichte vor.
Im Kern dreht sich Handschins Abhandlung zum Toncharakter um die Idee eines zweifachen Gegebenseins musikalischer Tonbeziehungen auf Grundlage der Zugehörigkeit der Töne zu einem Tonsystem. Konkret manifestiert sich das Gegebensein der Tonbeziehungen nach Handschins Auffassung in zwei einander durchkreuzenden Ordnungen: einer ›äußeren‹ nach Tonhöhen und einer ›inneren‹ nach Quintabständen. Musikalisch manifestiert sich jene innere Ordnung als eine Skala von Tonqualitäten, die Handschin ›Toncharaktere‹ nennt.
Was ich nun behaupten möchte – glaube feststellen zu müssen –, ist, dass der »musikalische Charakter« des Tons eben durch die Stellung bestimmt ist, die er in der oben aufgezeichneten Reihe [f-c-g-d-a-e-h], dieser »Gesellschaft von Tönen«, einnimmt.[5]
Das, was wir in den Toncharakteren vor uns haben, ist die eigentlich musikalische Qualität des Tons; und es ist »etwas Wunderbares«, dass diese Qualität offenbar nur durch die Zugehörigkeit des Tons zum System zustande kommt. Oder sagen wir besser: Sie besteht darin.[6]
Was hier auf den ersten Blick wie eine Glorifizierung der eigenen Ausgangsthese wirken mag, ist wohl eher ein Hinweis auf Handschins aufrichtige Verwunderung über Erkenntnisse, die er schon bei Guido von Arezzo vorfand und dann weiterentwickelte, und deren Relevanz er hervorheben wollte. Als ›proprietas sonorum‹ bezeichnete Guido die Eigentümlichkeit eines Tones, die ihm aufgrund seines Verhältnisses zu den anderen Tönen innerhalb eines Hexachords zukommt.[7] Er entdeckte dabei eine Affinität zwischen diatonischen Schrittintervall-Mustern im Quint- bzw. im Quartabstand. Da diese Affinität wiederum in engem mathematischen Zusammenhang mit der Quint-Generiertheit der diatonischen Skala steht, sah Handschin im Quintabstand die Ursache für einen elementaren Unterschied im Toncharakter und plädierte dafür, die Quintenkette f-c-g-d-a-e-h als eine Skala von Toncharakteren zu betrachten.
Es lohnt sich, auf die von Guido entdeckte Affinität kurz im Detail einzugehen: Das mittelalterliche Verständnis vom Toncharakter bezieht sich auf die jeweilige Stellung eines Tons im diatonischen Schrittmuster. Die Befürworter der relativen Solmisation in der Musikdidaktik sind moderne Vertreter dieser Denktradition. Guido erkannte, dass man das (später nach ihm benannte) Hexachord (Ganzton-Ganzton-Halbton-Ganzton-Ganzton) innerhalb des vollständigen diatonischen Schritt-Intervallmusters aus fünf Ganztönen und zwei Halbtönen gleich zweimal antrifft: zum einen in der Tonfolge c-d-e-f-g-a (später als ›hexachordum naturale‹ bezeichnet) und zum anderen in der Tonfolge g-a-h-c-d-e (›hexachordum durum‹). Im Zentrum beider Hexachorde steht ein Halbtonschritt (e-f bzw. h-c), der oben und unten von je zwei Ganztonschritten eingerahmt wird. Daraus ergibt sich die bereits erwähnte Affinität zwischen diatonischen Mustern im Quintabstand (bzw. auch im Quartabstand), die für die Entwicklung der europäischen Mehrstimmigkeit von größter Bedeutung ist. Man denke nur an die kontrapunktischen Imitationen der franko-flämischen Vokalpolyphonie: Jedes Soggetto, dessen Töne im Guidonischen Hexachord enthalten sind, kann im Quint- oder Quartabstand imitiert werden ohne den diatonischen Rahmen zu verlassen und ohne seine relative Tonhöhenstruktur zu verändern. Typische Einsatz-Schemata der einander imitierenden Stimmen benutzen genau jene Intervalle. Auch etwa das hexachordale Thema der C-Dur-Fuge aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers J.S. Bachs erinnert an diese alte Tradition.
Eine markante hierzu passende Argumentation mit einem für Handschin nicht untypischen polemischen Unterton gegen die »Zwölftönler« findet sich im Kontext einer Auseinandersetzung mit der psychologischen Erklärung von Oktavperiodizität durch Geza Révész:[8]
Was ist es also, das nach der Oktave wiederkehrt? Es ist die gegliederte musikalische Gestalt, etwas, in dem sich Tonhöhe und Toncharakter untrennbar verflechten und das nicht rein tonräumlich betrachtet werden darf. Spricht man also, wie die Zwölftönler, von Wiederkehr nach 12 Halbtönen, so ist dies eigentlich eine Begriffsvermischung. Die Wiederkehr nach einem musikalisch, das heisst gestaltmässig gegliederten Abstand aber findet, wenn auch in abgestufter Weise, auch bei der Quinte und Quarte statt.
Hier sehen wir, wie sehr die Auffassung von Revesz der der modernen Zwölfton-Verehrer entgegenkommt. Schon Erpf hat bezüglich dieser beobachtet, dass sie, um die Strukturarmut ihres Systems zu kompensieren, gern zum Kanon und zu anderen Satzkünsten greifen. Aber Konstruiertheit ist nicht Strukturiertheit. Die psychologische Gegenprobe ist sehr leicht zu machen: ein Kanon bei den Niederländern und bei Palestrina kommt real zur Geltung, weil er nicht nur abstandsmässig verläuft, sondern durch den Toncharakter gestützt wird (und dies gilt sogar bei Veränderung des Toncharakters, das heisst zum Beispiel beim Kanon in der Sekunde), ein Kanon ohne die inneren Tonbeziehungen dagegen bleibt auf dem Papier und kann höchstens dem Feuilletonisten dazu dienen, die »Strenge« einer solchen Musik zu preisen.[9]
Es ist, als habe Dmitri Schostakowitsch in seiner C-Dur Fuge aus Op. 87, die zwei Jahre nach dem Erscheinen von Handschins Buch entstand, eine solche ›psychologische Probe‹ im Sinne gehabt. Er verzichtet das ganze Stück hindurch auf den Gebrauch von Versetzungszeichen und lässt das ebenfalls quasi hexachordal angelegte Thema c-g-c-g-a-g usw. auf allen sieben diatonischen Stufen in tonaler Imitation erklingen. Dadurch exemplifiziert dieses Stück eindrucksvoll nicht nur die Charakterverwandtschaft zwischen dem Thema und seiner Beantwortung in der Oberquinte, sondern auch all die Charakterabstufungen zwischen seinen anderen diatonischen Transpositionen.
Der Zusammenhang zwischen Guidos Affinitätsbegriff und der Quint-Generiertheit der Diatonik wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Guidos Hexachord als aufsteigende Quintenkette f-c-g-d-a-e dargestellt werden kann, deren Begrenzung das fallende Halbton-Intervall f-e bildet. Die Affinität zwischen beiden Hexachorden entspricht der einfachen Quintverschiebung dieser Quintenkette in die unmittelbar benachbarte, c-g-d-a-e-h.
In diesem Beitrag sollen aus der Vielzahl der Aspekte, die Handschin in seinem Buch zusammengetragen hatte, um das Thema einzukreisen und seine Position zu verdeutlichen, zwei herausgegriffen werden, bei denen besonders wichtige Fragen offengeblieben sind.
Einer davon betrifft die Natur des Verhältnisses zwischen Toncharakter und Tonhöhe. Handschins Überlegungen drehen sich um ein Wechselspiel dieser beiden Kategorien, die er einerseits als untrennbar miteinander verflochtene Tonbeziehungen erachtet, die er aber andererseits durch eine ontologische Grenzziehung zwischen dem ›innerlich‹ wahrgenommenen ›eigentlich musikalischen‹ Toncharakter und der ›äußerlich‹ wahrgenommenen Tonhöhe voneinander trennt.
Wenn ich diese Charaktere als die eigentlich musikalische Eigenschaft des Tons ansehe, möchte ich damit die Rolle der Tonhöhe und der Tonhöhenunterschiede nicht herabgesetzt haben. Die volle Mannigfaltigkeit der Musik als Melodie beruht auf dem Spiel dieser beiden Kategorien, die sich ständig durchkreuzen; und der im vollen Sinn Musikalische ist derjenige, der sowohl auf die inneren Tonbeziehungen eingestellt ist, und auch die Höhenabstufungen im Verhältnis zu jenen wahrnimmt.[10]
Wie sind diese beiden Momente seines Ansatzes miteinander verknüpft? Das Bild einer gegenseitigen Durchkreuzung von Toncharakter und Tonhöhe sowie die dieses Bild stützenden Argumente bei Handschin sprechen einerseits für eine genuin doppelte Artikuliertheit musikalischer Tonbeziehungen innerhalb eines wie auch immer gearteten musikalischen Mediums mit Systemeigenschaften. Andererseits überbrückt Handschin die von ihm gezogene ontologische Grenze zwischen dem musikalisch ›Inneren‹ (dem Toncharakter) und der ›äußeren‹ Tonhöhenwahrnehmung mit einem Verweis auf die logarithmische Beziehung zwischen Frequenzverhältnissen und Tonhöhendifferenzen. Die hiermit benannte Konstellation lässt sich verdeutlichen mithilfe zweier konkurrierender Definitionen des Intervalls der Quinte, die einander zwar ergänzen, aber nicht zwangsläufig bedingen: (1) die Definition als Konsonanz mit dem einfachen Frequenz-Verhältnis 3:2 und (2) die Definition als Systembestandteil, nämlich als ein Intervall, das – in Übereinstimmung mit seinem Namen diapente (Quinte) – mit vier Schrittintervallen gefüllt ist. Handschin ist Pythagoreer genug, um den Konsonanz-Status der Quinte als Erklärung für deren Status als Aufbauelement des Systems zu nehmen.[11] Dabei bleibt aber offen, welche Instanz dafür sorgt, die Geschlossenheit des Systems herzustellen, und welche Instanz die Umsortierung der Quintenordnung in eine Tonhöhenordnung oder umgekehrt vornehmen soll.[12]
Daraus ergeben sich zwei Desiderata, die man im Anschluss an Handschins Auffassung formulieren kann: (1) Neben der Wahl der Quinte als Aufbauelement des Systems bedarf es auch eines Abschlusselements, d.h. eines Begrenzungsintervalls für das Tonsystem. Und (2) bedarf es Einsichten in die Natur der erwähnten Durchkreuzung von zwei Tonordnungen, nämlich der Skalenordnung einerseits und der Quintenordnung andererseits. Damit rückt der systembezogene Begriff der Quinte stärker in den Fokus des Interesses.[13]
Zur natürlichen Gliederung eines Ausschnitts von Charakterabstufungen gehört für Handschin die Deutung von deren b-Seite und deren #-Seite als zwei einander polar entgegengesetzten Bereichen.[14] Die darauf gründende Tätigkeit der Systembildung wird zunächst nur rudimentär skizziert:
Wenn der Toncharakter zur Voraussetzung hat, dass der Ton innerhalb der Quintenreihe eine bestimmte Stellung einnimmt, so bedeutet dies, dass der äußere Tatbestand nur eine Art Rohmaterial für die Systembildung ist; wir sondern aus der unendlichen Reihe von Quinttönen zum Beispiel sieben aus, die wir, unserer Rechts-Links-Natur gemäss, so gliedern, dass an den Rändern die Extreme und dazwischen eine Mitte liegt. Dies ist eine aus innerer Wahrnehmung und Systembildung gemischte Tätigkeit, und doch keine willkürliche, denn in Wirklichkeit kann kein Mensch aus solchen Elementen ein System nach Belieben erstellen […].[15]
Diese Scheidung ›naturgegebener Tatsachen‹ in den Tonbeziehungen von den Resultaten »menschlicher Setzung« und darauf aufbauende Annahmen über das Zusammenspiel von innerer Wahrnehmung und Systembildung erweisen sich dann als wichtig bei der Behandlung komplexerer Beschreibungsebenen. Sowohl im Zusammenhang mit der Besprechung der modalen Tonbedeutungen in §23 als auch im Zusammenhang mit der Behandlung der Dur- und Molltonarten der harmonischen Tonalität in §26 weist Handschin darauf hin, dass in Ergänzung zum Toncharakter jeweils weitere Gebilde ins Spiel kommen, welche bei der Erzeugung der Tonqualitäten beteiligt sind. In beiden Fällen verwendet er dafür den Terminus des ›Beicharakters‹:
Wir gehen von unserer Tongesellschaft oder dem Tonsystem als einer »naturgegebenen« Tatsache aus. Auf dieser Grundlage können sich – müssen sich sogar – Gebilde erheben, die in höherem Masse den Charakter menschlicher Setzung aufweisen […].[16]
Es ist klar, dass durch die verschiedenen »Setzungen«, wie sie zum Beispiel die Kirchentöne repräsentieren, jeweils ein neuer Zusammenhang über den ersten gelegt ist, ein Zusammenhang, der in höherem Masse von unserem Willen oder unserer Neigung abhängt. Wir können sagen, dass der Ton mit d-Charakter im d-Modus »Grundton« und im c-Modus 2. Stufe ist, oder wir können sagen, dass der Ton d einen verschiedenen »Beicharakter« erhält, je nachdem ob er 2. Stufe im c-Modus oder 4. im a-Modus ist.[17]
Da sich die Modi des untransponierten Systems dieselbe Quintenkette f-c-g-d-a-e-h teilen, kann aus derselben allein keine Erklärungskraft für die Unterscheidung der genannten Modus-übergreifenden Stufenbedeutungen gewonnen werden. In der Auswahl eines Grundtons oder eines Oktav-Ambitus sah Handschin jeweils einen Akt der Hierarchisierung, den er, wie obiges Zitat verdeutlicht, mit menschlicher Setzung in Verbindung brachte. Das folgende Zitat stellt die beiden Instanzen des Beicharakters im Zusammenhang dar:
Und nun eine in unserem Zusammenhang besonders in Betracht fallende Konsequenz dieser Vordringlichkeit des Dreiklangs: es gehört nunmehr für uns mit zum Charakter, oder vielmehr: es macht den »Beicharakter« des Tones aus, ob er im Dreiklang – und zwar in erster Linie im Durdreiklang – Grundton, Quinte oder Terz ist […]. Erinnern wir an unser Erstes: dies war der Charakter des Tons als Glied jener »Sozietät«. Darüber legte sich als »Super-Struktur« die Funktion des Tons im gegebenen Modus; allerdings wurde dieses Verhältnis durch die »asoziale« Rolle, die das c zu spielen begann, über den Haufen gerannt: indem man fast nur noch im c-Modus dachte, trat dieser beinahe an die Stelle der »natürlichen Sozietät«. Und nun dieses Dritte, der Dreiklang als konsonant geteilte […] Quinte: die Stellung des Tons innerhalb dieser letzteren Einheit können wir, wie die modale Stellung des Tons, zum »Toncharakter im weiteren Sinne« rechnen; doch stehen diese beiden Dinge nicht auf derselben Stufe wie der eigentliche Toncharakter.[18]
Der sich in der Bildung des Begriffspaars ›Charakter‹ vs. ›Beicharakter‹ niederschlagende Natürlichkeitsbegriff stellt eine doppelte Herausforderung dar. Einerseits gilt es ganz grundsätzlich zu verstehen, nach welchen Prinzipien sich historisch verortbare Ausprägungen musikalischer Mentalität als Manifestationen universeller Merkmale der Kognition erkennen lassen. Dies wäre die Aufgabe eines künftigen transdisziplinären Forschungsprojekts. Andererseits regt er dazu an, auch ohne eine befriedigende Antwort auf diese grundsätzliche Frage am Konzept des Toncharakters festzuhalten und es anhand der historisch gewachsenen Ausprägungen musikalischer Mentalität im Rahmen der Musiktheorie zu untersuchen. Hierzu bringt der vorliegende Beitrag einen mathematischen Natürlichkeitsbegriff ins Spiel, mit dessen Hilfe die von Handschin angesprochene Stratifikation des Toncharakters modelliert und bewertet werden kann.
1.2 Wieviel Tonsystem braucht der Mensch? Drei interessante Einwände bei Dahlhaus
Carl Dahlhaus setzte sich in seinen Untersuchungen zur Entstehung der harmonischen Tonalität (1968) differenziert mit Argumenten aus dem Toncharakter auseinander. Seine Einwände betreffen jene oben erwähnten offenen Fragen in Handschins Darlegungen und stellen damit eine besondere Herausforderung für einen neuen Anlauf dar, diese Fragen zu beantworten.
Dahlhaus setzte mit seiner Kritik sowohl bei der von Handschin postulierten Erklärungskraft der Quintenkette an als auch bei der Idee einer Überlagerung von Toncharakter und Beicharakter. Zwar erwog Dahlhaus in seinen Untersuchungen u.a. unter Verweis auf Handschin prinzipiell die Möglichkeit einer Begründung der harmonischen Tonalität aus der »Natur der Musik oder des Menschen«[19], widmete aber dieser Erwägung über die nun zu rekapitulierenden Einwände hinaus kaum weiteren Raum.[20]
Zwei der Einwände tauchen in einem Abschnitt mit der Überschrift »Zur Entwicklung des Tonsystems« im Teil III »Modus und System« der Untersuchungen auf und werden wie folgt mit einer knappen Paraphrase von Handschins Auffassung eingeleitet:
Das Verfahren, die Modi durch die Skala und die Skala durch die Quintenkette zu begründen, schließt, wenn es als Norm des musikalischen Hörens gelten soll, zwei Folgerungen ein: erstens die These, daß ein Ton, unabhängig vom Modus, einen immer gleichen Charakter habe, daß also der Ton e primär als sechster Ton in der Quintenkette von f bis h und erst sekundär als I. Stufe im e-Modus oder als II. Stufe im d-Modus aufzufassen sei; zweitens die Behauptung, daß der Charakter eines Intervalls durch die Anzahl der Quintabstände zwischen den beiden Tönen bestimmt werde, daß also die große Terz vier (f-c-g-d-a) und der diatonische Halbton fünf Quinten (f-c-g-d-a-e) als »innere Distanz« zwischen den Tönen impliziere.[21]
Unter der Prämisse, dass es sich bei diesen beiden Folgerungen um »Norm[en] […] musikalischen Hörens« handeln müsse, unterzieht Dahlhaus sie einer kritischen Betrachtung. Die zweite betrifft das oben bereits beanstandete Fehlen einer Vermittlung zwischen den beiden Ordnungen des Tonsystems nach Quinten einerseits und nach Tonschritten andererseits. Dahlhaus verlegt diese von Handschins Ansatz implizierte Tätigkeit in den Bereich der bewussten musikalischen Wahrnehmung und kritisiert sie dort entsprechend:
Die zweite der Folgerungen aus dem Rekurs auf die Quintenkette, die Behauptung, daß in der Quintenstruktur der Diatonik die kleine Terz drei, die große Terz vier und der Halbton fünf Quintabstände enthalte, ist, wenn nicht irrig, so doch ungenügend. Daß der Ganzton als Differenz zwischen Quarte und Quinte, die große Terz als Zusammensetzung von zwei Ganztönen und der Halbton als Differenz zwischen großer Terz und Quarte bestimmt wird, bedeutet nicht, daß die Quintbeziehung, die das System fundiert, in den Verzweigungen der Intervallableitungen, als dritte, vierte oder fünfte Quinte gegenwärtig sei. Man kann die Vermittlungen, an deren Ende der Halbton steht, in Gedanken rekonstruieren; die musikalische Wahrnehmung ist jedoch eng begrenzt: Für sie verschwinden die Voraussetzungen im Resultat. Man kann sich beim Hören eines Intervalls zwar die letzte Vermittlungsstufe bewußt machen, aber nicht die früheren, kann also Quarte und Quinte beim Ganzton oder die Ganztonverdopplung bei der großen Terz mitdenken, aber nicht vier Quinten bei der großen Terz.[22]
Die erste der beiden kritischen Überlegungen bezieht Dahlhaus auf die schon zitierte Passage in §23 des Toncharakters.[23]
[Denn] daß der Ton e, wenn er als I. Stufe des e-Modus exponiert und als II. Stufe des d-Modus weitergeführt wird, seine Bedeutung ändert, dürfte kaum zu leugnen sein. Und die These, daß dennoch der Charakter des Tones e primär durch die Stellung in der Quintenkette geprägt sei, ist nur durch den Zusatz zu retten, daß der Toncharakter durch den Modus zwar verdeckt und modifiziert, aber nicht aufgehoben werde. Doch wäre einzuwenden, daß eine Modifikation, die den Charakter verdeckt, in einer Musiktheorie, die Phänomene zu beschreiben versucht, von einem Wechsel des Charakters nicht zu unterscheiden ist.[24]
Handschins Stratifikation des Toncharakters im weiteren Sinne in die zwei Komponenten des Toncharakters im engeren Sinne und des Beicharakters wird von diesem spitzfindigen Argument nicht direkt angegriffen, aber anhand eines Einwands methodologischer Natur für nicht überprüfbar erklärt.[25]
Schließlich muss noch ein Einwand erwähnt (und seinerseits kritisch betrachtet) werden, den Dahlhaus gleich auf den ersten Seiten seiner Untersuchungen gegen eine scheinbar von Handschin zu verantwortende »›natürliche‹ Begründung der Dur-Tonalität« vorbrachte. Die Argumentationskette beginnt wie folgt:
Die Toneigenschaft, die Handschin »Charakter« nennt, ist also ein Inbegriff von Beziehungen; der Toncharakter ist gleichsam die nach innen gewendete Position im System oder umgekehrt die Position im System die äußere Darstellung des Toncharakters. Doch bestimmt Handschin den Toncharakter nicht nur formal, als Korrelat zur Stellung im System, sondern auch inhaltlich: Die »unteren« Töne der Quintenreihe, f, c, und g, seien »gesetzter, affirmativer« als die »oberen«, a, e und h. Und die inhaltliche Charakteristik impliziert eine »natürliche« Begründung der Dur-Tonalität. F, c und g sind in C-dur Grundtöne, a, e und h Terztöne der Subdominante, Tonika und Dominante; die Dur-Tonalität bringt also die Natureigenschaft der Töne f, c und g, »gesetzter und affirmativer« zu sein als a, e, und h, drastisch zur Geltung.[26]
Auf die kurze zutreffende Wiedergabe von Handschins ›formaler‹ und ›inhaltlicher‹ Bestimmung des Toncharakters folgt die von Dahlhaus aufgestellte Behauptung, die inhaltliche Charakteristik impliziere eine »›natürliche‹ Begründung der Dur-Tonalität«. Möchte man Dahlhaus’ komplexe Argumentation nachvollziehen, ist es ratsam, zunächst einmal auf ihr Ende zu schauen:
Die Molltonalität jedoch verkehrt die Toncharaktere ins Gegenteil; die Behauptung, dass f und c auch als Mollterzen »gesetzt und affirmativ« seien, wäre paradox. Zwar sind f und c in Moll, nicht anders als in Dur, einander ähnlicher als f und d oder c und a; die Ähnlichkeit, deren Maß der Quintabstand ist, bleibt bestehen. Aber sie wechselt ihren Inhalt. Nur die formale Definition des Toncharakters als »nach innen gewendete« Position im System ist demnach unwiderlegbar. Wird aber die inhaltliche preisgegeben, so ist zugleich die »natürliche« Begründung der Dur-Tonalität aufgehoben.[27]
Dass Handschin eine ›natürliche Begründung der Dur-Tonalität‹ gar nicht im Sinne hatte, wurde ja bereits im vorigen Abschnitt anhand seiner Äußerungen zur Rolle des Beicharakters in der Dur-Moll-Tonalität unterstrichen: Die Ordnung der Charaktere betrachtete Handschin als ›natürlich‹, die der Beicharaktere (mithin auch die der Dur- und Molltonarten) hingegen als ›Setzung‹. In jener Passage, auf die sich Dahlhaus bezog, spricht Handschin von einem Bund des c-Modus mit den »Naturmächten«[28]. Mit dem Kriterium einer Affinität zwischen der Ordnung der von Handschin als natürlich betrachteten Charaktere und der als Setzung betrachteten Beicharaktere verbindet er die Dichotomie ›normal/nicht normal‹.[29]
In der Gegenläufigkeit von Toncharakter und Beicharakter bei den Molldreiklängen hatte Handschin eine Erklärung für die größere musikalische Interessantheit der Molldreiklänge und der Molltonart gesehen, keinesfalls aber eine Paradoxie. Dahlhaus’ Kritik wird nur verständlich angesichts des Umstands, dass er Handschins Zerlegung der Toncharaktere in Charaktere und Beicharaktere nicht gelten lässt.
Im Mittelstück der besagten Argumentationskette führt Dahlhaus einen interessanten Nebenschauplatz ein, indem er zunächst darauf hinweist, dass für ein Verständnis der Durtonart nicht das Quintensystem f-c-g-d-a-e-h heranzuziehen sei, sondern das Quint-Terz-System f-a-c-e-g-h-d. Ganz abgesehen von der Natürlichkeitsfrage ist dieses Argument von großer Relevanz für ein Anknüpfen an Handschins Ideen zum Beicharakter. Dahlhaus genügt der Hinweis darauf, dass das Quint-Terz-System der Tonbeziehungen in Dur und das Quintensystem der Handschin’schen Toncharaktere in Hinblick auf sein Argument einander nicht ausschließen. Eine weiterführende Untersuchung steht daher vor der Aufgabe, die strukturellen und logischen Beziehungen zwischen beiden Systemen umfassender aufzuklären. In Abschnitt 3.6 wird auf neue Resultate in dieser Richtung eingegangen.[30]
1.3 Weitere Schlaglichter auf die Rezeptionsgeschichte
Rudolf Stephan, der Herausgeber des bislang einzigen Nachdrucks des Toncharakters von 1995, würdigt den seiner Meinung nach unumstrittenen Rang des Buchs mit den Worten: »Es ist ein Werk, das, um ein bekanntes Wort zu variieren, genau von den richtigen Leuten bedacht oder beiseite geschoben wurde«[31]. Während nämlich Handschins Musikgeschichte im Überblick aus demselben Jahr 1948 bis heute als einschlägige Quelle geschätzt wird, begegnete die Fachwelt dem Toncharakter mit einer ambivalenten Haltung, welche zwar Handschins Belesenheit und Eloquenz wertschätzte, dem inhaltlichen Kern aber weitgehend mit Ablehnung, fortgesetzter Ratlosigkeit oder einfach Desinteresse gegenüberstand.
Eine ausnehmend wohlwollende und sehr ausführliche – wenn auch zugleich etwas vereinnahmende – Besprechung (von immerhin 58 Seiten) publizierte Walter Wiora 1951 unter dem Titel »Der tonale Logos: Zu J. Handschins Buch ›Der Toncharakter‹«. Die schwer überschaubare Organisation des Materials und die mitunter irritierenden Sprünge und Abschweifungen in Handschins Buch mochten Wiora motiviert haben, den Leser*innen der Musikforschung mit einer didaktisch aufbereiteten Paraphrase den Zugang zum Original zu erleichtern. Darin würdigt er das Buch als einen wichtigen Beitrag zur Grundlegung einer systematischen Musiktheorie.
In einem Handbuchartikel zu »Begründungen musiktheoretischer Systeme« von Helga de la Motte-Haber und Peter Nitsche (1982) wird Handschins Buch eher beiläufig unter einer Rubrik »psychologisch-phänomenologische[r] Theorien« erwähnt, als Beispiel für eine Theorie »im althergebrachten Sinn«[32] – eine Theorie, die noch danach getrachtet habe, das Wesen einer Sache fassbar zu machen. »Ontologische Kontemplationen«[33] über das Tonsystem glaubte die damalige systematische Musikwissenschaft offensichtlich für immer hinter sich gelassen zu haben. Musikstücke sollten demnach in ihrer Einzigartigkeit verstanden werden und nicht nur als Exempel eines allgemeinen Prinzips.[34] Immerhin gibt es am Ende jenes Handbuchartikels einen Hinweis darauf, dass die sich damals konstituierende Kognitionsforschung sich für die Verfolgung von Fragen, wie sie Handschin stellte, für zuständig erklärte:
Daß in diesen Tiefen [der musikalischen Sprache] grundsätzlich Logik und noch allgemeiner Kräfte des Lebens walten könnten – diese Prämisse der psychologisch-phänomenologischen Theorien ist heute Anlaß zur Frage, ob es zeitlose Beziehungen gibt, auf denen die Aktivitäten des erkennenden und erlebenden Subjekts beruhen könnten.[35]
Bis heute ist der Frage nach der Aktualität bzw. Aktualisierbarkeit von Handschins Ideen nicht gründlich nachgegangen worden. Eine gewisse Aufforderung dazu kann man bereits in die zeitnah zum Erscheinen des Toncharakters verfasste Rezension des amerikanischen Psychologen und Musikwissenschaftlers Charles W. Fox aus dem Jahre 1949[36] hineinlesen. Dieser macht Handschin den Vorwurf, unter Geringschätzung der damals modernen Physiologie und Psychologie eine dogmatisch verfasste »Ein-Mann-Psychologie«[37] aufgestellt zu haben. Dennoch paraphrasiert Fox zentrale Thesen Handschins zum Toncharakter recht klar und veranschlagt einen längeren Zeitraum bis zum Erreichen eines Wissensstandes, der die Psychologie in die Lage versetzen werde, Handschins Antworten mit einer gewissen Bestimmtheit bewerten zu können. Wenn man dies als eine ernstgemeinte Forschungsperspektive liest und nicht nur als eine Geste akademischer Höflichkeit, dann kann die aktuelle, zwischen Musiktheorie und Kognitionsforschung angesiedelte Diskussion zum Thema der ›Skalenstufen-Qualia‹ als Impuls für einen Versuch verstanden werden, Handschins Antworten produktiv in diese Diskussion einzubringen.
2. ›Skalenstufen-Qualia‹ als aktuelles Forschungsthema
Die Suche nach wissenschaftlichen Zugängen zu den subjektiven Erlebnisgehalten der Wahrnehmung von Tönen bzw. zu kognitivem Verhalten, welches damit in Verbindung stehen könnte, sieht sich auch heute noch mit ungeklärten ontologischen und epistemologischen Fragen konfrontiert. Dessen ungeachtet erschließen sich sowohl Musiktheoretiker*innen als auch Kognitionsforscher*innen jeweils fachspezifische Beschreibungsebenen für diesen Untersuchungsbereich. Darüber hinaus entspinnt sich gegenwärtig eine interdisziplinäre Diskussion zu den Verbindungen und Trennlinien zwischen diesen Ansätzen. Sie eröffnet ein passendes Forum dafür, an Handschins Ideen anzuknüpfen und diese zu aktualisieren.
Den Ausgangspunkt dieser Diskussion bilden zwei verschiedene Definitionsversuche des Begriffs der ›Skalenstufen-Qualia‹ (scale degree qualia). Sie finden sich jeweils in Buchkapiteln einerseits des Kognitionsforschers David Huron (2006) und andererseits des Musiktheoretikers Steven Rings (2011). Die beiden dahinterstehenden Ansätze inspizierte seinerseits Benjamin Hansberry (2013) dann im Lichte des Qualiaproblems aus Sicht der Philosophie des Geistes. Die folgenden Abschnitte dienen dazu, in die besagte Diskussion und ihre Hintergründe einzutauchen und Anknüpfungspunkte an Handschins Ideen aufzuzeigen. Hierzu wird, nach einem Exkurs zu theoriegeschichtlichen Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte (2.1), zunächst Hurons Ansatz dargestellt und in seinem Verhältnis zu Handschin untersucht (2.2). Anschließend wird auf Rings Studie von 2011 eingegangen. Nachstehend wird überlegt, ob und wie Rings’ Ansatz mit Handschins Ideen um den Toncharakter vereinbar ist (2.3). In einem gesonderten Abschnitt (2.4) werden dann einige Einwände und Anregungen von Hansberry (2013) rekapituliert, die sich kritisch mit Hurons Berufung auf den Qualia-Begriff aus der Philosophie auseinandersetzen.
2.1 Exkurs: Skalenstufen in der post-atonalen Musiktheorie
Die Ansätze von Huron (2006) und Rings (2011) zu den Skalenstufen-Qualia sind beide von fächerübergreifenden theoretischen Entwicklungen aus dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts geprägt. Bereits die Parallelität zwischen der Kapitelüberschrift »Tonality« bei Huron und dem Buchtitel Tonality and Transformation bei Rings zeigt, dass beide Autoren den Begriff der Skalenstufen-Qualia einem gemeinsamen Untersuchungsgebiet zuordnen: dem der (harmonischen) Tonalität. Sowohl Huron als auch Rings lassen erkennen, dass es ihnen um einen unkomplizierten, pragmatischen Umgang mit diesem bedeutungsschweren Terminus geht. Unter Anerkennung der Bedeutungsvielfalt des Tonalitätsbegriffs schränkt Huron sein konkretes Untersuchungsinteresse auf von Skalenstufen evozierte Empfindungen ein. Rings spricht in seinem Buch vor allem eine mit der Schenker-Tradition vertraute Leserschaft an und betont daher sein Interesse an einer Theorie tonaler Erlebnisgehalte, die einem Interesse an werk-immanenten Zusammenhängen nicht im Wege steht, sondern jenes erweitern kann. Wie bei Huron spielen auch in Rings’ phänomenologisch ausgerichtetem Ansatz die Erlebnisgehalte von Skalenstufen eine exponierte Rolle.
Das musiktheoretische Konzept der diatonischen Skalenstufen hat in den theoretischen Turbulenzen der letzten Jahrzehnte eine interessante Geschichte durchlaufen. Ungeachtet ihrer beeindruckenden Tradition und ihrer Allgegenwart in der musikalischen Praxis wurde die auf die Diatonik bezogene Liniennotation für Töne und Intervalle (mit Stammtönen und Vorzeichen) im Laufe des 20. Jahrhunderts als adäquate Beschreibungsebene und Erkenntnisquelle für musikalische Sachverhalte von manchen Musikforschern beargwöhnt.[38] Indes hielt der musiktheoretische Fachdiskurs an den diatonischen Skalenstufen als gültiger Beschreibungsebene fest, und zwar nicht nur bei der Aufarbeitung historischer Musiktheorie sondern auch im Zusammenhang aktueller Theoriebildung für die Analyse harmonisch-tonaler Musik. Insbesondere gründet sich die Schenker-Tradition neben dem Dreiklang auf dessen Ausfüllung mittels diatonischer Schrittintervalle als eine ihrer elementaren Voraussetzungen.
Parallel dazu erhielt die tonale Theorie neue Impulse über den Umweg der atonal set theory. Als Milton Babbitt – einer ihrer Wegbereiter – 1965 über die Rolle der Theorie für das Komponieren nachdachte, schwärmte er ausgerechnet für eine Eigenschaft der diatonischen Skala[39], die auch Handschin hervorgehoben hatte[40] und welche sich als Konsequenz ihrer Quint-Generiertheit ergibt: Aufgrund der von 0 bis 6 wachsenden ›Quintenbreite‹ der diatonischen Intervalle – beginnend von der reinen Prime, über die reine Quarte, die große Sekunde, die kleine Terz, die große Terz, die kleine Sekunde bis zur übermäßigen Quarte – variieren deren Vielfachheiten innerhalb der diatonischen Skala in umgekehrter Reihenfolge von sieben Primen, über sechs reine Quarten, fünf große Sekunden, vier kleine Terzen, drei große Terzen, zwei kleine Sekunden bis hin zu einer übermäßigen Quarte. Je kleiner die Quintenbreite, desto größer die Vielfachheit. Unter der Bezeichnung ›deep property‹ fand eine Spielart dieser Eigenschaft dann große Beachtung in der diatonic set theory.[41] Durch das Zusammentragen von derartigen Strukturbeobachtungen und das Studium ihrer logischen Abhängigkeiten entwickelte sich innerhalb der Schule um John Clough ein erneuertes Interesse an der Diatonik.[42] Ausgangspunkt für die damit verbundenen theoretischen Innovationen scheint eine einfache aber kühne Idee Eric Regeners (1974) zu sein, die er im Kontext seiner Kritik des Buchs The Structure of Atonal Music von Allen Forte (1973) entwickelt hatte. Dort schlägt er vor, die sieben Stufen der Diatonik als einen homogenen Zyklus von sieben Tönen zu betrachten, ganz in Analogie zu den zwölf Tonhöhenklassen.[43] Die atonal set theory hatte sich das chromatische Zwölftonsystem als Beschreibungsgrundlage erschlossen, und zwar nicht als Erweiterung der Diatonik, sondern als einen völlig symmetrischen Tonraum, in welchem die diatonische Skala als eine von 212 = 4096 Teilmengen betrachtet wird. Eine Vorrangstellung des Zwölftonsystems auch in anderen musiktheoretischen und musiktechnologischen Bereichen ergab sich zudem aus der Tatsache, dass diesem abstrakten Raum mit in gleichstufiger Temperatur gestimmten Instrumenten zugleich ein Medium zur Seite stand, das ihn akustisch verkörperte. Die Kühnheit von Regeners Idee bestand nun darin, die Asymmetrie der diatonischen Skala auszublenden und das Siebenstufensystem ganz nach dem Vorbild des Zwölftonsystems als einen symmetrischen Raum zu konzipieren.[44] Als John Clough (1979) diese Idee aufgriff und ausbaute, eröffnete er damit ein äußerst ertragreiches Kapitel in der Erforschung der Diatonik.
Entscheidend für die Entstehung der diatonic set theory als einer eigenen Untersuchungsrichtung war die mathematische Integration beider Beschreibungsebenen, d.h. einerseits der als ›generisch‹ bezeichneten Ebene der Stufen, Stufenintervalle und Stufenmengen und andererseits der als ›spezifisch‹ bezeichneten Ebene der chromatischen Töne, Intervalle und Akkorde (pitch class sets). Ein Meilenstein auf diesem Weg ist der Artikel »Variety and Multiplicity in Diatonic Systems« von John Clough und Gerald Myerson (1985). Clough und Myerson studieren dort Konkordanzen zwischen generischen Akkorden als Mengen (oder Folgen) von Stufen und spezifischen Akkorden als Mengen (oder Folgen) von Tonhöhenklassen. Sie stellen also die Beschreibungsebenen der Stufen und der Tonhöhenklassen einander gegenüber. Noch einen Schritt weiter gehen Alexander Brinkmann (1986) und Eytan Agmon (1986; 1989). Sie betrachten Stufen als Koordinaten in einem zweidimensionalen Tonraum. Dieser Tonraum besteht aus 84 = 7 x 12 Paaren (generische Stufe, spezifische chromatische Tonhöhe), wenn in beiden Dimensionen von Oktavidentität der Tonhöhenqualitäten ausgegangen wird. Auf diesen Tonraum bezieht sich Steven Rings (2011) bei seiner Untersuchung tonaler Qualia (siehe Abschnitt 2.3).
Die akustische Verankerung des Zwölftonsystems in der gleichstufigen Stimmung mag wiederum empirisch arbeitende Musikpsycholog*innen wie Carol Krumhansl dazu bewogen haben, die Daten vieler empirischer Untersuchungen zur Kognition tonaler Musik auf das Zwölftonsystem zu beziehen. Wie im nun folgenden Unterabschnitt ausgeführt wird, gründet sich der empirische Tonalitätsbegriff, wie ihn auch Huron propagiert, auf den statistischen Nachweis von charakteristischen Störungen der Symmetrie des Zwölftonsystems. Tonalität erscheint dann sozusagen als eine charakteristische Abweichung von Atonalität. Die Existenz der sieben Skalenstufen als ein Medium der musikalischen Kognition ist unter dieser Perspektive keine vor der Untersuchung gemachte Voraussetzung, sondern das Resultat einer Interpretation der Daten, insofern die den diatonischen Skalenstufen entsprechenden sieben Töne im Zwölftonsystem in den betreffenden Statistiken signifikant höhere Werte aufweisen als die verbleibenden fünf tonartfremden chromatischen Töne.
2.2 Huron: Skalenstufen-Qualia als »süße Vorwegnahmen«[45]
Hurons empirischer Zugang zu den Erlebnisgehalten von Skalenstufen baut auf Forschungsergebnissen von Krumhansl (1990) auf, welche sie und ihre Mitarbeiter Mark Schmuckler und Ed Kessler in den späten 1970er-und 1980er-Jahren erzielt hatten. Hurons Mitarbeiter Bret Aarden (2003) verfeinerte die damals verwendeten Methoden und konnte damit die früher erzielten Ergebnisse noch ausdifferenzieren. In dieser Tradition der empirisch ausgerichteten kognitiven Psychologie wird das Phänomen der Tonalität u.a. statistisch mit Hilfe von ›Tonhöhenklassenprofilen‹ (pitch class profiles) bestimmt. Dabei handelt es sich um zwölfdimensionale Vektoren, die jedem der zwölf chromatischen Töne einen Wert zwischen 0 und 1 zuordnen. Das Zwölftonsystem bildet also die Basis eines zwölfdimensionalen Parameterraums.
Mit diesen Tonhöhenprofilen können Messungen aus ganz verschiedenen Untersuchungen festgehalten und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielweise können damit die relativen Vorkommenshäufigkeiten jedes der zwölf chromatischen Töne aus einem Korpus von Melodien in derselben Tonart zusammengestellt werden. Oder es können die Präferenzen von Versuchspersonen gegenüber diesen zwölf chromatischen Tönen festgehalten werden, nachdem die Proband*innen im Hörexperiment durch das Vorspielen einer Passage auf eine festgelegte Tonart eingestimmt wurden. Auch indirekte Messdaten, wie Reaktionszeiten von Versuchspersonen bei bestimmten Aufgaben, können Aufschluss über mögliche internalisierte Wertigkeiten der zwölf Töne im Kontext von Tonarten geben. In den Untersuchungsergebnissen manifestieren sich die Tonarten in der Form charakteristischer Tonhöhenprofile, und das Interesse der Forschung richtet sich darauf, Korrelationen zwischen den auf verschiedenem Wege gefundenen Profilen zu extrahieren und in Form von Hypothesen zur musikalischen Kognition zu interpretieren.
Angesichts der Beobachtung einer Ähnlichkeit zwischen den statistischen Tonhäufigkeiten einerseits und den in Hörexperimenten ermittelten Tonartprofilen andererseits hatte Krumhansl die Frage nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Messergebnissen aufgeworfen. Ihre Hypothese, dass die Tonhäufigkeiten über statistisches Lernen internalisiert würden[46], bildete eine der Motivationen für Aardens Untersuchungen.[47] Mit seiner verfeinerten Methodik konnte er zwei Komponenten isolieren, die in den Krumhansl-Kessler-Tonhöhenklassenprofilen für Tonarten einander noch überlagerten, nämlich die ›Güte des Zusammenpassens‹ (›Goodness of Fit‹) eines ausgewählten Tons mit dem tonalen Kontext und das Potenzial desselben Tons zur Erzielung von Schlusswirkung in diesem Kontext. Die von Aarden verbesserte Übereinstimmung zwischen den Tonhäufigkeiten und den internalisierten Tonartprofilen verleiht Krumhansls Hypothese eine entsprechend höhere Plausibilität.[48]
Huron und Aarden erweitern den Anwendungsbereich dieser Hypothese auch auf die statistischen Eigenschaften von Tonprogressionen. In Ergänzung einer einzigen Zahl, die die Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten Tons misst, geben dann zwölf Zahlen darüber Auskunft, wie häufig jede der zwölf möglichen Fortsetzungen anzutreffen ist. In Ergänzung eines Vektors mit zwölf Koeffizienten betrachtet man dann eine Matrix mit 144 = 12 x 12 Koeffizienten. Jede Zeile dieser Matrix gibt ein Porträt des betreffenden Tons hinsichtlich seiner Fortsetzungstendenzen.[49]
Hurons Beitrag zu den Erlebnisgehalten von Skalenstufen ist wohl vor allem als ein Versuch zu deuten, diese statistischen Porträts musikpsychologisch zu interpretieren. Interessanterweise zieht er hierzu den Terminus der ›Qualia‹ heran. Als ›Quale‹ bezeichnet man in der analytischen Philosophie des Geistes den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes. Die Verwendung dieses Terminus im Zusammenhang der Huron’schen Argumentation bedeutet also ein Überschreiten disziplinärer Grenzen von erheblicher Tragweite, denn zu den in der Qualia-Debatte ausgetragenen Kontroversen gehört auch die Frage, ob die Kognitionswissenschaften grundsätzlich in der Lage sein können, das Phänomen des Erlebens überhaupt zu erklären. Im Einleitungstext zu seinem Buchkapitel 9 (»Tonality«) schreibt Huron:
Philosophers use the word quale to refer to the subjective feelings that accompany sensory experiences. […] Qualia accompany all consciously experienced sensations, including the sensation of sounds. When I hear an isolated leading-tone, I experience a strong sense of precariousness or instability mixed with some urgency and accompanied by feelings of yearning or aspiring upward. That is, the leading-tone evokes a striking and distinctive quale. In this chapter, I propose to explain how scale tones might acquire their unique psychological characteristics.[50]
In seiner Untersuchung ergänzt Huron die Ebene der statistischen Zugänge um eine explorative Studie, in welcher er Musiker*innen darum ersucht, introspektiv die unverwechselbare Qualität bzw. den Charakter jeder Skalenstufe der Durtonleiter zu ergründen und so genau als möglich zu beschreiben. Die Aufgabenstellung geht von der Annahme aus, dass die bloße Vorstellung von einem bestimmten Skalenton ein Quale evoziert und dass zumindest Musiker*innen in der Lage sind, die eigentlich unbeschreibbaren Qualitäten dennoch in einer sprachlichen Form festzuhalten. Das Ergebnis überrascht sowohl hinsichtlich des Reichtums der verwendeten Formulierungen als auch hinsichtlich des Grads an intersubjektiven Übereinstimmungen. Die Beschreibungen klassifiziert Huron dann nach folgenden semantischen Kategorien: ›certainty/uncertainty‹, ›tendency‹, ›completion‹, ›mobility‹, ›stability‹, ›power‹, ›emotion‹. Das Ergebnis dieser Studie fasst Huron wie folgt zusammen:
scale degrees are wonderfully evocative. Given a particular key context, a simple pitched tone seems to be capable of evoking a cornucopia of psychological impressions or feelings. Moreover, these feelings are not merely idiosyncratic to different listeners: Western-enculturated listeners appear to experience broadly similar qualia.[51]
Der dritte und entscheidende Schritt in Hurons Studie besteht darin, die beobachtete Übereinstimmung der verbalen Beschreibungen mit Krumhansls Hypothese vom statistischen Lernen in Verbindung zu bringen. Demnach geht mit jeder Skalenstufe ein jeweils charakteristisches Maß an Vorhersagemöglichkeiten für den Übergang zum nächsten Ton einher, welches sich im subjektiven Erleben niederschlägt. Die permanente antizipatorische Tätigkeit der Hörenden evoziert aufgrund dieser Vorhersagemöglichkeiten verschiedene Einstellungen und Gefühle. Darunter hebt Huron drei besonders hervor: Tendenz, Schlussbildung und Vergnügen/Genussempfinden (bei Antizipationen).
[W]e can now see how the probability structure of sounded events might account for at least three common qualia associated with scale degrees. When the first-order probabilities are high, the evoked feeling state is characterized by a sense of tendency. […]
When the first-order probabilities predict silence or pause, the evoked feeling state is characterized by a sense of repose or closure. […]
Whenever a pitch is highly expected, a prediction effect is generated. As noted, the resulting positive emotion is typically misattributed to the sound itself. As a consequence, some scale tones sound nicer than other tones. […] The qualia of pleasure appears to be a direct consequence of learned high probability events.[52]
Auch wenn Handschin vor 70 Jahren eine andere Terminologie verwendete und andere theoretische und methodische Voraussetzungen mitbrachte als Huron vor zehn Jahren, so steht dennoch außer Frage, dass beiden Ansätzen ein Erkenntnisinteresse gemein ist, das sich im weitesten Sinne auf Erlebnisgehalte von diatonischen Skalenstufen richtet. Auch propagieren beide Autoren jeweils einen Erklärungsansatz für das Zustandekommen solcher Erlebnisgehalte. Inhaltliche Überschneidungspunkte zwischen Huron und Handschin gibt es ansonsten kaum. Aufschlussreich ist eher das Bestehen einer Komplementarität in der Wahl der jeweils betonten Beschreibungsebenen. Sie lässt sich gut mit einem Begriffspaar aus der strukturalistischen Semiotik erfassen, nämlich der Unterscheidung von ›paradigmatischen‹ und ›syntagmatischen‹ Beziehungen zwischen Tönen bzw. Tongebilden. Paradigmatische Beziehungen gehen die Töne zum Beispiel aufgrund ihrer Lage in einem Tonsystem ein und spielen in dieser Form bei Handschin eine zentrale Rolle. Tonübergänge in einem Musikstück hingegen sind Beispiele für syntagmatische Beziehungen, und eine Statistik aller Tonübergänge in einem Korpus von Liedmelodien erfasst damit rein syntagmatische Beziehungen in einer quantifizierten Form.
Paradigmatische Tonbeziehungen sind aber nicht generell ein blinder Fleck in der empirischen Tonalitätsforschung. Erwähnenswert ist insbesondere eine Untersuchung von Krumhansl (1979) zur quantitativen Bestimmung der von Versuchspersonen empfundenen Ähnlichkeiten für alle 169 = 132 aus den zwölf chromatischen Tönen (plus Oberoktave c’ des tiefsten Tons c) gebildeten Tonpaare im Kontext einer zuvor etablierten Tonart. Eine multidimensionale Skalierung der Daten in zwei bzw. drei Dimensionen zeigt eine chromatische Ordnung zusammen mit einer Stratifikation der 13 Töne in drei Ebenen, nämlich den Tonika-Dreiklang c-e-g-c’, dessen diatonisches Komplement d-f-a-h und die verbleibenden fünf nicht-diatonischen Töne. Roger Shepard verfeinerte 1979 die geometrische Modellierung von Tonhöhenbeziehungen auf der Basis empirisch gewonnener Daten. In einem gemeinsam mit Krumhansl durchgeführten Testtonexperiment wurde jeder von 13 Tönen (c, cis, d, dis, …, h, c’) nach einer C-Dur-Tonleiter vorgespielt, worauf die Versuchspersonen zu bestimmen hatten, wie gut der Testton zur Tonleiter passte.[53] Der betreffende Wert wurde als Abstand zum Grundton gedeutet und entsprechend auf alle zwölf (bzw. 13) Durtonarten übertragen. Nach Mittelung der jeweils beiden Abstände zwischen je zwei Tönen entstand eine symmetrische Ähnlichkeitsmatrix, die dann einer multidimensionalen Skalierung in vier Dimensionen unterzogen wurde. Die Projektion der 13 Punkte auf die Dimensionen 1 und 2 lieferte eine kreisähnliche Anordnung, in welcher die Töne in chromatischer Ordnung erscheinen. Die Projektion derselben Punkte auf die Dimensionen 3 und 4 lieferte ebenfalls eine kreisähnliche Anordnung, worin die Töne nach Quinten geordnet erscheinen.
Dieses empirische Resultat repräsentiert eine Erfassung paradigmatischer Tonbeziehungen und ist offensichtlich mit Handschins Annahme einer gegenseitigen Durchkreuzung von Tonhöhe und Toncharakter gut vereinbar. Zudem stiftet es eine geometrische Deutung derselben, die Handschin aber vermutlich als einen trügerischen »Optizismus« verworfen hätte.[54]
Dieser Exkurs legt immerhin nahe, dass Hurons einseitig syntagmatischer Ansatz zur Erklärung von Skalenstufen-Qualia mit Hilfe bereits verfügbarer Methoden zur Untersuchung paradigmatischer Beziehungen ergänzt werden sollte. Und im Zuge dieser Erweiterung dürfte es sich lohnen, Handschins Ideen in produktiver Weise neu zu interpretieren. Dabei gilt es Experimente zu entwickeln, die interpretative Feinheiten einzelner Musikbeispiele zu messen imstande sind. Handschins Argument zur untrennbaren Verflechtung von Tonhöhe und Toncharakter im Oberquintkanon kann durchaus auch auf den von Huron bevorzugten Bereich einfacher volksliedhafter Melodien übertragen werden. Engelbert Humperdincks Melodie Brüderchen, komm tanz mit mir ist geradezu ein Lehrbuchbeispiel für die von Guido entdeckte Affinität zwischen zwei Hexachorden im Quintabstand innerhalb der Diatonik. Im Rahmen der Tonart F-Dur besteht nur ein sehr feiner Charakterunterschied zwischen den Tönen im zweitaktigen Ausgangsmodell c-d-c-b-a-g-f und seiner Sequenzierung g-a-g-f-e-d-c in der Unterquart (vgl. Bsp. 1).
Beispiel 1: Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel (1893), 1. Bild, T. 195–198,
Gesangsstimme (auf die Annotationen wird im folgenden Abschnitt 2.3 Bezug genommen)
Dieser feine Charakterunterschied verschwindet hingegen, wenn man die Melodie gänzlich der von Humperdinck gewählten Harmonik unterordnet und die Sequenz (T. 197–198) damit nicht auf F-Dur, sondern auf C-Dur bezieht.[55] Beispiel 1 verdeutlicht dies: In der oberen Zeile (F-Dur | F-Dur) haben die Töne a, g und f in Takt 197 jeweils denselben Charakter wie im zweiten Takt (T. 196), und die Töne e und d weichen vom Charakter der Töne a und g ab. Der Ton c hat am Anfang und am Ende denselben Charakter. In der unteren Zeile (F-Dur | C-Dur) haben hingegen alle Töne der Takte 197 und 198 denselben Charakter wie die entsprechenden Töne in den Takten 195 und 196. Auf diesen Gedankengang ist im folgenden Abschnitt (2.3) noch zurückzukommen.
Mit der Betrachtung solcher Sequenzen werden paradigmatische Beziehungen stärker in den Fokus der Untersuchung gerückt, und mit ihnen auch die Frage nach einer ›inneren‹ Ordnung von Tonqualitäten im Sinne Handschins. Das im folgenden Abschnitt behandelte Buch Tonality and Transformation von Steven Rings (2011) ist stark von einem Interesse an paradigmatischen Beziehungen geprägt und propagiert eine gut darauf zugeschnittene Parametrisierung von Tönen und Intervallen.
2.3 Rings: generische Skalenstufen als tonale Qualia
Mit seinem Buch Tonality and Transformation präsentiert Steven Rings (2011) eine Überarbeitung seiner Dissertation von 2006, in der es ihm gelingt, einen phänomenologischen Zugang zur Tonalität in der Sprache der transformational theory zu formulieren. Dem Review von William O’Hara ist zu entnehmen, dass die Synthese vor allem ein Resultat der Überarbeitung ist:
Perhaps the most notable addition to the original dissertation is the concept of a Tonal GIS (Generalized Interval System), which turns out to be one of the book’s most significant theoretical set pieces. Intriguingly, this addition makes the book closely reflect the structure of David Lewin’s Generalized Musical Intervals and Transformations (1987 […]) which, along with some earlier articles, inaugurated the field of transformational theory.[56]
Zur Darstellung der Inhalte von Rings’ Buch eignet sich ein zweistufiges Vorgehen, das nicht zuletzt auch ihrer Genese Rechnung trägt. So soll im Folgenden zunächst der Zusammenhang nachgezeichnet werden, den Rings zwischen ›tonalen Qualia‹ und bestimmten musiktheoretischen Parametern herstellt. In einem gesonderten Exkurs im Unterabschnitt 3.2 soll dann auf den Transformationsbegriff in der Musiktheorie eingegangen werden.
Das von Rings konzipierte tonale verallgemeinerte Intervallsystem (›Tonal GIS‹) verbindet eine zweidimensionale Parametrisierung von Tönen bzw. Intervallen, wie sie schon Alexander Brinkman (1986) und Eytan Agmon (1989) vorgeschlagen hatten, mit der Theorie der verallgemeinerten Intervallsysteme nach David Lewin (1987). Diese Parametrisierung soll hier am Beispiel der beiden Deutungen des sequenzierten Hexachords in Brüderchen, komm tanz mit mir erläutert werden.
Jeder Ton wird durch ein Koordinatenpaar repräsentiert, dessen erste Koordinate eine der sieben generischen Skalenstufen und deren zweite Koordinate eine der zwölf chromatischen Tonhöhen bezeichnet (vgl. Bsp. 1 in Abschnitt 2.2).[57] Ein Vergleich der beiden alternativen Deutungen der Töne in den Takten 197 und 198 zeigt, dass sie sich in den generischen Skalenstufen unterscheiden, und zwar um die Differenz von drei Stufen: (, g) versus (
, g), (
, a) versus (
, a) usw. Für Rings repräsentieren die generischen Stufennummern tonale Qualia. Zur Verdeutlichung seiner Idee führt er aus:
One might thus identify the experience of qualitative scale degrees as one of the defining characteristics of what it means to »hear tonally.« The idea provides a suggestive new angle on perennial questions of tonal versus atonal experience. It is plausible that a listener new to atonal music might find such music disorienting not simply because of its preponderance of dissonance or its unfamiliar harmonic vocabulary, but also because those characteristics lead to the experience of pitches as devoid of tonal quality. Rather than hearing pitches as familiar tonal characters, the listener is struck by the pitches’ tonal anonymity.[58]
Was Rings hier wie ein neuer Gesichtspunkt anmutet, deckt sich indes mit Handschins Argument, wenn auch dieser es stärker polemisierend gegen die »Zwölftönler« gerichtet hatte.[59]
Aus der Vielzahl suggestiver Musikbeispiele, in denen Rings das Potenzial der tonalen Qualia für eine phänomenologisch differenzierende Analyse illustriert, seien hier aus dem Kopfsatz von Mozarts B-Dur-Sonate KV 333 die beiden Übergänge vom Ende der Exposition einerseits zu deren Wiederholung und andererseits zur Durchführung aufgeführt (vgl. Bsp. 2).
Beispiel 2: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate B-Dur KV 333, 1. Satz, T. 1, 62–64
Die Exposition endet in der Oberstimme mit der Tenorklausel (2, g)-(1, f) in der Tonart der Dominante (F-Dur). Die wiederholte Exposition beginnt darauf mit einem absteigenden Hexachord (6, g)-(5, f)-(4, es)-(3, d)-(2, c)-(1, b) in der Haupttonart (B-Dur). Die beiden Töne g und f werden also unmittelbar wiederholt und ändern dennoch ihre tonalen Qualia aufgrund des in diesem Moment vollzogenen Tonartwechsels. Die Durchführung beginnt hingegen mit dem Hexachord (6, d)-(5, c)-(4, b)-(3, a)-(2, g)-(1, f) in F-Dur. Die paradigmatische Beziehung zwischen den beiden Hexachorden am Anfang der Exposition und am Anfang der Durchführung entspricht hier also der zweiten Lesart von Brüderchen, komm tanz mit mir.
Zur Ausstattung des von Rings benutzten Apparats gehört auch ein entsprechendes Intervallsystem (Tab. 1). Jedes Intervall hat eine spezifische und eine generische Komponente und die 84 kombinatorisch möglichen Intervalle können in einer Tabelle mit sieben Spalten (generische Intervalle: tonale Qualia) und zwölf Zeilen (spezifische Intervalle: Differenz zwischen chromatischen pitch classes) angeordnet werden. Die 13 diatonischen Intervalle[60] sind dabei entlang der Diagonalen positioniert. Das modulatorische Intervall zwischen den Schlusstönen der Exposition in KV 333 und der Tonhöhe f zu Beginn der Wiederholung ist in der Tabelle als ›Pivot 5‹, d.h. als ›Umdeutungsquinte‹ eingetragen. Die spezifische Komponente dieses Intervalls ist gleich Null, weswegen es in der ersten Zeile der Tabelle erscheint.
Tabelle 1: Intervallsystem nach Rings 2011[61]
Rings geht nicht dezidiert auf die Frage einer Ordnung der tonalen Qualia untereinander ein. Allerdings implizieren die generischen Koordinaten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 der Stufenintervalle Prime, Sekunde, Terz usw. eine Ordnung, und es steht die Frage im Raum, ob diese von musikalischer Bedeutung ist. In diesem Fall könnte man beispielsweise erwarten, dass das Intervall (1, 0) mit der generischen Intervallgröße 1 und der spezifischen Größe 0 – die Umdeutungssekunde Pivot 2 – den Status eines elementaren Aufbauelements für die anderen reinen Umdeutungsintervalle innehat. Aus musikalischer Sicht erscheint es indes plausibler, stattdessen die genannte Umdeutungsquinte als ein Aufbauelement der reinen Modulationsintervalle zu betrachten. Modulationen in die Ober- bzw. Unterquinte werden in den Harmonielehren traditionell als einfacher angesehen, als andere. Solche Überlegungen bieten einen direkten Anknüpfungspunkt zu Handschins Ansatz.
2.4 Hansberry: Skalenstufen-Qualia aus philosophischer Sicht
»What Are Scale-degree Qualia?« ist der Titel eines Vortrags und in Kürze erscheinenden Artikels von Benjamin Hansberry (2013). Darin erinnert sich der Autor zunächst an Gehörbildungsaufgaben aus seiner Ausbildung, bei denen es darum geht, in einem zuvor etablierten tonalen Kontext einzelne Skalenstufen zu identifizieren. Als eine mögliche Grundlage für die dabei trainierte Fähigkeit nennt er die Wiedererkennbarkeit der individuellen Qualia dieser Skalenstufen, d.h. der subjektiven Erlebnisgehalte der betreffenden mentalen Zustände. In seiner darauffolgenden Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Huron (2006) und Rings (2011) geht es Hansberry um eine stärkere Eingrenzung des Qualia-Begriffs auf etwas, was er unter Berufung auf die Qualia-Debatte als ›phänomenalen‹ Erlebnisgehalt bezeichnet. Damit ist eine konkrete Form der subjektiven Erfahrung in Zusammenhang mit einem bestimmten Erlebnis gemeint, also beispielsweise die Frage, wie es sich für einen Musikkenner anfühlt, einen bestimmten Ton als Leitton zu erleben.
Zur Verdeutlichung seines Anliegens sowie in der Absicht einer geeigneten Übertragung auf die Musik erinnert Hansberry an das vielzitierte Gedankenexperiment des Philosophen Frank Jackson (1982). Jackson imaginiert eine prinzipiell zum Farbsehen befähigte Superwissenschaftlerin Mary, welche aber noch nie Farben gesehen hat und welcher in ihrem abgeschirmten Labor ausschließlich ein Schwarz-Weiß-Monitor zur Verfügung steht, über den sie sich alles erdenkliche Wissen zum Thema Farbsehen aneignet. Wenn Mary schließlich das Labor verlässt, wird sie etwas über das visuelle Erleben der Welt hinzulernen, was sie vorher nicht wusste. Sie erwirbt das Wissen darum, wie es sich anfühlt, einen farbigen Gegenstand tatsächlich zu sehen.
Ebenso wäre die Erfahrung, wie es sich anfühlt, einen bestimmten Ton als Leitton zu erleben, aufgrund rein propositional vermittelten musiktheoretischen oder musikkognitiven Wissens nicht ausdrückbar. Hansberry malt sich ein »grobes musiktheoretisches Analogon« zu Mary aus:
It is easy enough to imagine a rough music-theoretical analog to Mary: a music theorist who has exhaustively studied all musical scores and knows the propensities of a B in C major – yet has somehow had no phenomenal experience of music. This person’s concept of may have much the same representational content as ours – e.g., that the scale degree ought to resolve up – but there still seems to be something about the scale degree missing. This imagined theorist may even conceptually grasp the notion of mounting pressure toward the eventual resolution, but not what it is like to have that experience.[62]
Hurons Ansatz eignet sich nach Hansberrys Meinung nicht, um diesem phänomenalen Erlebnisgehalt im engeren Sinne beizukommen. Das statistische Wissen um Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Tönen sei in propositionaler Form kommunizierbar. Aus der Sicht eines Qualia-Proponenten kann es also nicht in das Wissen darüber, wie es sich anfühlt, bestimmte Tonerlebnisse zu haben, übersetzbar sein. (Hansberrys Kritik richtet sich also gegen die Verwendung des Qualia-Begriffs.) Auch unterscheide Huron nicht scharf genug zwischen feeling (dem Gefühl) und feel (dem Sich-Anfühlen).
[…] the leading-tone-ness of a leading tone, the quale, is a »feel« that I attribute to the note. It is how I experience the note. One »feeling« that Huron’s survey participants associate with the leading tone is restlessness. But we attribute this feeling to the listener – it is the listener who is restless listening to the leading tone, not the note itself (except in some highly metaphorical sense). Note that emotions invoke concepts in addition to the qualia themselves. There are, of course, important associations that scale degrees carries for people with certain listening practices, but these are not the phenomenal content.[63]
Auf diese Einwände Bezug nehmend differenziert Claire Arthur (2015) in einem Vortrag zu ihren weiterführenden Untersuchungen im Anschluss an Hurons Ansatz zwischen phänomenalem Gehalt als solchem und Faktoren, die zu dessen Zustandekommen beitragen.[64] Dabei bleibt allerdings die Frage, ob bzw. wie und in welchem Grade der phänomenale Gehalt eines Leittonerlebnisses eine Konsequenz statistischen Lernens sein kann, ungeklärt. Vielmehr zeigt sich im Zusammenhang mit den Einwänden Hansberrys ein epistemologisches Problem, das sich zur ontologischen Debatte um die Existenz der Qualia noch hinzugesellt und eine Herausforderung für die musikwissenschaftliche Forschung aufzeigt. Immerhin ist der Protagonist in Hansberrys Gedankenexperiment ein Musiktheoretiker oder eine Musiktheoretikerin. Wäre es denkbar, dass diese/r ein Wissen über das Zustandekommen von Qualia erlangen könnte, auch wenn ihr/ihm das Erleben derselben verwehrt wird? Dieses Gedankenexperiment erinnert an einen Vergleich, den Edmund Husserl 1907 in der zweiten seiner fünf Vorlesungen zur »Idee der Phänomenologie« anstellte, um seinen erkenntnistheoretischen Ansatz zu illustrieren:
[...] fügen wir zur Illustration des fundamentalen Gedankens, daß das Problem des Wie (wie transzendente Erkenntnis möglich sei und selbst allgemeiner: wie Erkenntnis überhaupt möglich sei) niemals auf dem Grunde von vorgegebenem Wissen über Transzendentes, von vorgegebenen Sätzen darüber, entnommen woher immer und sei es aus exakten Wissenschaften, gelöst werden kann, folgendes bei: ein Taubgeborener weiß, daß es Töne gibt, daß Töne Harmonien begründen und daß in diesen eine herrliche Kunst gründe; aber verstehen, wie Töne das anstellen, wie Tonkunstwerke möglich sind, kann er nicht. Dergleichen kann er sich eben nicht vorstellen, d.h. er kann es nicht schauen und im Schauen das Wie fassen. Sein Wissen um die Existenz hilft ihm nichts, und es wäre absurd, wenn er darauf ausgehen wollte, auf Grund seines Wissens das Wie der Tonkunst zu deduzieren, sich ihre Möglichkeiten durch Schlüsse aus seinen Kenntnissen klar zu machen.[65]
Husserls Argument, dass dem Taubgeborenen das Schauen des Wie der Tonkunst verwehrt bleibe, scheint im Umkehrschluss auf der vereinfachenden Annahme zu beruhen, dass sich einem mit dem Erleben von Musik hinlänglich Vertrauten dieses Wie im Schauen, d.h. in der Introspektion des musikalischen Erlebens, schon zwangsläufig erschließen müsse. Vielleicht hat sich Husserl mit der Wahl seiner Formulierung »verstehen, wie Töne das anstellen« weiter hinausgewagt, als ihm in diesem Moment wichtig war. Aber sie trifft die eigentliche Herausforderung des hier diskutierten Unterfangens, die tonalen Qualia einerseits als phänomenale Gehalte von Tonerlebnissen anzuerkennen, aber andererseits auch ihr Zustandekommen aufgrund musiktheoretischer und psychologischer Tatsachen zu verstehen bzw. zu erklären. Jener zweite Aspekt mag für die Qualia-Debatte von nachgeordneter Bedeutung sein, aber für die im vorliegenden Artikel geführte Diskussion bildet er das Haupanliegen.
Dem Musiktheoretiker Hansberry geht es vor allem um einen deskriptiven Zugang, und er schlägt dazu eine Kombination aus Theorie und experimenteller Introspektion vor. Einerseits erachtet er Rings Parametrisierung der tonalen Qualia[66] als adäquat, fordert aber eine stärkere Einbeziehung der Tonerlebnisse selbst. In diesem Zusammenhang weist er auf eine Besonderheit tonaler Qualia hin, die sie von den Qualia bei Farbwahrnehmungen unterscheidet: die Möglichkeit nämlich, nach hinreichendem Training zwischen verschiedenen Qualia ein und desselben Tons willentlich hin- und her zu wechseln. Sein Paradebeispiel sind die Qualia der Stufenbedeutungen II, IV, VI und VII eines symmetrischen verminderten Septakkords, die ein versierter Musiker je nach antizipierter Auflösung wahlweise in seiner Vorstellung wachrufen kann. Eine Erklärung für diese Möglichkeit sieht Hansberry im Bestehen interpretativer Urteile, die sich im Zuschreiben von Skalenstufen-Qualia äußert:
But if qualia don’t result directly from some physical feature of a sound plus our trained listening habits, where do they come from? Since we can consciously alter the scale degrees we hear, it seems possible that scale-degree qualia attribution results from a kind of interpretive judgment which is related to one’s judgment of key and the relational features that such a judgment implies. That is, upon hearing a snippet of music, one may consciously or unconsciously decide how to attribute scale-degree qualia to the pitches in question. A listener’s capacity to control this judgment will depend on the kinds of musical concepts that listener has in place.[67]
Während Hansberry in seinem Resümee vor allem den Unterschied in der Zielsetzung zwischen seinem deskriptiven und Hurons reduktivem Zugang betont, erscheint ein wichtiger inhaltlicher Unterschied unterbelichtet. Hurons bisherige und auch Arthurs darauf aufbauende Untersuchungen zu den Skalenstufen-Qualia beschränken sich auf musikalische Situationen, in denen der tonale Kontext überkodiert ist. Die Frage eines interpretativen Urteils zu dessen Bestimmung wird dabei also zunächst ausgeklammert. Im Sinne der in Abschnitt 2.2 thematisierten Unterscheidung zwischen paradigmatischen und syntagmatischen Relationen bringt Hansberry mithin einen wichtigen paradigmatischen Aspekt ins Spiel, um den auch niemand herumkommt, der den Huron’schen Ansatz weiterverfolgen will. Denn das statistische Wissen um das Verhalten der Stufen II, IV, VI und VII in einer Molltonart könnte jeweils erst das Erleben der vier Tonhöhen eines als Klang vermittelten verminderten Septakkordes prägen, nachdem die Tonhöhen als Vertreter dieser Skalenstufen interpretiert worden sind. Eine entsprechende Orientierungstätigkeit sollte aber als genuiner Bestandteil musikalischen Erlebens angesehen werden.
Ein erstes Ziel der Gegenüberstellung der aktuellen Ansätze von Huron und Rings im vorliegenden Abschnitt und der Rückbesinnung auf Handschins Ansatz im Abschnitt 1 besteht zunächst darin, sich die Verschiedenheit der Herangehensweisen und Positionen zu vergegenwärtigen. In zweiter Instanz geht es darum, die Bedingungen für die Vereinbarkeit dieser so verschiedenartigen Ansätze zu studieren. Bevor im folgenden dritten Abschnitt ein Anlauf unternommen wird, die Beiträge von Handschin und Rings in ein gemeinsames Modell zu integrieren, soll anhand eines weiteren Beispiels verdeutlicht werden, unter welcher Perspektive die drei Ansätze jeweils zur Charakterisierung des Erlebnisgehalts eines bestimmten Tons beitragen. Betrachtet werden soll der Ton h in der zweiten Choralzeile des Kirchenlieds O Heiland reiß die Himmel auf. Die erstmals 1666 dokumentierte Melodie (Bsp. 3) konnotiert die alte dorische Kirchentonart.
Beispiel 3: O Heiland reiß die Himmel auf
(Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern und Thüringen, Nr. 7)
Den spezifischen Charakter der dorischen sechsten Stufe (6, h) in Beziehung zur ersten Stufe (1, d) würde Handschin mit der Randposition des Tons h in der diatonischen Quintenkette in Verbindung bringen. Einem Charakterunterschied desselben zur lydischen vierten Stufe (4, h) über (1, f) würde Handschin durch das Konzept vom Hinzutreten eines Beicharakters Rechnung tragen. Rings dagegen würde die generischen Stufen 6 bzw. 4 als den Sitz der tonalen Qualia ausmachen. Huron würde die Skalenstufen-Qualia mit den statistischen Profilen dieser Skalenstufen assoziieren, nicht mit den Skalenstufen selbst. Denn Letztere haben bei ihm keine innere Ordnung. Sie sind nicht Zustände eines Konfigurationsraums, sondern eher Ereignisse eines Zufallsprozesses.
Als ferneres Ziel eines transdisziplinären Zugangs steht das Studium der mannigfaltigen Interaktionen zwischen Paradigmen und Syntagmen im Raum.[68] Eine notwendige Voraussetzung dazu ist die Schaffung einer geeigneten Paradigmatik, die an die bereits gemachten Vorschläge anknüpft und sich den damit verbundenen Desiderata stellt.
3. Schritte zur Ausdifferenzierung des Toncharakters
Walter Wioras (1951)[69] Würdigung von Handschins Toncharakter als Beitrag zur Grundlegung einer systematischen Musiktheorie wird zwar Handschins umfassenderem Anliegen nicht vollauf gerecht, verweist aber auf eine substanzielle Komponente seines Ansatzes, die es hier weiter zu verfolgen gilt. Es geht darum, musiktheoretisches Wissen in geeigneter Form an die Diskussion um die tonalen Qualia bzw. Toncharaktere heranzutragen. Konkret wird in diesem Abschnitt die Idee umgesetzt, den Toncharakter als eine die Tonhöhendimension ergänzende zweite (bzw. zweite und dritte) Dimension zu erschließen. Dies beinhaltet die Aufgabe einer musiktheoretischen Klärung des Tonhöhenbegriffs und dessen Einordnung in einen erweiterten Kontext von modalen und harmonisch-tonalen Tonbedeutungen.
Im ersten Abschnitt (3.1) werden die von Handschin und von Rings vorgeschlagenen Parametrisierungen des Toncharakters bzw. der tonalen Qualia als zwei einander ergänzende Aspekte der traditionellen Linien- und Vorzeichennotation herausgearbeitet. Unter 3.2 geht es dann in einem Exkurs um den Begriff der ›Transformation‹ und seine Anwendung auf die Untersuchung paradigmatischer Ton- und Intervallbeziehungen. Die Tatsache nämlich, dass Rings seinen Untersuchungsgegenstand der tonalen Qualia durch das Herstellen einer Verbindung zwischen Elementen der diatonic set theory und der transformational theory zu erfassen trachtet[70], legt den Versuch nahe, diese Denkrichtung weiter zu verfolgen und daraufhin auszuloten, ob sich Handschins Ideen darin vorteilhaft interpretieren und weiterentwickeln lassen. In Unterabschnitt 3.3 werden Transformationen verwendet, um Koordinaten-Darstellungen von Notenintervallen nach Quinten und Quarten in entsprechende Koordinaten-Darstellungen nach Schrittintervallen zu verwandeln. Diese Transformationen konstituieren eine höhere Beschreibungsebene als Rings sie in Betracht zieht und geben im Zuge der weiteren Unterabschnitte besonderen Aufschluss über jene Sachverhalte, denen sich Handschin nur in Andeutungen widmet (nämlich den pseudoklassischen Modi und der durch den Dreiklang geteilten Diatonik mit den zugehörigen Gattungen der Dreiklangsintervalle). Dies wird in den Abschnitten 3.5 und 3.6 behandelt. Zuvor wird in Abschnitt 3.4 die mathematische Grundlage für die Definition des Toncharakters als eines zur Tonhöhe orthogonalen Unterraums des Intervallsystems gelegt.
3.1 Noten und ihre Bedeutungen jenseits der Tonhöhe
Regeners mathematische Analyse der traditionellen musikalischen Liniennotation bildet einen geeigneten Rahmen, um die jeweils von Rings und von Handschin vorgeschlagenen Parametrisierungen der tonalen Qualia bzw. der Toncharaktere zueinander ins Verhältnis zu setzen.
Dabei soll zunächst daran erinnert werden, dass sich die in der Notenschrift erfasste Information über die Tonhöhe aus mehreren Aspekten zusammensetzt. Ein bestimmter Teil dieser Information wird durch die vertikale räumliche Anordnung der Notenlinien vermittelt. Weitere Aspekte ergeben sich aus den Schlüsseln, den Vorzeichen und den Versetzungszeichen. Regener fand heraus, dass man das Zusammenspiel dieser Aspekte durch die Hinzunahme einer zweiten (in der Abbildung horizontalen) Raumdimension sehr gut erfassen kann.
Entlang der vertikalen Achse wird die ›Stufenhöhe‹ gemessen, deren kleinste Einheit bei Regener diatone heißt. Es handelt sich dabei um generische diatonische Intervalle, wie Sekunde, Terz, Quarte etc., nicht jedoch um spezifische Notenintervalle wie kleine Sekunde, große Sekunde usw. Die Ausnahme bildet die Oktave (mit ihren Vielfachen): Das generische Siebenstufenintervall und das Notenintervall der reinen Oktave erscheinen in Regeners Modell als ein und derselbe Vektor. Dem entspricht die Tatsache, dass in der Notation unabhängig von der Wahl des Schlüssels und der Vorzeichen sieben Stufen immer eine reine Oktave bilden (solange kein Versetzungszeichen angebracht wird). Für die Bestimmung aller anderen Intervalle bedarf es zusätzlicher Information etwa über die Lage der Halb- und Ganztonschritte. Alle dabei erforderlichen Differenzierungen lassen sich auf das Intervall der übermäßigen Prime beziehen. Sie ist gleichermaßen die Differenz aus großer und kleiner Sekunde, aus großer und kleiner Terz, aus übermäßiger und reiner Quarte etc., und die elementaren Vorzeichen und Versetzungszeichen # und b verweisen auf die Alteration von Noten und Notenintervallen um übermäßige Primen.
Entlang der horizontalen Achse wird die ›Quintenbreite‹[71] gemessen, deren kleinste Einheit bei Regener quint heißt. Regener besetzt diese zweite Dimension mit der übermäßigen Prime und behandelt sie in strenger Analogie zur reinen Oktave. Er teilt dieses Notenintervall in sieben Segmente der Quintenbreite 1, welche für sich genommen keine Notenintervalle sind. Wie die Stufenhöhe repräsentiert die Quintenbreite einen Teilaspekt von Notenintervallen. Das Notenintervall der reinen Quinte hat die Quintenbreite 1 und die Stufenhöhe 4. Was also ist eine elementare Quintenbreite für sich genommen? Beispiel 4 illustriert die musiktheoretische Bedeutung dieses Begriffs.
Beispiel 4: Acht verschiedene Deutungen der Note h in variierenden Vorzeichnungen bzw. Unterteilung der übermäßigen Prime in sieben Einheiten der Quintenbreite,
bezeichnet bzw. exemplifiziert durch die Tonsilben fa-do-so-re-la-mi-ti-fi
Von links nach rechts wird der Ton h in acht Vorzeichnungen interpretiert: ausgehend von sechs Kreuzen bis hin zu einem b. Wie die als Quintenkette geordneten Tonsilben fa-do-so-re-la-mi-ti-fi verdeutlichen, werden dabei die sieben diatonischen Tonbedeutungen durchwandert. Erst im letzten Schritt wird die Note h von der Vorzeichnung miterfasst, wobei der Stammton b hochalteriert wird zu h. Die Verwandlung des Stammtons h zum Stammton b erscheint als das Ergebnis einer Akkumulation von wachsender ›Verwandlungsbereitschaft‹, die ihm aus der entsprechenden Verwandlung anderer Stufen in Quintordnung zuteilwird. Abstrakt motiviert sich daraus die Unterteilung der übermäßigen Prime in sieben Quintenbreiten.
Die von Steven Rings vorgenommene Parametrisierung der tonalen Qualia entspricht den generischen Skalenstufen und verläuft demnach entlang der vertikalen Dimension in Regeners Modell. Handschins Parametrisierung des Toncharakters verläuft hingegen entlang der horizontalen Achse. Damit ist noch nichts über die Rolle eines Grundtons (1. Skalenstufe bzw. do-Charakter) gesagt. Aber es zeigt sich, dass die von Rings und Handschin jeweils als Träger des musikalischen Erlebnisgehalts von Tönen identifizierten Parameter einander zu derjenigen Information ergänzen, die zur Bestimmung von Tönen im Sinne der musikalischen Notation erforderlich ist.[72]
Abbildung 1: Zweidimensionale Darstellung der Notenintervalle (links) und der Noten (rechts) im Sinne von Regener 1973
Wie Abbildung 1 (links) verdeutlicht, ergibt das aus ganzzahligen Stufenhöhen und Quintenbreiten erzeugte Gitter aus Einheitsquadraten ein diskretes Koordinatensystem, in dem jedes Notenintervall einem Koordinatenpaar (q, s), bestehend aus einer Quintenbreite q und einer Stufenhöhe s entspricht. Die reine Quinte P5 hat zum Beispiel die Koordinaten (1, 4), bestehend aus der Quintenbreite 1 und der Stufenhöhe 4. Die große Sekunde M2 hat die Koordinaten (2, 1), bestehend aus der Quintenbreite 2 und der Stufenhöhe 1.
Offensichtlich entsprechen in diesem Gitter nicht allen kombinatorisch möglichen Koordinatenpaaren umgekehrt auch Notenintervalle. Nur jeder siebte Gitterpunkt der Form (q, s) mit ganzzahligen Koordinaten q und s beschreibt tatsächlich ein Notenintervall. Denn, wie aus der Grafik ersichtlich, entsprechen unter den reinen Stufenhöhen-Intervallen in vertikaler Richtung nur die Oktave und ihre Vielfachen (0, 7 n) tatsächlich Notenintervallen. Unter den reinen Quintenbreiten-Intervallen in horizontaler Richtung sind nur die übermäßige Prime und ihre Vielfachen (7 n, 0) Notenintervalle.[73]
3.2 Exkurs: Transformationen als eine neuere Methode in der Musiktheorie
Verräumlichungen musikalischer Parameter wie in Abbildung 1 können Theoretiker*innen dazu verleiten, den darin erfassten musikalischen Entitäten eine zeitlose Existenz zuzuerkennen. Andere Theoretiker*innen, die solch eine Haltung als ›ontologische Kontemplation‹ über Musik beargwöhnen, können wiederum dazu verleitet werden, in der Untersuchung solcher Räume lediglich eine nutzlose buchhalterische Tätigkeit zu sehen. Die Motivation für den vorliegenden Beitrag ist die Suche nach der Realität des seine eigene geistige Tätigkeit erlebenden Subjekts. Für einen Anlauf, aus dem Wissen der Musiktheorie heraus einen Zugang dazu zu erschließen, bedarf es daher auch einer Ontologie der Tätigkeit und nicht nur der Gegenstände. Eine neuere mathematische Methode, deren sich die Musiktheorie seit einigen Jahrzehnten zunehmend bedient, erlaubt es, den Räumen jene verdächtige Unveränderlichkeit zu nehmen und die darin erfassten musikalischen Entitäten zu erzeugen oder ineinander zu verwandeln: Transformationen.
Der Musiktheoretiker David Lewin publizierte nahezu zeitgleich zwei vielbeachtete Schriften, die man beide als unabhängig voneinander formulierte Annäherungen an eine noch zu entwickelnde Theorie des aktiven musikalischen Subjekts deuten kann: Den Artikel »Music Theory, Phenomenology, and Modes of Perception« aus dem Jahre 1986 und das Buch Generalized Musical Intervals and Transformations aus dem Jahre 1987. Vor dem Hintergrund der konkreten Thematik des vorliegenden Beitrags verdient dieses Nebeneinanderbestehen der beiden Arbeiten besonderes Augenmerk, worauf im Schlussabschnitt noch eingegangen wird. Das Buch, auf welches sich auch Rings (2011) bezieht, gilt heute als ein Standardwerk der als ›transformational theory‹ bezeichneten Strömung innerhalb der neueren Mathematisierungsansätze in der nordamerikanischen Musiktheorie.
Die beiden Bestandteile von Lewins Buchtitel – die »verallgemeinerten Intervalle« und die »Transformationen« – bezeichnen zwei eng miteinander verbundene Modalitäten des Zugriffs auf einen unterliegenden musikalischen Raum, die in Lewins Deutung, der sich auch Rings anschließt, je mit einer bestimmten Semantik belegt werden. Verallgemeinerte Intervalle verkörpern die Möglichkeit des Vermessens von Beziehungen zwischen je zwei Objekten. Transformationen verkörpern Akte des Überführens von Objekten in andere Objekte. Steven Rings formuliert diese semantische Deutung wie folgt:
The theory articulates into two broad perspectives. One is intervallic, in which the subject »measures« the relationship between two musical objects, as a passive observer. The other is transformational, in which the subject actively seeks to recreate a given relationship in his or her hearing, traversing the space in question through an imaginative gesture.[74]
Rings kommt das Verdienst zu, eine Brücke zwischen der transformational theory und Elementen der diatonic set theory geschlagen zu haben, indem er Eytan Agmons (1989) mathematisches Modell der Diatonik als Instanz eines verallgemeinerten Intervallsystems im Sinne Lewins interpretierte. Tragfähige Pfeiler für solch eine Brücke hatte auch Eric Regener (1973) schon mit seinem Mathematisierungsansatz der musikalischen Linien- und Vorzeichennotation angelegt.[75]
Mit der Operation der Intervalladdition verknüpft sich bei Regener zudem die Frage nach der Art und Weise des Gegebenseins von Intervallen. Wie in Abschnitt 3.3 noch genauer ausgeführt wird, genügen nämlich jeweils zwei geeignet gewählte Basisintervalle, um alle anderen Notenintervalle als Summen der beiden Basisintervalle darzustellen. Da wiederum verschiedene Intervalle die Rolle jener Basisintervalle einnehmen können, war schon bei Regener eine Form der Transformation ins Spiel gekommen, welche die Lewin-Tradition später weitgehend aussparte.
Regeners Transformationen des Intervallsystems lassen sich wie folgt charakterisieren: Neben der phänomenologischen Lesart der Attribute ›passiv‹ (für die Rolle von Intervallen) und ›aktiv‹ (für die Rolle von Transformationen) in der Lewin-Schule gibt es in der mathematischen Physik eine anders motivierte Unterscheidung zwischen ›aktiven‹ und ›passiven‹ Transformationen, welche auch für das Verständnis von Regeners Intervalltransformationen relevant ist. Bei aktiven Transformationen werden die Koordinaten eines Objekts geändert mit der Interpretation, dass sich damit seine Position im Raum tatsächlich ändert. Bei passiven Transformationen wird die Änderung der Koordinaten als ein Wechsel des Koordinatensystems gedeutet, ohne dass ein betrachtetes Objekt deswegen seine Position ändert. Die im folgenden Unterabschnitt behandelten ›Regener-Transformationen‹ sind in diesem Sinne passiv.
3.3 Die Regener-Transformationen
Die Ausführungen dieses Abschnitts behandeln Transformationen zwischen zwei verschiedenen Weisen der Intervallbestimmung: Zusammensetzungen aus Quinten und Quarten werden übersetzt in die entsprechenden Zusammensetzungen aus Schrittintervallen. Dies geschieht zunächst ohne Verwendung der in Abschnitt 3.1 eingeführten Koordinaten der Stufenhöhe bzw. der Quintenbreite. Letztere werden unter einem neuen Gesichtspunkt im Abschnitt 3.4 wieder in die Untersuchung einbezogen. Unterdessen geht es darum, beliebige Notenintervalle als Zusammensetzungen aus solchen Notenintervallen zu interpretieren, die man als elementar erachtet, und den Übersetzungsmechanismus zwischen zwei verschiedenen Weisen solcher Zusammensetzungen zu studieren. Als ein erstes Paar elementarer Intervalle fungiert die reine Quinte P5 zusammen mit der reinen Quarte P4. Mathematisch gesprochen bilden sie eine ›Basis‹ des Intervallraums. Auf der linken Seite von Abbildung 2 wird gezeigt, wie die Notenintervalle (siehe dazu auch Abb. 1) im P5/P4-Gitter erfasst werden. Als zweite Basis fungiert das Paar der großen Sekunde M2 und der kleinen Sekunde m2. Auf der rechten Seite von Abbildung 2 werden die Notenintervalle im M2/m2-Gitter gezeigt. Wie Abbildung 2 weiter illustriert, ist jedes Intervall bezüglich jeder der beiden Basen jeweils durch ein Koordinatenpaar gegeben: z.B. die reine Quinte (P5) als (1, 0) in P5/P4-Koordinaten und als (3, 1) in M2/m2-Koordinaten, die große Sekunde (M2) als (1, -1) bzw. (1, 0), die kleine Terz (m3) als (-1, 2) bzw. (1, 1).
Abbildung 2: Koordinatentransformation des Intervallsystems von Quint/Quart-Koordinaten in diatonische Schrittintervall-Koordinaten
Der dicke Pfeil zwischen den beiden Teilgrafiken symbolisiert die zugehörige Koordinatentransformation. Sie soll als ›diatonische Regener-Transformation‹ bezeichnet werden und entspricht dem im vorigen Abschnitt 3.2 erwähnten passiven Transformationstyp. Zwei verschiedene Koordinatendarstellungen derselben Intervalle werden ineinander überführt. Rechnerisch wird diese Transformation mit Hilfe dieser 2x2-Matrix realisiert, deren beide Spalten die Sekundkoordinaten von reiner Quinte und reiner Quarte beinhalten:
Zur Illustration sind die betreffenden Berechnungen für den Koordinatenwechsel anhand der Oktave und der übermäßigen Prime aufgeführt. Dabei werden die Koordinatenpaare als Spaltenvektoren geschrieben und jeweils von links mit der Transformationsmatrix multipliziert. Die Subindizes q bzw. s stehen für ›Quint/Quart-‹ bzw. ›Sekundkoordinaten‹.
Ganz analog kann man eine transformationelle Definition der Chromatik geben, indem man als zweite Basis nicht die diatonischen Schrittintervalle wählt, sondern die chromatischen, d.h. die übermäßige Prime A1 und die kleine Sekunde m2. Bei der Umrechnung der Koordinaten wird die reine Quinte als aus drei übermäßigen Primen und vier kleinen Sekunden zusammengesetzt gedacht, und die Quarte aus zwei übermäßigen Primen und drei kleinen Sekunden. Die zur ›chromatischen Regener-Transformation‹ gehörige Matrix hat also die Gestalt:
Zur Illustration und zum Vergleich mit der diatonischen Regener-Transformation werden auch hier die betreffenden Berechnungen anhand der Oktave und der übermäßigen Prime aufgeführt:
Die Regener-Transformationen lassen sich als Verknüpfungen zweier elementarer Transformationen darstellen, bei denen jeweils nur eine der beiden Koordinaten geändert wird, indem sie durch die Summe beider Koordinaten ersetzt wird. Dahinter steht das Prinzip der ›Wechselwegnahme‹: In der Quint/Quart-Basis wird zunächst die Quinte in ihrer Rolle als Basisintervall durch die Differenz aus Quinte und Quarte ersetzt, d.h. durch die große Sekunde M2 = P5 – P4. Die neue erste Koordinate ist dann die M2-Koordinate und stimmt als Zahl mit der alten Quintkoordinate überein. Dagegen ergibt sich die neue Quartkoordinate als Summe der alten Quart- und der alten Quintkoordinate. Im nächsten Transformationsschritt kann man die Quarte ersetzen durch die kleine Terz (als Differenz aus Quarte und großer Sekunde). Dabei wird das zweite Basis-Intervall ersetzt. Schließlich kann man die kleine Terz ersetzen durch die kleine Sekunde (als Differenz aus kleiner Terz und großer Sekunde) und erhält so nach drei elementaren Transformationen die diatonische Schrittintervallbasis M2/m2. Nach einem weiteren Transformationsschritt, der Ersetzung der großen Sekunde M2 durch die übermäßige Prime A1 = M2 – m2, ergibt sich die chromatische Schrittintervallbasis A1/m2. Als Transformationsmatrizen dieser elementaren Transformationen fungieren die beiden Dreiecksmatrizen R und L:[76]
Anders gesagt, diese Transformationen lassen jeweils ein Basisintervall unverändert und zerlegen das jeweils andere in eine Summe aus dem ersten und einem Rest, welcher dabei zum Basisintervall wird. Das nachstehende Diagramm (Abb. 3) zeigt die entsprechende Zerlegung der chromatischen Regener-Transformation in vier elementare Transformationen. Als Zwischenstation erhält man jeweils die Zusammensetzung von Quinte und von Quarte aus den Schrittintervallen eines bestimmten Skalentyps:[77] Ganz links sind beide Intervalle selbst elementar, was der authentischen (oder plagalen) Teilung der Oktave als ›essenzielle‹ Skala enspricht (z.B. c-g-c’). Dann folgen die Schrittintervalle M2 und P4 der ›strukturellen‹ Skala[78] (z.B. c-f-g-c’), weiter die Schrittintervalle M2 und m3 der pentatonischen Skala (z.B. c-d-f-g-a-c’) und die Schrittintervalle M2 und m2 der diatonischen Skala. Das Paar ganz rechts im Diagramm repräsentiert schließlich die Ausfüllung der Quinte mit drei kleinen Sekunden und vier übermäßigen Primen, sowie die der Quarte mit zwei kleinen Sekunden und drei übermäßigen Primen (chromatische Skala).
Abbildung 3: Transformationelles Netzwerk von Koordinatendarstellungen der Intervalle Quinte und Quarte nach
essenziellen, strukturellen, pentatonischen, diatonischen und chromatischen Schrittintervallen
Diagramme wie das in Abbildung 3 wiedergegebene nennt man in der Lewin-Tradition ›transformationelle Netzwerke‹. Im vorliegenden Fall sind dessen Knoten jeweils Koordinatendarstellungen von Quinte und Quarte bezüglich variierender Basen des Intervallsystems. So ergibt sich die diatonische Regener-Transformation als Verknüpfung RRL, die chromatische als Verknüpfung LRRL.[79]
Wie oben ausgeführt und in Abbildung 1 illustriert wurde, lässt sich die Struktur des Intervallsystems auf das Notensystem übertragen, indem man eine willkürlich gewählte Note als Referenzpunkt bestimmt und mit der reinen Prime P1 identifiziert. Auf diese Weise lassen sich die Regener-Transformationen im Notensystem abbilden. Die Referenznote hat dann die Quint/Quart-Koordinaten (0, 0)q und entsprechend auch die Sekundkoordinaten (0, 0)s. Auf eine detaillierte Ausarbeitung dieser Übertragung wird hier verzichtet. Für das spätere Verständnis der modalen und harmonisch-tonalen Ausdifferenzierungen dieser Transformationen ist es allerdings wichtig, die formale Trennung von Noten und Intervallen im Auge zu behalten.
Dieser Abschnitt hat folgende Resultate erbracht. (1) Die Zweidimensionalität des Raums der Notenintervalle (bzw. der Noten) kann durch die Wahl zweier elementarer Intervalle begründet werden, aus denen alle anderen zusammengesetzt werden können. (2) Geeignete Regener-Transformationen können die jeweiligen Koordinatendarstellungen ineinander übersetzen. (3) Mit Hilfe des Prinzips der Wechselwegnahme lassen sich bestimmte[80] Regener-Transformationen als Verkettungen zweier elementarer Transformationen darstellen: R und L. Nimmt man die Quint/Quart-Basis zum Ausgangspunkt, ergibt sich dabei eine Hierarchie von sukzessiven Verfeinerungen des Ausfüllens dieser beiden Intervalle durch Schrittintervalle. (4) Als eine Position in dieser Hierarchie wird auch die Basis der diatonischen Schrittintervalle M2 und m2 ermittelt.
Die beiden mit den tonalen Qualia und Toncharakteren in Verbindung gebrachten Dimensionen der Stufenhöhe und der Quintenbreite wurden in diesen Untersuchungen ausgeklammert und können nun unter neuen Gesichtspunkten wieder ins Spiel gebracht werden.
3.4 Stufenhöhe, Tonhöhe, Eigenhöhe und ihre assoziierten Breitenformen
Die Quintenbreite eines Intervalls lässt sich sehr einfach aus den Quint- und Quartkoordinaten ermitteln, sie ist nämlich deren Differenz. Die Stufenhöhe eines Intervalls ergibt sich als Summe aus seinen großen Sekund- und kleinen Sekundkoordinaten. In beiden Fällen werden die Koordinaten eines Intervalls in linearer Weise zu einer Zahl kombiniert. Solche Zuordnungen nennt man ›Linearformen‹. Mithilfe der Regener-Transformationen kann die Stufenhöhe auch aus den Quint- und Quartkoordinaten abgeleitet werden: Man muss zu diesem Zweck das Vierfache der Quint-Koordinate zum Dreifachen der Quart-Koordinate addieren, insofern jede einzelne Quinte vier und jede Quarte drei Stufen umfasst. Auch der Begriff der ›Tonhöhe‹ kann als solch eine Linearform verstanden werden. Dabei wird jedem Notenintervall eine reelle Zahl als Tonhöhenintervall zugeordnet. Die Linearitätseigenschaft besagt, dass Summen oder Vielfachen von Notenintervallen entsprechend die Summen oder Vielfachen der zugehörigen Tonhöhenintervalle zugeordnet werden. Um eine Tonhöhen-Linearform zu definieren genügt es folglich, das Tonhöhenintervall der Quinte und der Quarte festzulegen und die Tonhöhenintervalle aller anderen Notenintervalle durch lineare Extrapolation zu bestimmen gemäß ihrer Zusammensetzung aus Quinten und Quarten.
Ein solcher Tonhöhenbegriff erbt aus theoretischen Erwägungen die lineare Struktur des Systems der Notenintervalle und ist kein vorrangig psychoakustisch motivierter Begriff.[81]
Als duales Gegenstück[82] zur Tätigkeit des Übersetzens von Intervallzerlegungen nach Quinten und Quarten in solche nach Schrittintervallen kommt mit jedem spezifischen Tonhöhenbegriff für Intervalle eine entsprechende Übersetzung seiner auf die Schrittkoordinaten abgestimmten Linearform in deren auf Quint/Quart-Koordinaten abgestimmtes Gegenstück ins Spiel. Für dieses Ineinander-Übersetzen der Linearformen ist die ›duale diatonische Regener-Transformation‹ zuständig (Abb. 4).
Abbildung 4: Duale diatonische Regener-Transformation.
Die Linearform der Stufenhöhe entspricht in M2/m2-Koordinaten einem
Skalarprodukt mit dem Vektor (1, 1). In P5/P4-Koordinaten entspricht sie einem Skalarprodukt mit dem Vektor (4, 3). Die duale Regener-Transformation bildet den Vektor (1, 1) auf den Vektor (4, 3) ab. Ebenso leistet sie diese Übersetzung für jede andere Linearform.
Sie entspricht der transponierten Transformationsmatrix und hat die Berechnungsvorschrift:[83]
Im nächsten Schritt wird nach einem Höhenbegriff gesucht, welcher nicht von außen – durch die Psychoakustik – an die Musiktheorie herangetragen wird, sondern welcher sich zwanglos aus der Regener-Transformation ergibt. Der Gesichtspunkt, unter dem diese Suche vorgenommen wird, ist die ›Einfachheit‹. Der Raum der Linearformen ist – wie das unterliegende Intervallsystem – zweidimensional, und folglich drücken die vier Koeffizienten der Transformationsmatrix die gemischte Abhängigkeit der Bildkoordinaten von beiden Ausgangskoordinaten ab. Im Allgemeinen ändern die Vektoren (h1, h2) dabei im Zuge der Transformation ihre Länge und ihre Richtung. Allerdings existiert auch der interessante Sonderfall, dass ein Vektor nur seine Länge, nicht aber seine Richtung ändert. Man nennt solch einen Vektor einen ›Eigenvektor‹ der betreffenden Transformation und den Faktor der Längenänderung nennt man den zugehörigen ›Eigenwert‹. Für die spezifischen Größen der Quinten und Quarten bzw. der Schrittintervalle bedeutet eine solche Konstellation, dass sie untereinander dasselbe Größenverhältnis besitzen müssen.
Es soll zuerst der Eigenvektor im Fall der diatonischen Regener-Transformation betrachtet werden. Wenn man durchweg positive spezifische Intervallgrößen ins Auge fasst und infolgedessen die Schrittintervalle kleiner als bei Quinte und Quarte ausfallen müssen, kommt nur ein Eigenwert in Frage, der größer als 1 ist, und zwar:
Folgt man der Konvention, die spezifische Größe der Oktave mit dem Wert 1 zu normieren, dann hat man die spezifischen Größen für Quinte und Quarte so zu wählen, dass diese sich zum Wert 1 ergänzen. Der passende Eigenvektor der dualen diatonischen Regener-Transformation ist dann:[84]
Für die chromatische Regener-Transformation fällt die Abweichung der Quinte frappierend gering aus. Die ›intrinsische chromatische Quinte‹ ist in diesem Fall nur um ein knappes Cent größer als die pythagoreische:
Eine Überlegung dahingehend, dass sich innere Tonvorstellungen anderer Intervallgrößen bedienen könnten als sie von der Akustik nahegelegt werden, wurde anhand genau dieses Zahlenvergleichs von Johann Friedrich Herbart im Rahmen seiner Vorstellungsmechanik angestellt und als Argument für den Nachweis ihrer Plausibilität angeführt.[85] Die Größendifferenz aus den beiden Bestimmungen der Quinte könnte man deshalb als das ›Herbart’sche Komma‹ bezeichnen.[86] Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen ist zunächst nur die Feststellung von Interesse, dass die Regener-Transformationen jeweils einen eigenen Tonhöhenbegriff mit sich bringen.
Abbildung 5: Linearform der Tonhöhe, repräsentiert mittels einer Geraden durch den Ursprung, deren Anstieg das Tonhöhenverhältnis aus Quinte und Quarte entspricht;
Tonbreite, repräsentiert mittels der dazu orthogonalen Geraden durch den Ursprung
Wie in Abbildung 5 illustriert wird, kann man eine Linearform bezüglich einer gegebenen Basis mit jenem Vektor v identifizieren, dessen Koordinaten die beiden Werte sind, die die Basisvektoren unter der Linearform annehmen. Die Richtung[87] dieses Vektors definiert wiederum eine Gerade g, welche mit geeignet normierten Koordinaten versehen werden kann, die die Werte der Linearform parametrisieren. Alle Punkte der Ebene, die jeweils einen bestimmten Wert annehmen, liegen dann entlang derjenigen orthogonal zu g verlaufenden Geraden, welche g in dem diesen Wert repräsentierenden Punkt schneidet. Durch den Ursprung des zweidimensionalen Intervallraums verläuft orthogonal zu g eine Gerade, welche dem Wert 0 der Linearform entspricht. In der Mathematik spricht man vom ›Kern‹ der Linearform.[88] Im Falle der Stufenhöhe entspricht dieser Kern genau der von der übermäßigen Prime A1 aufgespannten Koordinatenachse der Quintenbreite. Und umgekehrt ist der Kern der Quintenbreite die von der reinen Oktave P8 aufgespannte Koordinatenachse der Stufenhöhe.
Auch zur Linearform der Tonhöhe gibt es einen zur Tonhöhengeraden orthogonal verlaufenden eindimensionalen Unterraum, welcher als zweite Achse eines Koordinatensystems eingeführt werden kann. Dieser Parameter wird als ›Tonbreite‹ bezeichnet.[89] Die Quintenbreite ist als ein Spezialfall der Tonbreite aufzufassen. Im Zuge der Ausdifferenzierung von Handschins Ideen ist von besonderem Interesse, dass mit der Tonbreite eine Formalisierung des Toncharakters vorliegt, die keine Begrenzung des Tonsystems erfordert.
In Abbildung 5 wird auch gezeigt, wie die Tonbreitenachse durch ein potenziell bis ins Unendliche ausgedehntes Zickzack aus Quinten und Quarten approximiert wird. Wenn man den Tonhöhenvektor modifiziert, gilt Folgendes: Je kleiner die Abänderung der Tonhöhenintervalle für Quinte und Quarte ausfällt, desto weiter entfernt sind die damit verbundenen Änderungen im Zickzack-Muster vom Koordinaten-Ursprung. Eine weitere Differenzierung ergibt sich hinsichtlich der Tonbreiten-Koordinaten. Während die steigende Quinte P5 und die fallende Quarte P4 dieselbe Quintenbreite 1 haben, weichen ihre Tonbreiten voneinander ab. Verschiedene Zickzack-Muster aus Quinten und Quarten ergeben dann auch bei Projektion auf die Tonbreitenachse verschiede Koordinaten entlang dieser Achse.[90] Entsprechendes gilt für die Linearformen der diatonischen bzw. chromatischen Eigenhöhe. Abbildung 5 eignet sich gleichermaßen zur Darstellung der chromatischen Eigenhöhe und Eigenbreite.
Daraus ergeben sich zwei wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der mathematischen Präzisierung des Toncharakters. (1) Zu jeder Definition der Tonhöhe als Linearform gibt es (bis auf Normierung) eine assoziierte Linearform der Tonbreite. Handschins Vorstellung von einer gegenseitigen Durchkreuzung von Tonhöhe und Toncharakter wird dabei in geeigneter Weise auf den Punkt gebracht. Das Resultat aus Abschnitt 3.1 (die Darstellung von Notenintervallen mithilfe der Stufenhöhe und der dazu orthogonalen Quintenbreite) wird als Spezialfall von dieser Definition mit abgedeckt. (2) Als zweiter und neuer Spezialfall kommt die Eigenhöhe ins Spiel. Sie konkurriert mit dem linearen Tonhöhenbegriff, insofern sie diesen überraschend gut approximieren kann und sich aber zugleich zwanglos aus der Regener-Transformation ergibt, die ihrerseits die Struktur des Tonsystems verkörpert. Damit ist die zweite Komponente in Handschins Ansatz erfasst, welche den Toncharakter aus der Position eines Tons im Tonsystem zu erklären trachtet.
3.5 Intervallgattungen – die modalen Ausdifferenzierungen von Notenintervallen
Nach Handschins Auffassung ergibt sich die modale Bedeutung eines Tons aus der Überlagerung des Toncharakters mit einem Beicharakter. Der nun vorgestellte mathematische Zugang zum Modusbegriff[91] stellt sich der theoretischen Herausforderung hinter Dahlhaus’ Kritik dieser Auffassung. Es geht darum zu zeigen, dass eine konkrete mathematische Realisierung des Begriffs der ›Überlagerung‹ dem Gegenstand eine angemessene Modellierung zuteilwerden lässt: Die Schrittkoordinaten oder Quint/Quart-Koordinaten von Intervallen, deren Addition kommutativ ist, werden überlagert von einer verfeinerten Intervallauffassung, deren Addition nicht kommutativ ist. Am Anfang steht dabei die Ausdifferenzierung des Begriffs ›Intervall‹ mit dem Begriff der ›Intervallgattung‹, wobei konkret auf Quint- und Quartgattungen Bezug genommen wird. Darauf werden entsprechende Gattungstransformationen, d.h. Ausdifferenzierungen der Regener-Transformationen vorgestellt. Sodann geht es um die Ausdifferenzierung des Begriffs der ›Note‹ mit dem Begriff des ›modalen Pfads‹, und schließlich um die Übertragung von Gattungstransformationen auf den Raum der modalen Pfade. Der Bezug dieser Agenda zum Toncharakter ist folgender: In Abbildung 5 wird die Achse der Tonbreite von einem Zickzack aus Quinten und Quarten digitalisiert; es geht nun darum, die Kombinatorik dieser Muster genauer zu verstehen und im Kontext der modalen Theorie zu interpretieren.
Den musiktheoretisch vertrauten Ausgangspunkt der Mathematisierung bilden die Quint-, Quart- und Oktavgattungen der pseudoklassischen mittelalterlichen Moduslehre, sowie deren neuzeitliche Ausweitung vom 8-Modus zum 12-Modus-System.[92] Die Untersuchung richtet sich damit auf die paradigmatische Seite modaler Tonbeziehungen und stellt syntagmatische Aspekte – wie etwa die Konstitution melodischer Formeln – zurück. Die Repräsentation (3, 1)s der Quinte P5 in diatonischen Sekundkoordinaten enthält die Information, dass dieses Intervall aus drei großen und einer kleinen Sekunde zusammengesetzt ist. In den Quintgattungen wird darüber hinaus jeweils eine konkrete Reihenfolge dieser vier Schrittintervalle realisiert. Wörter aus zwei Buchstaben sind geeignet, um diese Gattungen zu repräsentieren: aaba, abaa, baaa, aaab. Jedem Wort w aus den beiden Buchstaben a und b kann man ein Zahlenpaar zuordnen, welches die jeweilige Vielfachheit von a und von b in w wiedergibt. Dabei entspricht die Operation des Verkettens von Wörtern der Addition der betreffenden Zahlenpaare. Die Verkettung der dorischen Quintgattung abaa mit der dorischen Quartgattung aba zur dorischen Oktavgattung abaaaba entspricht der Addition (3, 1)s + (2, 1)s = (5, 2)s.
Der kombinatorische Spielraum der Wörter und Wortverkettungen ist dabei viel größer und damit beliebiger als bei den pseudoklassischen Modi. Auch die Verkettung der phrygischen Quintgattung baaa mit der ionischen Quartgattung aab zum Wort baaaaab entspricht dieser Addition, obwohl sie keine diatonische Oktavgattung ergibt. Die Menge aller Wörter aus zwei Buchstaben überlagert die Menge aller geordneten Paare natürlicher Zahlen, und die Verkettung der Wörter entspricht dabei der Addition der Zahlenpaare.[93] Angesichts dieser kombinatorischen Freiheit ist es umso überraschender, dass die mathematisch natürlichen[94] Ausdifferenzierungen der Regener-Transformationen die Struktur der pseudoklassichen Modi adäquat erfassen. In der mathematischen Spezialdisziplin der algebraischen Kombinatorik auf Wörtern[95] werden sie als ›spezielle Sturm’sche Morphismen‹ bezeichnet. Hier sollen sie als ›Gattungstransformationen‹ bezeichnet werden.
Die Regener-Transformationen überführen Koordinatenpaare in Koordinatenpaare. Entsprechend überführen Gattungstransformationen Wörter in Wörter. Dabei handelt es sich um Substitutionen f, die – wie bei der ›Suche und Ersetze‹-Funktion eines Texteditors – alle Instanzen des Buchstaben a durch ein bestimmtes Wort f(a) und alle Instanzen des Buchstaben b durch ein bestimmtes Wort f(b) ersetzen. Für die Wahl dieser beiden Wörter f(a) und f(b) gibt es aus algebraischen Gründen nur einen engen Spielraum. Jede der beiden elementaren Regener-Transformationen R und L (siehe Abschnitt 3.3) wird dabei von zwei Gattungstransformationen überlagert.
Abbildung 6: Überlagerung der elementaren Regener-Transformationen R und L durch jeweils zwei Gattungstransformationen
Die Transformationen G und G~ lassen den Buchstaben a unangetastet und substituieren den Buchstaben b durch ab bzw. ba. Die Transformationen D und D~ lassen hingegen den Buchstaben b unangetastet und substituieren den Buchstaben a durch ba bzw. ab. Das Diagramm in Abbildung 7 ist ein transformationelles Netzwerk von Gattungen der Quinte, der Quarte und der aus beiden zusammengesetzten Oktave.
Abbildung 7: Transformationelles Netzwerk von Gattungen der Quinte und Quarte sowie der Oktave nach
essenziellen, strukturellen, pentatonischen, diatonischen und chromatischen Schrittintervallen
Das Symbol (a, b) im Zentrum des Diagramms steht für die authentische Teilung der Oktave in Quinte und Quarte als essenzieller Modus. Darauf folgen von innen nach außen die beiden strukturellen Ausfüllungen desselben, d.h. die Gerüstskalen (ba,b) und (ab,b) aus einer großen Sekunde a und zwei Quarten b. Darauf folgen die vier authentischen pentatonischen Modi, die sechs authentischen diatonischen und die elf authentischen chromatischen Modi. Die Pfeile von innen nach außen repräsentieren jeweils eine der vier Gattungstransformationen G, G~, D und D~. Die jeweils kreisförmig angeordneten gebogenen Pfeile sind ›Konjugationen‹; dies sind Transformationen zwischen den authentischen Modi desselben Typs.
Auf der Ebene der Intervallgattungen besteht eine algebraisch fundierte Dualität zwischen den in Abbildung 7 gezeigten Quint- und Quartgattungen und entsprechenden ›Schrittintervall-Gattungen‹[96]. Bei Letzteren handelt es sich um in b-Richtung orientierte Quint/Quart-Faltungen der jeweiligen Schrittintervalle, und sie sind damit die modalen Ausdifferenzierungen von in Quint/Quart-Koordinaten repräsentierten Schritt-Intervallen. Abbildung 8 illustriert diese Dualität am Beispiel der sechs authentisch geteilten diatonischen Modi. Jedem Paar von aufeinander abgestimmten Quint- und Quartgattungen entspricht ein dazu passendes Paar von Gattungen der fallenden großen und der steigenden kleinen Sekunde. Letztere sind in Abbildung 8 als Wörter in den Buchstaben x und y kodiert.
Abbildung 8: Die sechs authentischen Modi Lydisch, Ionisch, Mixolydisch, Dorisch, Äolisch und Phrygisch, exemplifiziert von oben nach unten als ›Tropoi‹ innerhalb desselben Oktavrahmens. Unter der jeweiligen Oktavgattung ist die zugehörige Quint/Quart-Faltung der den Tropos begrenzenden übermäßigen Prime in b-Richtung gezeigt. Die Nummerierung der Gattungs-Transformationen f1, …, f6 folgt Zarlinos hexachordaler Anordnung der Glarean’schen Modi.[97]
Ebenso wie die Verknüpfung der zueinander passenden Quint- und Quartgattungen jeweils eine diatonische Oktavgattung ergibt, so ergänzen sich die dualen Gattungen der in b-Richtung orientierten Sekunden (d.h. der fallenden großen Sekunde und der steigenden kleinen Sekunde) jeweils zu einer der sechs Gattungen der in b-Richtung orientierten übermäßigen Prime. Um diese Faltungen wiederum als Wörter mit den beiden Buchstaben x und y schreiben zu können und um die diese erzeugenden Gattungstransformationen wiederum mit den elementaren Substitutionen G, G~, D und D~ ausdrücken zu können, wird in Abbildung 8 die fallende Quinte mit x und die steigende Quarte mit y bezeichnet. Anstelle der inversen Regener-Transformation (RRL)-1 muss dann entsprechend die Transformation LRR verwendet werden:
Die dualen Gattungen der Sekunden werden von sechs verschiedenen Überlagerungen von LRR erzeugt. Die Dualität kann man anhand der Zerlegungen in die vier elementaren Transformationen G, G~, D und D~ direkt ablesen: Die Reihenfolge der Buchstaben GGD wird gespiegelt zu DGG und an die Stelle der elementaren Substitutionen D tritt jeweils D~ und umgekehrt.
Die in Abbildung 8 gezeigten Noten können zunächst nur der Illustration dienen, denn sie sind von den Gattungstransformationen noch nicht erfasst, da Letztere sich nur auf Intervallgattungen beziehen. Um Noten nun in den transformationellen Ansatz einzubeziehen, betrachtet man für jede Gattungstransformation eine davon induzierte Transformation auf Gitterpfaden, welche die Regener-Transformationen auf Noten verfeinert. Abbildung 9 illustriert den Akt der Ausfüllung einer Quinte und einer Quarte mit den dorischen Quint- und Quartgattungen. Der Pfeil zwischen den Gitterpfaden entspricht dem dicken Pfeil in Abbildung 2, wenn man die dort schiefwinklig und mit Vektoren verschiedener Länge dargestellten Quint/Quart-Gitter und Sekundgitter beide auf eine rechtwinklige Einheitsgröße bringt.
Abbildung 9: Dorische Pfad-Transformation. Jedes Quintsegment und jedes Quartsegment des Quint/Quart-Gitters werden durch die angegebenen Pfade des Sekundgitters ersetzt. Damit wird auch jedem Gitterpfad im Quint/Quart-Gitter ein entsprechender Pfad im Sekundgitter zugewiesen.
Von besonderem Interesse ist nun die geometrische Betrachtung der Quint/Quart-Faltungen im Zusammenhang mit der musiktheoretischen Interpretation der Eigenbreite, d.h. des Eigenunterraums der Regener-Transformation zum kleineren der beiden Eigenwerte als Charakterraum. Sie führt auf einen interessanten Lösungsvorschlag für das Problem des Beicharakters. Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, ergibt sich die Faltung des äolischen Modus in b-Richtung durch Verknüpfung der Gattung yx des fallenden Ganztonschritts mit der Gattung yyxyx des steigenden Halbtonschritts. In Abbildung 10 werden beide Verknüpfungen dieser Gattungen durch Gitterpfade dargestellt. Die links dargestellte Verknüpfung – man könnte sie die authentische Teilung[98] der übermäßigen Prime nennen – berührt die Finalis c als tiefsten Ton, welcher hier zugleich als Teiler auftritt. Die rechts dargestellte plagale Verknüpfung berührt die obere Oktave c’ als höchsten Ton, und hat den Ton es zum Teiler. Beide Gitterpfade kann man als ›Digitalisierungen‹ des schräg durch das Gitter verlaufenden Charakterraums durch den Ton c ansehen. Sie unterscheiden sich darin, dass der authentische Pfad den Charakterraum berührt, während es der plagale nicht tut. Beide Gitterpfade werden orthogonal zur Eigenhöhe auf dasselbe Segment des Charakterraums projiziert. Wenn man mit Handschin die Quintenbreite als den Toncharakter im eigentlichen Sinne ansehen will, so kann man das für den Modus charakteristische Muster aus Quint- und Quart-Eigenbreiten als Manifestation des modalen Beicharakters ansehen.
Als Konsequenz der Vertauschung der beiden Sekundgattungen entstehen zwei Partitionierungen dieses Segments, die aus denselben Teilsegmenten in vertauschter Anordnung bestehen. Dieser Umstand gibt Anlass zur Definition eines dynamischen Systems[99] auf dem Gesamtsegment, welches die beiden korrespondierenden Teilsegmente jeweils auf einander abbildet. Der Teiler es bildet eine Ambiguität, da er beiden Segmenten angehört. Die bei c’ beginnende Trajektorie bildet die fallende Schrittordnung des Modus c’-b-as-g-f-es-d (oder des)-c mit der Ambiguität bei es.
Abbildung 10: Darstellung der authentischen und plagalen Faltungen des äolischen Modus über c als Gitterpfade sowie als Projektionen auf den Charakterraum der Eigenbreite
Die roten Pfeile repräsentieren die Eigenhöhe. Die blauen bzw. ockerfarbenen Parallelogramme zeigen den Fluss des dynamischen Systems.
3.6 Die Ausfüllung des Dreiklangs als Transformation
Die in Abschnitt 2 besprochenen neueren Ansätze zur Untersuchung von Skalenstufen-Qualia konzentrieren sich von vornherein auf den Kontext der harmonischen Tonalität. Im Zusammenhang mit dem hier verfolgten transformationellen Ansatz steht damit die bereits in Abschnitt 1.2 angesprochene Herausforderung im Raum, eine adäquate Modellierung der dreiklangsbezogenen Diatonik zu entwickeln und deren Beziehung zu der in Abschnitt 3.5 skizzierten modalen Theorie darzulegen. Die Klärung der beiden Bedeutungen des Beicharakters nach Handschin ist verquickt mit dem Problem, die verschiedenen theoretischen Manifestationen der Diatonik ins Verhältnis zu setzen zu den diachronen und synchronen Manifestationen musikalischer Sachverhalte, die man damit zu erfassen trachtete bzw. noch immer trachtet. Innerhalb der Theorie stellt sich dabei die Aufgabe, die historisch voneinander entfernten Ideen zu den pseudo-klassischen Modi einerseits und zu den dreiklangsbasierten Ableitungen von Tonbeziehungen andererseits auf logische Abhängigkeiten hin zu verstehen. Einen substanziellen Beitrag zur Lösung dieser Aufgabe hat Clampitt (1997) mit seinen Untersuchungen zu den ›paarweise wohlgeformten Skalen‹ geleistet. Eine an die modale Theorie von Abschnitt 3.5 anknüpfende Ausdifferenzierung dieser Resultate haben Clampitt und der Verfasser in einem aktuellen Konferenzbeitrag vorgelegt.[100] Auf die Inhalte dieser Untersuchungen kann aus Platzgründen zwar nicht eingegangen werden, aber es werden im Folgenden Konsequenzen benannt, die sich daraus ergeben. Die Kernidee besteht darin, die komplexere dreiklangsbasierte Diatonik als ein Gefüge dreier wohlgeformter Modi (im Sinne der im vorigen Abschnitt skizzierten Theorie) zu verstehen.
Parallel zum Fortbestehen einer an der Notation orientierten Musiktheorie begann man spätestens seit dem 19. Jahrhundert, die konsonanten Dreiklänge als die elementaren Bausteine für die Kombinatorik von Tonbeziehungen zu erachten. Das aus den Dreiklangsintervallen aufgespannte Tonnetz wurde zum Navigationsinstrument der Harmonielehre. Dies geschah allerdings um den Preis, dass die diatonische Skala zu einer akzidentellen Struktur degradiert wurde.
Unter einem transformationellen Gesichtspunkt soll daher im Folgenden zunächst ein isolierter Dreiklang als eine triadische Teilung der Oktave betrachtet werden und im Anschluss daran die Skala als Ergebnis eines Ausfüllens der Dreiklangsintervalle mit Schrittintervallen. Dies steht im Einklang sowohl mit einigen von empirischen Daten gestützten hierarchischen Modellen der Musikkognition[101] als auch mit dem Diminutionsbegriff der Schenker-Tradition.
Unter dem hier verfolgten transformationellen Gesichtspunkt bringt es das Vorhandensein dreier Gerüstintervalle (große Terz M3, kleine Terz m3 und reine Quarte P4) mit sich, dass die bislang in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 verfolgte Agenda nun mit drei anstelle von zwei Dimensionen umgesetzt werden muss. Gesucht ist nämlich eine Transformation, welche die Gerüstintervalle mit entsprechenden Schrittintervallen ausfüllt. Das Differenzintervall aus reiner Quarte und kleiner Terz und das Differenzintervall aus reiner Quinte (der Summe aus großer und kleiner Terz) und reiner Quarte sind aufgrund dieser verschiedenen Ableitungen als zu unterscheidende Manifestationen der großen Sekunde zu behandeln. Als drittes Schrittintervall fungiert die kleine Sekunde als Differenz aus Quarte und großer Terz.[102]
Wurden die Intervallgattungen im vorigen Abschnitt als Wörter mit zwei Buchstaben kodiert, so sind nun Wörter mit drei Buchstaben a, b und c erforderlich. Die folgende Substitution f beschreibt die Ausfüllung der triadischen Oktavteilung in der Form von Gattungen der großen Terz a, der kleinen Terz b und der reinen Quarte c. Die Buchstaben wandeln unter der Transformation ihre Bedeutung. Nach der Transformation steht a für den kleinen Ganzton, b für den Halbton und c für den großen Ganzton. Die große Terz wird durch den großen und kleinen Ganzton ausgefüllt, die kleine Terz durch den Halbton und den großen Ganzton und die reine Quarte durch den kleinen und großen Ganzton sowie den Halbton.
Nun gilt es, die in den vorigen Abschnitten im zweidimensionalen Intervallraum erläuterten Bildungen im dreidimensionalen Raum zu explizieren.
Die Substitution f ist eine Gattungstransformation und damit die Ausdifferenzierung einer linearen Transformation im dreidimensionalen Intervallsystem. An die Stelle der 2x2-Matrix der diatonischen Regener-Transformation, welche Quint/Quart-Koordinaten in diatonische Schrittkoordinaten umrechnet (siehe Abschnitt 3.3) tritt nun eine 3x3-Matrix, welche Großterz/Kleinterz/Quart-Koordinaten in die entsprechenden Sekundkoordinaten umrechnet:
Diese Matrix ist symmetrisch und repräsentiert damit auch die duale Transformation auf dem Raum der Linearformen. Analog zum Abschnitt 3.4 kann man Linearformen der Stufenhöhe, der Tonhöhe und der Eigenhöhe betrachten und deren Koordinaten mithilfe der Matrix Mf aus Schrittkoordinaten in triadische Koordinaten transformieren. Die Situation unterscheidet sich jedoch bei der Behandlung der Nullräume. Das orthogonale Komplement des betreffenden Höhenvektors – der Kandidat für eine geometrische Parametrisierung des Toncharakters – ist im dreidimensionalen Raum keine Gerade, sondern jeweils eine Ebene.
Im Folgenden soll es sogleich um den interessanten Fall der Eigenhöhe gehen und den zugehörigen Nullraum, welcher als ›Charakter‹-Ebene bezeichnet wird. Die Matrix Mf hat die drei Eigenwerte
Ihre Eigenvektoren stimmen mit denen der dualen Abbildung überein und stehen paarweise orthogonal zueinander:
Der Eigenvektor v repräsentiert in beiden Basen die ›harmonische‹ übermäßige Prime, d.h. die Differenz aus großer und kleiner Terz, bzw. die Differenz aus kleinem Ganzton und Halbton. Diese Übereinstimmung wird durch den Eigenwert 1 zum Ausdruck gebracht. Der Eigenvektor u gehört zum größten Eigenwert und definiert damit die Eigenhöhe dieser Transformation. Überraschenderweise stimmt die Quart-Koordinate dieses Vektors erneut mit Herbarts Quarte 0,414214… überein. Die beiden Terzkoordinaten sind gleich groß und summieren sich zu Herbarts Quinte 0,585786…
Die von der Substitution f auf einem dreidimensionalen Tongitter induzierte Pfad-Transformation wird in Abbildung 11 dargestellt.
Abbildung 11: Gitterpfad-Transformation, induziert durch die Transformation f auf Wörtern in den Buchstaben a, b und c. Links werden die Bilder der drei im Koordinatenursprung beginnenden Gittersegmente gezeigt. Jeder Gitterpfad in dem von großen und kleinen Terzen sowie Quarten aufgespannten dreidimensionalen Tongitter wird in einen entsprechenden Gitterpfad aus großen und kleinen Ganztönen sowie Halbtönen transformiert. Rechts wird beispielsweise die Dur-Tonleiter als das Bild der triadischen Teilung der Oktave gezeigt.
Die bei den pseudoklassischen Modi beschriebene und in Abbildung 8 illustrierte Dualität zwischen den Schrittintervallmustern und den Quint/Quart-Faltungen lässt sich in dieser Form insofern nicht auf die dreidimensionale Situation übertragen, als die ›Charakter‹-Ebene zweidimensional ist. Während also in Abbildung 10 die der Eigenbreite korrespondierende Linie durch horizontale und vertikale Gittersegmente ›digitalisiert‹ wird, bedarf es nun für die entsprechende ›Digitalisierung‹ der von v und w aufgespannten Fläche einer zweidimensionalen Entsprechung dieser eindimensionalen Gittersegmente. Dies geschieht mit Hilfe einer Kollektion von Einheitsquadraten eines dreidimensionalen Gitters, die aus der dualen Gitterpfad-Transformation konstruiert werden. Ihre Definition soll hier nicht mathematisch formal, sondern anhand ihrer musiktheoretischen Bedeutung erklärt werden.[103]
Die duale Gitterpfad-Transformation (Abb. 12) kehrt gegenüber der originalen Gitterpfad-Transformation aus Abbildung 11 die Abbildungsrichtung um. Während Letztere jedem Pfad aus Dreiklangsintervallen einen entsprechend mit Schritten gefüllten Pfad zuordnet, startet die duale Transformation bei den Linearformen auf Gitterpfaden aus Schrittintervallen. Solch eine Linearform zählt, wie oft ein bestimmtes Schrittintervall in einem Pfad vorkommt. Die duale Transformation muss folglich alle Gattungen der Dreiklangsintervalle zusammentragen, in denen das betreffende Schrittintervall auftritt. Bei der folgenden Konstruktion wird der Ton c fixiert; dann werden einerseits die drei Schrittintervalle betrachtet, die zu ihm hinführen, und andererseits die drei Schrittintervalle, die von ihm wegführen. Beide Grafiken in Abbildung 11 zeigen Konfigurationen von je sieben Einheitsquadraten im dreidimensionalen Tongitter. Diese repräsentieren die dualen Basiselemente zu den jeweils durch Pfeile dargestellten kleinen und großen Terzen und Quarten. Diese Intervalle wiederum zeichnet aus, dass sie Gattungen besitzen, in denen die drei zuvor ausgewählten – auf den Ton c bezogenen – Schrittintervalle vorkommen (siehe dazu die Notendarstellungen in Abb. 12). Die rechte Grafik betrifft die Schrittintervalle, die zu c hinführen. Der große Ganzton über b kommt in den Gattungen der großen Terz über b (in B-Dur), der kleinen Terz über a (in F-Dur) und der Quarte über as (in Des-Dur) vor. Der kleine Ganzton über b kommt in den Gattungen der großen Terz über as (in As-Dur) und der Quarte über b (in Es-Dur) vor. Der Halbton über h kommt in den Gattungen der kleinen Terz über h (in G-Dur) und der Quarte über g (in C-Dur) vor. Analog ergibt sich die linke Grafik aus der Lokalisierung der von c wegführenden Schrittintervalle in den passenden Gattungen der Dreiklangsintervalle. Die so gewonnenen Konfigurationen von Einheitsquadraten bilden ›Digitalisierungen‹ der von den Eigenvektoren v und w aufgespannten invarianten ›Charakter‹-Ebene. Vier der Einheitsquadrate kommen in beiden Konfigurationen vor. Die verbleibenden sechs, d.h. drei aus jeder Konfiguration, umschließen zusammen einen Einheitswürfel und haben damit weitere sechs Gitterpunkte gemeinsam. Mit anderen Worten: Mit einer einzigen Ausnahme enthalten die beiden Konfigurationen dieselben 16 Gitterpunkte. Sie unterscheiden sich lediglich in der Oktavlage des Tons c bzw. c’.
Abbildung 12: Die ›Charakter‹-Ebene der Dur-Tonart
Die Teilgrafiken in der Mitte von Abbildung 12 zeigen, wie diese Konfigurationen durch orthogonale Projektion entlang der Eigenhöhe jeweils verschiedene Parkettierungen desselben Gebiets auf der ›Charakter‹-Ebene erzeugen.
Im unteren Teil von Abbildung 12 werden die Tonnamen der Gitterpunkte entlang der Projektion auf die ›Charakter‹-Ebene übertragen. Dabei entsteht eine Spielart des Dreiklangs-Tonnetzes, insofern jedes der projizierten Einheitsquadrate aus einem Dur- und einem Molldreiklang zusammengesetzt ist. Aufschlussreich ist eine Aufteilung jeder der beiden Parkettierungen in drei Teilbereiche, die mit den Farben rot, grün und blau gekennzeichnet sind. Dank der unterschiedlichen Oktavlagen von c und c’ kann man den gesamten Bereich auf zwei verschiedene Weisen aus den drei Teilbereichen zusammensetzen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, auf dem Gesamtbereich ein dynamisches System zu definieren. Es beruht auf einer Abbildung des besagten Bereichs auf sich selbst, unter welcher die in der rechten Grafik farbig markierten Teilbereiche jeweils auf die links mit der gleichen Farbe markierten Teilbereiche gesendet werden. Die Einschränkung dieser Abbildung auf die Tonnamen generiert eine absteigende Tonleiter mit vier chromatischen Ambiguitäten (Abb. 12, ganz unten).
Der besagte Bereich auf der ›Charakter‹-Ebene versammelt Informationen über das Vorkommen der drei auf den Ton c hinführenden bzw. von ihm wegführenden Schrittintervalle in verschiedenen Dur-Tonleitern. Zu erwarten wäre ein auf einer Metaebene erstellter ›toter‹ Katalog. Im Resultat zeigt sich indes, dass diese Metaebene selbst die Dynamik einer Tonleiter (mit chromatischen Ambiguitäten) aufweist. Dies bedeutet, dass die Orientierungstätigkeit über die möglichen Dur-Charaktere der sechs Nachbartöne eines Tons entlang derselben Bahnen verlaufen kann, wie der melodische Fluss innerhalb einer (chromatisch erweiterten) Moll-Tonart.
Diese Einsicht wird noch deutlicher, wenn man sich dieses Resultat auch noch einmal im zweidimensionalen Fall der modalen Diatonik vor Augen führt und mit dem Resultat aus Abschnitt 3.5 vergleicht.
In Abbildung 13 wird gezeigt, dass sich das dynamische System des äolischen Modus aus Abbildung 10 auch über das im Abschnitt 3.4 beschriebene Verfahren einer Orientierungstätigkeit mit Hilfe der zum ionischen Modus gehörenden dualen Gitterpfad-Transformation gewinnen lässt.
Abbildung 13: Das dynamische System des äolischen Modus aus Abbildung 10, in Analogie zu Abbildung 9 mit Hilfe der dualen ionischen Gitterpfad-Transformation gewonnen
4. Heureka!
Die im vorigen Abschnitt behandelten mathematischen Resultate sind unverzichtbare Bestandteile einer Gesamtargumentation, welche die Relevanz von Handschins Begriff des Toncharakters für die Erforschung der tonalen Qualia stützt. Abschließend soll deshalb die Tragweite jener Erkenntnis beleuchtet werden, die in der Gegenüberstellung der Abbildungen 10 und 13 zum Ausdruck gebracht wird. Das dahinterstehende mathematische Resultat wurde von Valérie Berthé und Koautoren (2008) erzielt.[104] Neu ist dessen musiktheoretische Interpretation: Wenn man die beiden diatonischen Schrittintervalle, große und kleine Sekunde, von einem gemeinsamen Ton aus betrachtet, also zum Beispiel c-d und c-des, so kann man für jeden der sechs authentischen diatonischen Modi zwei Gebilde konstruieren.
Eines betrifft die Darstellung des betreffenden Modus als Quint/Quart-Faltung in b-Richtung, die von den Tönen d und des begrenzt und durch den Ton c in die beiden Schrittgattungen geteilt wird. In diesem Gebilde manifestiert sich ein konkreter Modus, und die Quint/Quart-Faltung entspricht einer modal verfeinerten Modellierung von Handschins Toncharakter für den betreffenden Modus. Für den äolischen Modus kann sie in Abbildung 8 direkt abgelesen werden. Mit Hilfe der zugehörigen Gitterpfad-Transformation lässt sich daraus eine geometrische Realisierung gewinnen, wie sie auf der linken Seite von Abbildung 10 dargestellt ist.
Das zweite Gebilde betrifft hingegen die quasi-lexikalische Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten, die beiden Schrittintervalle c-d bzw. c-des in konkreten Quint- bzw. Quartgattungen eines der sechs Modi zu realisieren.[105] Die für die abschließende Diskussion entscheidende Erkenntnis besteht darin, dass jede dieser quasi-lexikalischen Darstellungen genau die Struktur einer Quint/Quart-Faltung eines der sechs Modi aufweist. Die Charaktere im Inneren eines Modus haben also dieselbe Art der Parametrisierung wie die Charaktere ein und desselben Tons im Gefüge der verschiedenen Transpositionen eines Modus.
Solange man die Toncharaktere als Erlebnisqualitäten nur eines einzigen fest vorgegebenen Modus betrachtet, stellt es aus empirischer Sicht eine Herausforderung dar, diesen Tonparameter neben dem der Tonhöhe zu untersuchen. Abgesehen von den dazu erforderlichen methodischen Feinheiten, zu deren Ausarbeitung sich womöglich bereits erprobte Ansätze anbieten[106], lässt sich die ganze Fragestellung von vorn herein mit einem Einwand in der Form von ›Ockhams Rasiermesser‹ konfrontieren, d.h. mit dem Vorwurf einer Verletzung des Prinzips der einfachsten Beschreibung. Die Töne eines Modus unterscheiden sich ja bereits in der wahrgenommenen Höhe. Warum sollte eine zweite vermeintlich redundante Parametrisierung für deren Erleben von Bedeutung sein?
Die Situation ändert sich allerdings, berücksichtigt man den von Hansberry eingebrachten Gedanken, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen einer Tätigkeit des interpretativen Urteilens und den Erlebnisqualitäten der Töne. Wie bereits in Beispiel 4 zum Ausdruck gebracht wird, variieren unabhängig vom Modus die verschiedenen Bedeutungen ein und derselben Note entlang verschiedener Vorzeichnungen mit dem Parameter der Quintenbreite. Die Variation der Charaktere der Töne in einem festen Modus und die Variation der Charaktere ein und desselben Tons in verschiedenen Modi stehen damit in einem engen mathematischen Zusammenhang. Der hier interpretierte mathematische Sachverhalt ist nichts als eine Verfeinerung des in Beispiel 4 illustrierten Sachverhalts. Im Falle der Parametrisierung der Charaktere ein und desselben Tons verliert ›Ockhams Rasiermesser‹ also an Schärfe, was die Rolle der Tonhöhe angeht. Damit rücken Situationen der Umdeutung in den Fokus fortgesetzter Untersuchungen.
Dies bedeutet eine stärkere Hinwendung zur Analyse unter Berücksichtigung des Zusammenspiels von Syntagmatik und Paradigmatik. Auf analytischem Gebiet gibt es bereits einen regen transdisziplinären Diskurs zwischen Musiktheoretiker*innen und Kognitionsforscher*innen, welcher nicht zuletzt durch Lewins Beitrag »Music Theory, Phenomenology, and Modes of Perception« (1986) an Tiefgang gewonnen hat. Während kognitive Ansätze eher darauf ausgerichtet sind, aus der Vielzahl möglicher Analysen einer Passage nach bestimmten Regeln eine ›beste‹ auszuwählen, sind Lewins Anstrengungen darauf gerichtet, die Überlagerung verschiedener Interpretationen zu beschreiben und zu verstehen.[107] Rings’ Buch Tonality and Transformation bietet zahlreiche Beispiele und daran geknüpfte Anregungen für die Erforschung des Toncharakters im analytischen Kontext.
Jacques Handschin verdankt die Musikforschung ein frühes und engagiertes Plädoyer für die Erschließung dieses spannenden Forschungsgebiets. Seine Ideen verdienen es, vor dem aktuellen Wissensstand neu positioniert und weiter verfolgt zu werden. Mit der Hinwendung Hurons zu diesem empirisch schwer zu fassenden Gegenstand hat die Musikkognition ein neues Kapitel zu seiner transdisziplinären Ergründung aufgeschlagen. Ein wissenschaftlicher Durchbruch in der Frage, was den Erlebnisgehalt von Tönen ausmacht, wäre zweifellos auch von Bedeutung über den Bereich der Musikforschung hinaus.
Anmerkungen
Der Autor verdankt einigen Lesern, darunter den anonymen Gutachtern des vorliegenden Artikels, wichtige Impulse, die maßgeblich zu einer besseren Verständlichkeit der Argumentation sowie mancher Schärfung derselben beigetragen haben. Vielfältige Anregungen ergaben sich aus dem Austausch mit David Clampitt, Karst de Jong, Franz Michael Maier, Nadia Moro, Martin Rohrmeier und Stefan Schmidt. Besonders möchte der Autor Jeanna Kniazeva dafür danken, mit ihrer Bitte um einen Beitrag für das St. Petersburger Handschin-Symposium den entscheidenden Anstoß zu dem jetzt vorliegenden Aufsatz gegeben zu haben. | |
Vgl. Maier 1991, 11. | |
Im Lichte der von Benjamin Hansberry angeregten Erinnerung an das Qualia-Problem (siehe Abschnitt 2.4) ist folgende ideengeschichtliche Querverbindung von Interesse: Anlässlich des 80. Todestages von Carl Stumpf würdigte Margret Kaiser-el-Safti (2016) dessen vornehmlich durch die Musik motivierte Unterscheidung zwischen Gefühlsempfindungen und Gemütsbewegungen als den durchdachtesten Beitrag zum Problem der Qualia. Handschins konkrete Vorschläge für eine Erweiterung von Stumpfs tonpsychologischen Ansätzen könnten daher ihrerseits substanziell zu einer Fundierung jener Unterscheidung beitragen – auf dem Gebiete der Musik. | |
Handschin 1948, 236. | |
Ebd., 7. | |
Ebd., 24. | |
Vgl. Mengozzi 2010, 31. | |
Handschin bezieht sich auf Révész 1913 (vgl. dazu auch Handschins schelmische Entschuldigung dafür, Révész’ Einführung in die Musikpsychologie aus dem Jahre 1946 vor Drucklegung des Toncharakters nicht mehr herangezogen zu haben: Handschin 1948, XV). | |
Handschin 1948, 244f. (Hervorhebung original). | |
Ebd., 25. | |
Aus der ausnehmend positiven Besprechung von Leibniz’ Monadologie in Verknüpfung mit jener vielzitierten Charakterisierung der Musik als einer »verborgenen arithmetischen Tätigkeit des unbewußt zählenden Geistes« in einem Brief an Christian Goldbach (vgl. Handschin 1948, 167–170; Zitat: 167) kann man schließen, dass Handschins Vorstellungen von der Natur des musikalisch ›Inneren‹ von dieser Spekulation beflügelt waren. Die Tätigkeit der Systembildung manifestiert sich nach Handschins Auffassung demnach in jener »verborgenen arithmetischen Tätigkeit des unbewußt zählenden Geistes«, die einem fortgesetzten Potenzieren der Verhältniszahl 3/2 entspricht. | |
Die logarithmische Funktion ist jedenfalls eine streng monotone Abbildung, welche eine wie auch immer gewählte Ordnung treu erhält, somit nicht für die Verrichtung der Umsortierung in Frage kommen kann. | |
In die Überlegungen des vorliegenden Beitrags wird überhaupt nur die zweite systembezogene Definition der Quinte integriert. Damit soll die konsonanzbezogene Definition allerdings nicht bewusst als irrelevant zurückgewiesen werden. Womöglich mag es eines Tages Argumente geben, die Handschin in seinem Festhalten an der legendären Verwunderung der Pythagoreer Recht geben. Immerhin haben es ja die ganzzahligen Frequenzverhältnisse mit Helmholtz in die Psychophysik geschafft (als lokale Minima der Dissonanzkurven von Klängen mit harmonischen Spektren) und mit Gerald Langner (vgl. Langner/Ochse 2005) bis in die Physiologie des auditiven Cortex (siehe auch Langner 2015). | |
Noch ganz in klassischer Manier unterschied er die ›männlichen‹ oder ›festen‹ Toncharaktere f und c von ihren ›weiblichen‹ oder ›unfesten‹ Gegenstücken e und h auf der gegenüberliegenden Seite der Charakterskala (vgl. Handschin 1948, 13). Moderner gesprochen, könnte man darin den Versuch sehen, die Qualitäten der einzelnen Toncharaktere mittels eines einzigen semantischen Differenzials inhaltlich zu verorten. Die scheinbar formale Bezeichnung als b-Seite bzw. #-Seite betont dagegen die Charakterabstufungen als Mikroalterationen entlang einer Achse von Qualitäten. | |
Handschin 1948, 117. | |
Ebd., 251. | |
Ebd., 254f. | |
Ebd., 282f. | |
Dahlhaus 1968, 18. | |
Handschins Untersuchungen und vor allem die Rezeption seines Buchs fielen in eine Zeit, in welcher die musikalische Avantgarde im Begriff war, die Tonalität als musikalische Mentalität zu Grabe zu tragen. Dass gerade in eben jener Zeit die Frage nach der Entstehung der harmonischen Tonalität besonders engagiert diskutiert wurde, erklärt Thomas Christensen (2016) überspitzt mit dem Bedürfnis nach einer »Weihnachtsgeschichte der Tonalität« in Ergänzung zu ihrem zeitgleich zelebrierten »Passionsspiel«. Das systematische Anliegen des Historikers Handschin passte allerdings nicht in diese Strömung, denn seine Untersuchungen zielten ja auf ein tonpsychologisch relevantes allgemeingültiges Prinzip ab, nach dem sich Tonbeziehungen konstituieren sollten. | |
Dahlhaus 1968, 153. | |
Ebd., 154. Dahlhaus lässt übrigens eine Vorgeschichte dieses Arguments unerwähnt: Handschin selbst (1948, 239f.) hatte den Einwand, »der Sänger und Hörer könne doch beim Schritt c-e nicht fühlen, daß das e 4 Quintenschritte voraussetze«, schon bei Hermann von Helmholtz vorgefunden und zum Anlass genommen, sich seinerseits zu fragen, ob sich dieser Einwand bereits gegen eine im 19. Jahrhundert vertretene Vorform seines tonpsychologischen Ansatzes gerichtet haben mochte. Der Umstand, dass Handschin eher an eine unbewusste Wahrnehmung des Toncharakters dachte denn an eine bewusste Gehörbildungsübung, wie sie in Dahlhaus’ oder Helmholtz’ Argument unterstellt wird, ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass bei Handschin hinsichtlich der Wechselbeziehung zwischen den beiden Ordnungen eine Erklärungslücke besteht. | |
Unter Ersetzung des Tons d (›Grundton‹ im d-Modus und zweite Stufe im c-Modus) durch e (als erste Stufe des e-Modus und zweite Stufe des d-Modus) verlagert er Handschins Beispiel stillschweigend in den Kontext des mittelalterlichen 8-Modus-Systems. | |
Dahlhaus 1968, 153. | |
Dieser Einwand könnte natürlich ebenso gegen jeden anderen Ansatz vorgebracht werden, bei welchem komplexe Tonbeziehungen als das Resultat einer Überlagerung oder Hierarchie elementarer Tonbeziehungen beschrieben werden. Mittels ausgefeilter Methoden der empirischen Musikpsychologie, die genau dem Zweck dienen, das Bestehen derartiger Hierarchien zu testen, kann an dieser Stelle nachgehakt werden. | |
Dahlhaus 1968, 16. | |
Ebd., 16f. | |
Handschin 1948, 266. | |
Der Bedeutung dieser Unterscheidung bei Handschin entspricht im Sprachgebrauch der Semiologie die ›Markiertheit‹ der Moll-Tonart gegenüber der Dur-Tonart. | |
Nicht ohne Reiz ist dabei die Herausforderung, Dahlhaus’ (1968, 16) Formulierung, wonach nur die formale Definition des Toncharakters als »nach innen gewendete Position« im System unwiderlegbar sei, durch substanzielle Einsichten in die Funktionsweise des Tonsystems zu entkräften. Der Verdacht drängt nämlich sich auf, dass Dahlhaus hier die formale Definition deswegen spöttisch ansieht, weil er einzig die tautologische Gleichsetzung von Definiens und Definiendum für unwiderlegbar erachtet. | |
Stephan 1995, III. | |
De la Motte-Haber/Nitsche 1982, 78. | |
Dahlhaus 1982, 43f. | |
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass jene beiläufige Behandlung von Handschins Buch als Exempel für eine überwundene Form von Theoriebildung damit gerade dessen Einzigartigkeit und potenzielle Relevanz für die systematische Musikwissenschaft ausblendete. | |
De la Motte-Haber/Nitsche 1982, 78. | |
Fox 1949. | |
Ebd., 179. | |
Vgl. z.B. Parncutt/Stuckey 1992; Parncutt 1999. | |
Vgl. Babbitt 1965/2003, 194. | |
Vgl. Handschin 1948, 18. | |
Vgl. Gamer 1967. | |
Man ist versucht, diesen theoretischen Umweg in Hochrechnung von Thomas Christensens biblischer Parabel als eine ›Auferstehungsgeschichte der Diatonik‹ im Kontext einer post-atonalen Musiktheorie zu erzählen. Allerdings gilt es im Abschnitt 3.1 des vorliegenden Beitrags auch den Bogen zu einer ertragreichen Mathematisierung der traditionellen diatonischen Liniennotation von Eric Regener aus dem Jahre 1973 zu schlagen, die völlig zu Unrecht im Schatten jener post-atonalen Projekte gestanden hat und noch immer steht. Sie wird den Schlüssel für die Einbindung und Weiterentwicklung von Handschins Ideen liefern. | |
Vgl. Regener 1974, 199–201. | |
Natürlich hatten auch andere Theoretiker schon in dieser Richtung gedacht. Die von Regener (1974) angedeutete und von Clough (1979) ausgeführte Klassifikation der Teilmengen der diatonischen Skala unter dem Gesichtspunkt diatonischer Transpositionen findet sich schon in Franz Alfons Wolperts (1972) ›vollständiger Übersicht sämtlicher Akkordtypen‹. In den USA hatte überdies Joseph Schillinger (1946) im Rahmen seiner Mathematisierungs-Ansätze der Kompositionslehre bereits diatonische und chromatische Transformationen nebeneinander als Gestaltungsmittel systematisiert. | |
Vgl. den Titel von Huron 2006: Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. | |
Vgl. Krumhansl 1987 und 1990. | |
Vgl. Aarden 2003, 26. | |
Vgl. ebd., 79ff. | |
Vgl. Huron 2006, 159. | |
Ebd., 144 (Hervorhebungen original). | |
Ebd., 147 (Hervorhebung original). | |
Ebd., 166f. (Hervorhebungen original). | |
Vgl. Krumhansl/Shepard 1979. | |
Vgl. z.B. Handschin 1948, 26. | |
Die Harmonisierungen sind übrigens nicht völlig parallel. Die Note b in Takt 195 erscheint als Septime eines (unvollständigen) Dominantseptakkords in F-Dur, wogegen das f im dritten Takt bezogen auf C-Dur subdominantisch gedeutet wird. Im Sinne Handschins hätten b und f jeweils einen anderen harmonischen Beicharakter. | |
O’Hara 2012, [1]f. | |
Zum Zwecke einer unmittelbaren Verständlichkeit für Musiker verwendet Rings nicht die mathematisch motivierten Restklassen 0 bis 6 modulo 7 bzw. 0 bis 11 modulo 12, wie beispielsweise Agmon, sondern die Stufennummern 1 bis 7 und lateinische Notennamen, die je nach Situation enharmonisch vertauscht werden dürfen. | |
Rings 2011, 43 (Hervorhebung original). | |
Vgl. z.B. die bereits in Abschnitt 1.1 zitierte Passage aus Handschin 1948, 244f. | |
Es werden die in der englischsprachigen Literatur üblichen Abkürzungen für Notenintervalle verwendet: Die arabischen Ziffern 1, 2, 3 usw. bezeichnen die generischen Intervalle Prime, Sekunde, Terz usw., und die Buchstaben P, M, m, A und d stehen für die Attribute perfect (rein), major (groß), minor (klein), augmented (übermäßig), diminished (vermindert). | |
Rings 2011, 47, zeigt eine solche Tabelle, die noch weitere Intervalle benennt. | |
Dieses Zitat ist bereits die Überarbeitung der betreffenden Stelle aus dem originalen Vortrag (Hansberry 2013) für einen in Kürze erscheinenden Artikel und wurde dem Autor des vorliegenden Beitrags in einer E-Mail-Kommunikation zur Verfügung gestellt. | |
Hansberry 2013 (Hervorhebung original). | |
Vgl. Arthur 2015. | |
Husserl 1907/73, 38 (Hervorhebungen original). | |
Rings selbst kommentiert Hurons Verwendung des Qualia-Begriffs sowie dessen Deutung nur am Rande in einer Fußnote. Darin schließt er eine Vereinbarkeit der Ansätze nicht aus, erwägt aber, dass Musiker und theoretisch gebildete Hörer aufgrund ihrer Erfahrung Skalenstufen-Qualia intensiver erleben könnten, als dies durch statistisches Lernen erklärbar wäre (vgl. Rings 2011, 42). | |
Hansberry 2013. | |
Interessant an diesem Choral-Beispiel ist, dass die beiden Bedeutungen (6, h) und (4, h) einander zu überlagern scheinen: Durch das Terzverhältnis der Zeilenenden auf d und f und die Konturen einer Sequenzierung der ersten Choralzeile durch die zweite korrespondiert das dorische Pentachord auf d mit dem lydischen Pentachord auf f. Während diese musiktheoretischen Elemente dazu beitragen, eine Paradigmatik zu erschließen als einen Raum möglicher Erlebnisqualitäten, kommt einer darauf bezogenen Syntagmatik die Aufgabe zu, die Prozesse der Auswahl und der Kombination zu studieren. Huron verzichtet auf die Konstruktion eines solchen paradigmatischen Raums. Beim Ton h würde Huron von dem Quale der Tendenz sprechen, aufgrund des starken Richtungsanteils seines Profils zum Ton c hin. Diese statistische Tendenz wäre unabhängig davon gegeben, ob der melodische Schritt h-c als Konsequenz des entsprechenden melodischen Schritts g-a aus der ersten Choralzeile antizipiert werden kann. | |
Siehe oben, Abschnitt 1.3. | |
Siehe oben, Abschnitt 2.3. | |
Der Begriff wird u.a. auch in der Tonfeldtheorie verwendet (vgl. z.B. Rohringer 2009, 304). | |
Eine wichtige Erkenntnis zum Zusammenspiel der beiden Parameter erzielten Carey/Clampitt (1989; vgl. Carey/Clampitt 1996) im Rahmen ihrer Theorie der ›wohlgeformten Skalen‹ bzw. der ›Regionen‹. Der Zusammenhang dieser Erkenntnis mit Handschins ›Toncharakter‹ wurde bereits bei Clampitt/Noll (2011) herausgearbeitet und wird im vorliegenden Beitrag im Rahmen des transformationellen Ansatzes aus einer anderen Perspektive beleuchtet. | |
Eine Beschränkung des Raums auf Notenintervalle bedeutet mathematisch, dass man anstelle des aus den Einheitsquadraten gebildeten Gitters ein aus geeigneten Parallelogrammen gebildetes Teilgitter betrachtet. Regener verwendet beispielsweise die reine Quinte P5 und die große Sekunde M2, um ein solches aus den Linearkombinationen dieser beiden Intervalle zu erzeugen (Abb. 1). | |
Rings 2011, 10. | |
Eine latente inhaltliche Verbindung zu Lewins GIS-[Generalized Interval System]Theorie besteht darin, dass Regener das traditionelle Notationssystem ganz so formalisiert, wie Lewin später sein ›verallgemeinertes Intervallsystem‹ definiert. Man hat einen Grundraum S von Noten – gemeint sind die mit Notenköpfen auf Notenlinien mit Vorzeichen potenziell notierbaren Tonhöhen – und eine Gruppe I von Notenintervallen, welche durch eine Abbildung int: S x S → I mit dem Raum S verbunden ist. Jedem geordneten Paar (s, t) von Noten wird ein Notenintervall int(s, t) zugeordnet. Dahinter steht die Motivation, Intervallen einen eigenen Status zuzuerkennen und sie nicht einfach mit Notenpaaren gleichzusetzen. Mathematisch ist dabei von Bedeutung, dass man Intervalle addieren kann. Drei Eigenschaften des Zusammenspiels von Noten und Intervallen, die Regener hervorhebt (vgl. Regener 1973, 46, Gleichung 7.4, und ebd., 49, Gleichung 7.12), konstituieren auch Lewins Definition des verallgemeinerten Intervallsystems sowie eine Folgerung daraus (vgl. Lewin 1987, 26, Definition 2.3.1 und Theorem 2.3.2): (1) Sobald man eine konkrete Note s fixiert, gibt es zu jedem Intervall i eine eindeutig bestimmte Note t, für welche i = int(s, t) gilt. (2) Für je drei Noten r, s, t gilt int(r, s) + int(s, t) = int(r, t). (3) Für je zwei Noten r, s gilt int(r, s) = - int(s, r). | |
In der Matrix R steht unten links eine 0 und unten rechts eine 1, d.h. die zweite Koordinate wird nicht geändert. Außerdem stehen oben rechts und links Einsen, d.h. die neue erste Koordinate ergibt sich als Summe der beiden alten Koordinaten. In der Matrix L steht oben links eine 1 und oben rechts eine 0, d.h. die erste Koordinate wird nicht geändert. Außerdem stehen unten rechts und links Einsen, d.h. die neue zweite Koordinate ergibt sich hier als Summe der beiden alten Koordinaten. Wegen der Platzierung der Nullen nennt man R obere und L untere Dreiecksmatrix. Die Buchstaben R und L stehen für ›Rechts‹ bzw. ›Links‹, was mit einer Konvention in Zusammenhang steht, Verkettungen dieser beiden Elementartransformationen als Knoten eines binären Baums zu platzieren. | |
Dass es legitim ist, an dieser Stelle von Skalen zu sprechen, wird im Unterabschnitt 3.5 transparent. Während die Koordinaten hier jeweils nur die Anzahl der betreffenden Schrittintervalle festhalten, welche Quinte und Quarte ausfüllen, erfolgt dort nämlich die transformationelle Ausdifferenzierung der entsprechenden Quint- und Quartgattungen. | |
Die von Dahlhaus angesprochene Konstruktion der Modi als Tetrachord-Ausfüllungen eines Quart-Quint-Oktav-Gerüsts entspricht auf Intervallebene der Zerlegung (RR)L, welche zunächst eine strukturelle Ebene etabliert und sodann zur diatonischen führt. Der Terminus der ›strukturellen Skala‹ für die dreitönige quint-generierte Skala wurde von Carey/Clampitt (1989) eingeführt. In Ergänzung dazu wurde von Karst de Jong für die authentische Teilung der Oktave der Terminus der ›essenziellen Skala‹ vorgeschlagen (persönliche Kommunikation). | |
Die Verkettung linearer Abbildungen wird mathematischer Konvention folgend in Rechts-links-Ordnung notiert, d.h. beim Abarbeiten der Komponenten wird jeweils zuerst die am weitesten rechts stehende berücksichtigt. RRL bedeutet also: zuerst L, dann R und dann nochmals R. | |
Sie entsprechen den 2x2 Matrizen der Determinante 1, deren ganzzahlige Koeffizienten sämtlich nicht-negativ sind. | |
Eine Erörterung des möglichen Zusammenspiels von auditiver Tonhöhenwahrnehmung und musikalischem Denken würde hier zu weit führen. Eine Korrespondenz ergibt sich, wenn man für die Tonhöhenintervalle von Quinte und Quarte die Logarithmen h1 = log2(3/2) und h2 = log2(4/3) der pythagoreischen Zahlenverhältnisse 3/2 und 4/3 wählt oder z.B. die Tonhöhenintervalle 7/12 und 5/12 der gleichstufigen zwölftönigen Temperatur. Die Stabilität des quint-generierten diatonischen Systems bleibt gewährleistet, solange das Tonhöhenintervall h1 der Quinte zwischen 1/2 und 3/5 liegt (vgl. Carey/Clampitt 1989). Für das chromatische System verringert sich dieser Spielraum auf die Grenzen zwischen 4/7 und 3/5. Aber der genaue Wert h1 = log2(3/2) spielt für die theoretischen Überlegungen keine maßgebliche Rolle. Auch die Stufenhöhe ist in diesem Sinne ein legitimer Tonhöhenbegriff. | |
Der Raum der Linearformen eines Vektorraums wird als dessen ›Dualraum‹ bezeichnet. Entsprechend induziert jede lineare Transformation eines Vektorraums eine zugehörige ›duale Transformation‹ des Dualraums. | |
Beim Beispiel der Pythagoreischen Tonhöhe wären die Koordinaten der ersten Linearform h1 = log2(9/8) und h2 = log2(256/243), und nach Transformation würde man deren Bildkoordinaten 3 h1 + h2 = log2(3/2) und 2 h1 + h2 = log2(4/3) erhalten. | |
Man kann sich davon durch eine Proberechnung überzeugen. Staucht man nämlich beide Koordinaten um den inversen Eigenwert, so erhält man den Vektor für die spezifischen Größen der großen und kleinen Sekunden: Um schließlich die Probe zu machen, addiert man die Größe der kleinen Sekunde 0.113249… zum Dreifachen der Größe der großen Sekunde 0.154701… und erhält wieder die Größe der Quinte 0.57735… | |
Vgl. Moro 2006, 83. | |
Diese historische Vorlage darf im vorliegenden Beitrag insofern nicht unerwähnt bleiben, als Handschin sich in seiner ideengeschichtlichen Diskussion zum Toncharakter Herbarts Ideen gegenüber reserviert zeigt und diese sogar mit teilweise polemischen Bemerkungen attackiert. Dies betrifft sowohl musiktheoretische Details als auch den originellen Umgang Herbarts mit Anregungen, die dieser bei Leibniz bezog. Herbart (1839) untersucht Geistestätigkeit als eine Gesamtheit miteinander interagierender Vorstellungen und schlägt mathematische Formeln für die Berechnung ihrer gegenseitigen Verstärkung bzw. Hemmung vor. Die seit 1811 in mehreren Abhandlungen dokumentierten Untersuchungen zur ›Tonlehre‹ spielten eine Schlüsselrolle im Versuch des Nachweises der Richtigkeit dieser Lehre. Dem ›leiblichen Hören‹ stellt Herbart das ›musikalische Denken‹ gegenüber, welches eigenen inneren Gesetzen folge, jenseits des Zuständigkeitsbereichs der mathematischen Akustik. Hinsichtlich der Grenze zwischen dem Inneren und dem Äußeren komme, so Herbart, das musikalische Denken dem leiblichen Hören von innen her apperzipierend entgegen (vgl. Herbart 1839, 8f.). | |
Geometrisch kann man die Linearform als Skalarfeld und den Vektor v als dessen Gradienten interpretieren, d.h. als die Richtung des steilsten Anstiegs, welche aufgrund der Linearität im ganzen Raum dieselbe ist. | |
Der diskrete Raum der Notenintervalle muss hierzu in einen zweidimensionalen reellen Vektorraum eingebettet werden. Je nach Tonhöhen-Linearform kann es sein, dass der zugehörige Kern kein Notenintervall enthält, sondern nur von solchen angenähert werden kann (siehe Abb. 5). | |
Vgl. Clampitt/Noll 2011. | |
Für Details vgl. ebd. | |
Vgl. auch Clampitt/Noll 2011. | |
Vgl. Meier 1974, 26. | |
Oder mathematisch noch weiter gefasst: Die freie (nicht-kommutative) Gruppe mit zwei Erzeugenden überlagert die freie kommutative Gruppe mit zwei Erzeugenden. | |
Die Betrachtung der Automorphismengruppe Aut(F2) der freien Gruppe F2 mit zwei Erzeugenden ist die mathematisch natürliche Verfeinerung der Automorphismengruppe GL2(Z) der freien kommutativen Gruppe Z2 mit zwei Erzeugenden. | |
Vgl. Lothaire 2002. | |
Hierbei handelt es sich um einen vom Verfasser eingeführten Terminus, der seine Berechtigung aus der beschriebenen Dualität bezieht. | |
Mengozzi 2010, 230ff., berichtet, dass Gioseffo Zarlino in seinen Istitutioni harmoniche aus dem Jahre 1558 zunächst Heinrich Glareans 12-Modus-System ohne Einschränkungen übernimmt, dass er aber in seinen Dimostrationi harmoniche aus dem Jahre 1571 Glareans Sortierung d, e, f, g, a, c der sechs Finales beanstandet und in einem fiktiven Diskurs mit seinen Zeitgenossen Adrian Willaert und Claudio Merulo mit Unterstützung des Ersteren auf die Übereinstimmung zwischen den sechs Finales mit den sechs Silben von Guidos Hexachord: ut, re, mi, fa, sol, la hinweist. | |
Die Wahl der Termini ›plagal‹ und ›authentisch‹ ergibt sich in diesem Zusammenhang zwanglos aus der Übertragung der etablierten Bedeutungen im Sinne der Dualität zwischen Schrittintervall-Mustern und Quint/Quart-Faltungen. | |
Die Iteration dieser Selbstabbildung des Gesamtsegments wird als ein diskretes dynamisches System aufgefasst. Die Trajektorie eines beliebig gewählten Punkts ergibt sich aus der iterierten Anwendung dieser Selbstabbildung auf den betreffenden Punkt. | |
Vgl. Clampitt/Noll (in Vorbereitung). | |
Deutsch und Feroe (1981) präsentieren ein entsprechendes hierarchisches Tonhöhen-Modell, welches durch empirische Daten und daraus abgeleitete Repräsentationen von Krumhansl (1979; 1990) gestützt wird. Lerdahl (2001, 45) schlägt als Grundlage für seinen kognitiv ausgerichteten Analyseansatz einen als basic space bezeichneten Konfigurationsraum vor, der diese Resultate einbezieht. Eine neuere Studie von Krumhansl/Lerdahl (2007) bezieht diesen Ansatz wiederum als eine von vier Komponenten in ein kognitives Modell für tonal tension ein. | |
Für die Unterscheidung dreier Schrittintervalle gibt es eine bis in die Antike zurückreichende Tradition, die ihrerseits das Problem der konkurrierenden Intervallbestimmungen als Frequenzverhältnisse bzw. als Konstituenten eines Intervallsystems mit sich herumträgt. Die spezifische Größenbestimmung des Unterschieds aus großer Terz und Ditonus bzw. zwischen großem und kleinem Ganzton in Form des syntonischen Kommas 81:80 wird hier ausgeklammert. Dagegen interessiert die transformationelle Bedeutung dieser Intervalle im System. | |
Für die mathematische Definition siehe Arnoux/Ito 2001. Dort wird eine geometrische Interpretation der dualen Basis durch Einheitsquadrate vorgeschlagen, die den zugehörigen Gittersegmenten jeweils gegenüberliegen. | |
Siehe Theorem 5.2 in Berthé/de Luca/Reutenauer 2008, 549. | |
Hier noch einmal die Konstruktion: Im Sekundgitter (siehe Abb. 9) kann man die beiden Schrittintervalle c-d und c-des als elementare Gitterpfade betrachten, d.h. als sich vom Ton c aus nach rechts bzw. nach oben erstreckende Segmente dieses Gitters. Diese sind ihrerseits mit Linearformen assoziiert. Sie ordnen jeweils ›ihrem‹ Gittersegment den Wert 1 und allen anderen Gittersegmenten den Wert 0 zu. Mit jedem der sechs Modi ist wiederum eine Gitterpfadtransformation und deren duale Transformation assoziiert. Letztere kann auf die beiden genannten Linearformen angewandt werden und liefert dabei eine formale Summe von Linearformen, die ihrerseits mit elementaren Segmenten im Quint/Quart-Gitter assoziiert sind. Die besondere Eigenschaft dieser Quint- und Quartsegmente ist, dass sie unter der betreffenden Gitterpfadtransformation auf modale Gitterpfade im Sekundgitter abgebildet werden, in denen die beiden elementaren Gitterpfade für c-d und c-des tatsächlich vorkommen. | |
Arthur (2016) verwendet in ihren Experimenten mit Versuchspersonen die Methode der semantischen Differenziale. | |
Die in Anmerkung 68 angesprochene Überlagerung zweier Interpretationen der Note h in der zweiten Choralzeile von O Heiland reiß den Himmel auf gibt dazu ein vergleichsweise einfaches Beispiel. |
Literatur
Aarden, Bret (2003), Dynamic Melodic Expectancy, Ph.D., Ohio State University.
Agmon, Eytan (1986), Diatonicism, Chromaticism, and Enharmonicism. A Study in Cognition and Perception, Ph.D., City University New York.
––– (1989), »A Mathematical Model of the Diatonic System«, Journal of Music Theory 33, 1–25.
––– (2013), The Languages of Western Tonality, Berlin: Springer.
Arnoux, Pierre / Shunji Ito (2001), »Pisot Substitutions and Rauzy Fractals«, Bulletin of the Belgian Mathematical Society – Simon Stevin 8, 181–207.
Arthur, Claire (2015), »A Comprehensive Investigation of Scale-Degree Qualia. Theoretical, Cognitive, and Philosophical Approach«, Vortrag, gehalten auf dem Jahreskongress der Society for Music Theory am 29. Oktober 2015, St. Louis.
––– (2016), When the Leading Tone Doesn’t Lead. Musical Qualia in Context, Ph.D., Ohio State University.
Babbitt, Milton (1965/2003), »The Structure and Function of Musical Theory«, in: The Collected Essays of Milton Babbit, hg. von Stephen Peles, Stephen Dembski, Andrew Mead und Joseph N. Straus, Princeton: Princeton University Press, 191–201.
Berthé, Valérie / Aldo de Luca / Christophe Reutenauer (2008), »On an Involution of Christoffel Words and Sturmian Morphisms«, European Journal of Combinatorics 29/2, 535–553.
Brinkman, Alexander (1986), »A Binomial Representation of Pitch for Computer Processing of Musical Data«, Music Theory Spectrum 8/1, 44–57.
Carey, Norman / David Clampitt (1996), »Regions. A Theory of Tonal Spaces in Early Medieval Treatises«, Journal of Music Theory 40/1, 113–147.
Carey, Norman / David Clampitt (1989), »Aspects of Well-Formed Scales«, Music Theory Spectrum 11/2, 187–206.
Christensen, Thomas (2016), »Die Entstehung der Entstehung«, ZGMTH Sonderausgabe 2016. Carl Dahlhaus und die Musiktheorie. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/861.aspx (30.6.2017)
Clampitt, David (1997), Pairwise Well-Formed Scales. Structural and Transformational Properties, Ph.D., State University of New York.
Clampitt, David / Thomas Noll (2011), »Modes, the Height-Width Duality, and Handschin’s Tone Character«, Music Theory Online 17/1. http://www.mtosmt.org/issues/mto.11.17.1/mto.11.17.1.clampitt_and_noll.html (30.6.2017)
Clampitt, David / Thomas Noll (in Vorbereitung), »Pairwise Well-Formed Modes and Transformations«, in: Mathematics and Computation in Music. 6th International Conference, MCM 2017, Mexico City, Mexico, June 26–29, 2017, Proceedings, hg. von Emilio Lluis-Puebla, Mariana Montiel und Octavio A. Agustín-Aquino, Berlin: Springer. https://arxiv.org/pdf/1707.02370.pdf (30.6.2017)
Clough, John (1979), »Aspects of Diatonic Sets«, Journal of Music Theory 23/1, 45–61.
Clough, John / Gerald Myerson (1985), »Variety and Multiplicity in Diatonic Systems«, Journal of Music Theory 29/2, 249–270.
Dahlhaus, Carl (1968), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel: Bärenreiter.
––– (1982), »Musikwissenschaft und Systematische Musikwissenschaft«, in: Systematische Musikwissenschaft (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 10), hg. von Carl Dahlhaus und Helga de la Motte-Haber, Wiesbaden: Athenaion, 25–48.
de la Motte-Haber, Helga / Peter Nitsche (1982), »Begründungen musiktheoretischer Systeme«, in: Systematische Musikwissenschaft (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 10), hg. von Carl Dahlhaus und Helga de la Motte-Haber, Wiesbaden: Athenaion, 49–80.
Deutsch, Diana / John Feroe (1981), »The Internal Representation of Pitch Sequences in Tonal Music«, Psychological Review 88/6, 503–522.
Forte, Allen (1973), The Structure of Atonal Music, New Haven (CT): Yale University Press.
Fox, Charles W. (1949), »Gerhard Albersheim. Zur Psychologie der Ton- und Klangeigenschaften […] / Jacques Handschin. Der Toncharakter: eine Einführung in die Tonpsychologie […]« [Review], Journal of the American Musicological Society 2/3, 175–179.
Gamer, Carlton (1967), »Some Combinational Resources of Equal-Tempered Systems«, Journal of Music Theory 11/1, 32–59.
Handschin, Jacques S. (1948), Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie, Zürich: Atlantis.
Hansberry, Benjamin (2013), »What Are Scale-degree Qualia? An Assessment of Cognitive Psychology and a Philosophical Account«, Vortrag, gehalten auf dem Jahreskongress der Society for Music Theory am 1. November 2013, Charlotte [Publikation angekündigt für Herbst 2017 in Music Theory Spectrum 39/2].
Herbart, Johann F. (1839), Psychologische Untersuchungen. Erstes Heft, Göttingen: Dieterich.
Huron, David (2006), Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation, Cambridge (MA): MIT Press.
Husserl, Edmund (1907/73): Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen (= Gesammelte Werke [Husserliana], Bd. 2), hg. von Walter Biemel, Den Haag: Nijhoff.
Jackson, Frank (1982), »Epiphenomenal Qualia«, The Philosophical Quarterly 32, 127–136.
Kaiser-el-Safti, Margret (2016), »Das Qualia-Problem«, Vortrag, gehalten auf der 6. Jahrestagung der Carl-Stumpf-Gesellschaft vom 23.–25.5.2016 am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der Humboldt Universität, Berlin.
Krumhansl Carol L. (1979), »The Psychological Representation of Musical Pitch in a Tonal Context«, Cognitive Psychology 11, 346–374.
––– (1987), »Tonal and Harmonic Hierarchies«, in: Harmony and Tonality, hg. von Johan Sundberg, Stockholm: Kungliga Musikaliska Akademien, 13–32.
––– (1990), Cognitive Foundations of Musical Pitch, New York: Oxford University Press.
Krumhansl, Carol L. / Roger N. Shepard (1979), »Quantification of the Hierarchy of Tonal Functions Within a Diatonic Context«, Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance 5/4, 579–594.
Krumhansl, Carol L. / Fred Lerdahl (2007), »Modeling Tonal Tension«, Music Perception. An Interdisciplinary Journal 24/4, 329–366.
Langner, Gerald (2015), The Neural Code of Pitch and Harmony, Cambridge: Cambridge University Press.
Langner, Gerald / Michael Ochse (2005), »The Neural Basis of Pitch and Harmony in the Auditory System«, Musicae Scientiae, Special issue 2005/2006: Interdisciplinary musicology, 185–208.
Lerdahl, Fred (2001), Tonal Pitch Space, New York: Oxford University Press.
Lewin, David (1986), »Music Theory, Phenomenology, and Modes of Perception«, Music Perception 3/4, 327–392.
––– (1987), Generalized Musical Intervals and Transformations, New Haven (CT): Yale University Press.
Lothaire, M. (2002), Algebraic Combinatorics on Words, Cambridge: Cambridge University Press.
Maier, Franz Michael (1991), Jacques Handschins »Toncharakter«. Zu den Bedingungen seiner Entstehung, Stuttgart: Steiner.
Meier, Bernhard (1974), Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie, Utrecht: Oosthoek, Scheltema & Holkema.
Mengozzi, Stefano (2010), The Renaissance Reform of Medieval Music Theory. Guido of Arezzo between Myth and History, Cambridge: Cambridge University Press.
Moro, Nadia (2006), Der musikalische Herbart. Harmonie und Kontrapunkt als Gegenstände der Psychologie und der Ästhetik, Würzburg: Königshausen & Neumann.
Noll, Thomas (2016), »Die Vernunft in der Tradition. Neue mathematische Untersuchungen zu den alten Begriffen der Diatonizität«, ZGMTH Sonderausgabe 2016. Carl Dahlhaus und die Musiktheorie. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/864.aspx (30.6.2017)
O’Hara, William (2012), »Tonality and Transformation, by Steven Rings […]« [Rezension], Mosaic – Journal of Music Research 2.
Parncutt, Richard (1999), »Systematic Evaluation of the Psychological Effectiveness of Non-conventional Notations and Keyboard Tablatures«, in: Music and Signs. Semiotic and Cognitive Studies in Music, hg. von Iannis Zannos, Bratislava: ASCO Art and Science, 146–174.
Parncutt, Richard / Robert Stuckey (1992), »Towards a Standard Alternative Notation and Terminology Based on the Chromatic Scale«, Musicometrica 4, 117–143.
Regener, Eric (1973), Pitch Notation and Equal Temperament. A Formal Study, Berkeley (CA): University of California Press.
––– (1974), »On Allen Forte’s Theory of Chords«, Perspectives of New Music 13/1, 191–212.
Révész, Géza (1913), Zur Grundlegung der Tonpsychologie, Leipzig: Veit.
Rings, Steven (2011), Tonality and Transformation, Oxford: Oxford University Press.
Rohringer, Stefan (2009), »Tonalität in Franz Schuberts späten Sonatenformen. Überlegungen zum Kopfsatz des Klaviertrios B-Dur D 898«, ZGMTH 6/2–3, 273–308. http://storage.gmth.de/zgmth/pdf/458 (30.6.2017)
Schillinger, Joseph (1946), Schillinger System of Musical Composition (2 Bde.), New York: Fischer.
Stephan, Rudolf (1995):»Vorwort zur Neuauflage«, in: Jacques Handschin, Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie, Zürich: Atlantis 1948, Reprint Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, II–III.
Wiora, Walter (1951), »Der tonale Logos. Zu J. Handschins Buch ›Der Toncharakter‹«, Die Musikforschung 4/1, 1–35, und 4/2–3, 153–175.
Wolpert, Franz A. (1972), Neue Harmonik. Einführung. Die Lehre von den Akkordtypen und Grundakkorden, erweiterte und ergänzte Neufassung, Wilhelmshaven: Heinrichshofen.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.