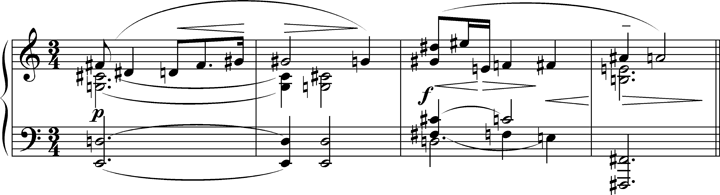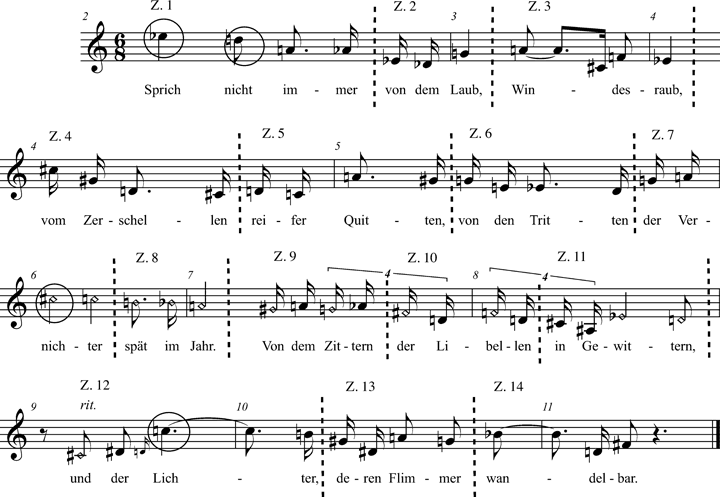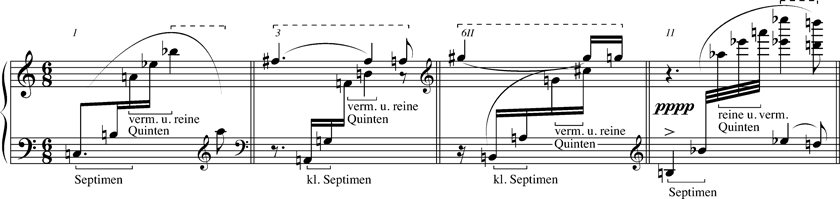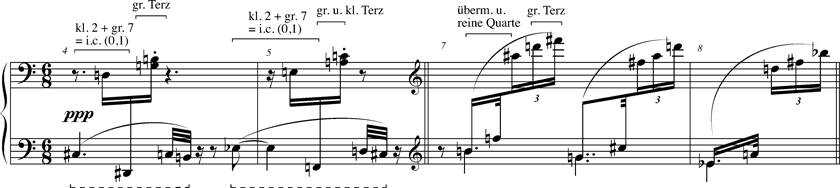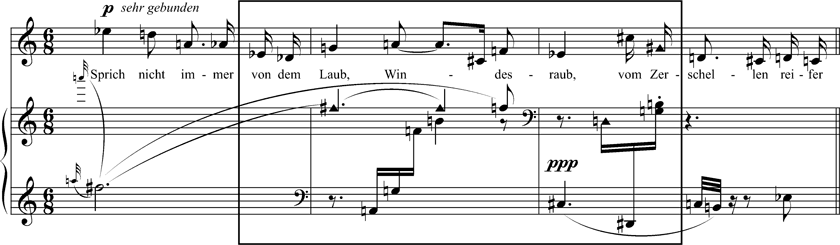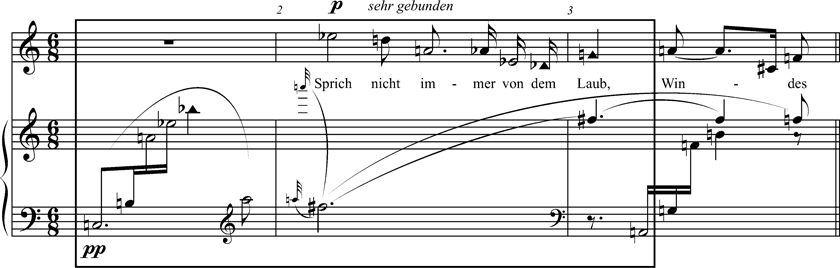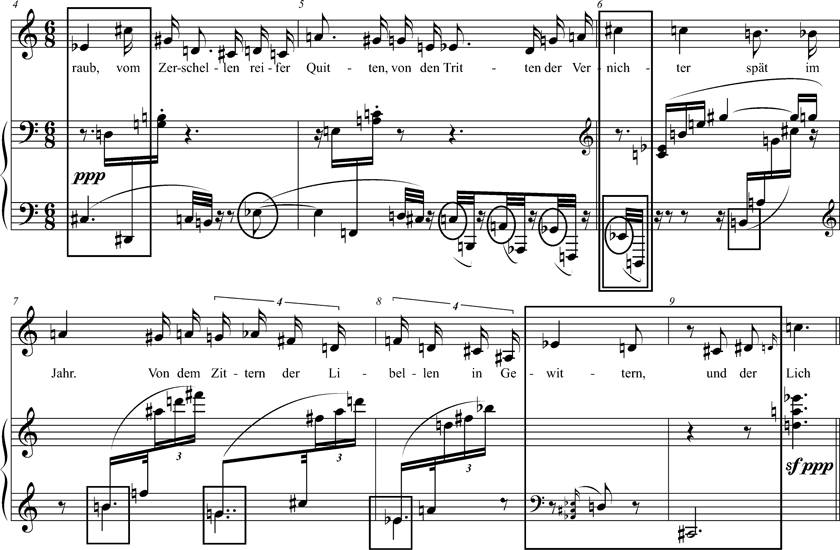Schönberg, Dahlhaus und das Problem der ›emanzipierten Dissonanz‹ – Anmerkungen zu op. 15/14
Volker Helbing
Der erste Teil des Beitrags behandelt Dahlhaus’ Deutung der Schönberg’schen »Emanzipation der Dissonanz« (als eines mit der Auflösung der Tonalität untrennbar verknüpften Begriffs) sowie den allmählichen Wandel dieser (durch Adorno geprägten) Deutung vor dem Hintergrund kompositionsgeschichtlicher, kulturgeschichtlicher und historiographischer Entwicklungen. Die sich daraus ergebenden musiktheoretischen Fragen an den Begriff werden im zweiten Teil anhand einer Analyse von op. 15/14 problematisiert. Schönberg erweist sich hier als ein Komponist auf der Suche nach neuen Orientierungen (nach dem Verlust der Tonalität), dessen Weg in die Reihenkomposition keineswegs vorgezeichnet ist.
In his first part this article deals with Dahlhaus’s interpretation of Schönberg’s »emancipation of the dissonance« (a term inseparable from [or: inextricably linked to] the dissolution of tonality) and with the gradual change of this interpretation (influenced by Adorno) due to developments in the field of compositional history, cultural history and historiography. The resulting theoretical questions are discussed within the second part by means of an analysis of op. 15 no 14. There Schönberg proves as a composer looking for new orientations (after the loss of tonality), whose way towards dodecaphony is all but predefined.
Der Gedanke, Schönbergs Begriff der ›Emanzipation der Dissonanz‹ und dessen Interpretation durch Carl Dahlhaus zum Ausgangspunkt einer Analyse zu nehmen, scheint zunächst naheliegend. Die Probleme, aber auch die überraschenden Perspektiven eines solchen Vorhabens zeigen sich, sobald man versucht, Dahlhaus’ Interpretation zu fassen:
Der zentrale Aufsatz zum Thema[1] erweist sich als durch spätere Äußerungen in wesentlichen Aspekten revidiert.
Der einzige Text zur freien Atonalität, der sich analytisch mit dem Phänomen, ja mit harmonischen Fragen überhaupt auseinandersetzt[2], gehört nicht nur zu den schwächeren Texten des Autors, sondern auch zu den frühesten auf Schönberg bezogenen, und es scheint, als hätten die in ihm zutage getretenen terminologischen Schwierigkeiten überhaupt erst den Anlass für eine intensivierte Auseinandersetzung mit dem Theoretiker Schönberg gegeben.
Die Revisionen des Historikers Dahlhaus bleiben ohne einen Blick auf den Zeitgenossen Dahlhaus unverständlich. Der aber erweist sich als offener und lernfähiger, als man dies zunächst annehmen würde.
Der Beitrag wird deshalb in seinem ersten Teil Dahlhaus’ Sicht auf die ›Emanzipation der Dissonanz‹, deren Wandlungen und die Hintergründe dieser Wandlungen fokussieren, und in seinem zweiten Teil anhand eines von Dahlhaus nicht analysierten George-Liedes einige derjenigen Thesen diskutieren, die sich über die Revisionen hinweg als konstant erweisen.
I.
Die ersten Schritte in der sogenannten ›Freien Atonalität‹ sind von Schönberg aus der Rückschau als eine Phase des Suchens und des zum Teil instinktiven Schaffens beschrieben worden. Seine Darstellung im 1935 entstandenen Vortrag »Komposition mit zwölf Tönen«[3] lässt sich im Wesentlichen auf folgende Punkte verkürzen: Mit der ›Emanzipation der Dissonanz‹ – für Schönberg gleichbedeutend mit dem »Verzicht auf ein tonales Zentrum«[4] – seien dem Komponisten zwar eine Fülle an neuen Mitteln zugewachsen, aber zugleich wesentliche Voraussetzungen der Formbildung verlorengegangen.[5] Nach einer Phase der kurzen Formen und der Vokalmusik, in der der Komponist sich vor allem auf sein (an tonaler Musik geschultes, in der freien Atonalität nur mehr unterbewusstes) »Formgefühl« angewiesen sah[6] und seinen musikalischen Gedanken vielfach durch die Bezugnahme auf einen Text eine Form gab, sei es notwendig geworden, das, was zuvor instinktiv als richtig erkannt worden sei, auch theoretisch neu zu fundieren.[7] Die zwangsläufige Folge sei die Komposition mit zwölf Tönen gewesen.[8]
Datum des | Titel | Zitation im |
1965 | »Über das Analysieren Neuer Musik. Zu Schönbergs Klavierstücken opus 11, Nr. 1 und opus 33a« | Dahlhaus 1965 |
1967 | »Schönberg und Bach« | Dahlhaus 2005g/GS8 |
1967 | »Schönbergs Lied ›Streng ist uns das Glück und spröde‹« | Dahlhaus 2005h/GS8 |
1968 | Schönberg, Variationen op. 31 | Dahlhaus 2005f/GS8 |
1968 | »Emanzipation der Dissonanz« | Dahlhaus 2005i/GS8 |
1973–74 | »Schönberg und Schenker« | Dahlhaus 2005j/GS8 |
1974 | »Adornos Begriff des musikalischen Materials« | Dahlhaus 2005c/GS8 |
1976 | »Schönbergs musikalische Poetik« | Dahlhaus 2005k/GS8 |
1984 | »Abkehr vom Materialdenken?« | Dahlhaus 2005e/GS8 |
1984 | »Schönbergs ästhetische Theorie« | Dahlhaus 2005l/GS8 |
1985 | »Geschichte und Geschichten« | Dahlhaus 2005b/GS8 |
1986 | »Das Verhältnis zum Text. | Dahlhaus 2005m/GS8 |
Abbildung 1: Veröffentlichungen von Carl Dahlhaus zu ›Emanzipation und der Dissonanz‹ und Verwandtem
Diese stark teleologische Darstellung ist von Carl Dahlhaus in einer Reihe von Aufsätzen zwischen 1965 und 1988 (Abb. 1) zunächst nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden. So war ihm noch 1968 die Überzeugung, dass Schönberg mit der ›Emanzipation der Dissonanz‹ »die Tonalität aufhob«, als geschichtliche Tatsache (und nicht als individuelle Setzung) so selbstverständlich, dass er ihr in seiner Analyse von op. 31 nicht mehr als einen Nebensatz einräumte.[9] Und die Auffassung, dass in der Zwölftontechnik wesentliche kompositionsgeschichtliche Tendenzen von Bach über Haydn und Beethoven bis zu Wagner konvergieren, begründete er ein Jahr zuvor – in »Schönberg und Bach« – anhand einer Vertiefung von Argumenten, mit denen Schönberg und von ihm ausgehend Adorno den Gültigkeitsanspruch der Dodekaphonie zu untermauern suchten:[10] »Die Affinität der thematisch-motivischen Arbeit zum Kontrapunkt, der Umschlag differenzierter Harmonik in Polyphonie und die Behandlung von Akkorden als Motive«.[11]
Und doch scheint Dahlhaus an der uneingeschränkten Gültigkeit dieser Darstellung frühzeitig gezweifelt zu haben. So widmete er bereits 1966 der »Emanzipation der Dissonanz«[12] einen Beitrag, in dem er die von Schönberg behauptete »Fasslichkeit« der ›emanzipierten Dissonanz‹ zwar ihrer Eigenschaft als isoliertem Klang zugestand, nicht aber ihrer Funktion im Kontext. Das Problem der ›emanzipierten Dissonanz‹ sei nicht ihr mehr oder weniger konsonanter (und »fasslicher«) Klang, sondern ihre Konsequenzlosigkeit im satztechnischen Kontext.[13] Und die Lösung dieses Problems sei »eines der treibenden Momente bei der Entwicklung der Reihentechnik gewesen«.[14] Kompositionstechnische Tendenzen der sogenannten Freien Atonalität wie die chromatische Komplementarität oder die Auffassung von Akkorden als Motive (die ebenso horizontal wie vertikal erscheinen könnten) gehörten vor allem deshalb zur Vorgeschichte der Dodekaphonie, weil sie auf eine Lösung dieses Problems hinarbeiteten. Die Schwierigkeit aber – und hier rückt Dahlhaus von seiner noch vergleichsweise affirmativen Position in »Schönberg und Bach« ab –, »dass emanzipierte Dissonanzen folgenlos sind oder zu sein scheinen, blieb [selbst in der Dodekaphonie] bestehen; sie hatte durch den Gedanken, Akkorde als harmonische Motive zu behandeln, zwar an Dringlichkeit verloren, war aber nicht restlos aufgehoben oder gleichgültig geworden.«[15] Die Skepsis gegenüber der Dodekaphonie als partiellem Tonalitätsersatz wurde 1974 (in »Schönberg und Schenker«) noch deutlicher: Die Bedeutung der emanzipierten Dissonanz für den musikalischen Zusammenhang, so heißt es dort, sei das Problem, »das ihn [Schönberg] in der Periode der freien Atonalität bedrängte und für dessen Lösung er später – wohl zu Unrecht – die Dodekaphonie hielt.«[16]
Damit ist eine Relativierung und ästhetische Kontextualisierung der Position Schönbergs eingeleitet, die mit dem Beitrag Schönbergs musikalische Poetik (1976) näher ausgeführt wird: Schönbergs Entscheidungen sind für Dahlhaus nun nicht mehr (wie noch für Adorno) Entscheidungen eines Genies, das das historisch Notwendige ausführt, sondern Entscheidungen auf der Basis einer (individuellen) Poetik, verstanden als »Inbegriff geschichtlich geprägter Prinzipien und Kategorien, die das musikalische Denken eines Komponisten fundierten.«[17] Die damit ausgesprochene Distanzierung von Adornos »Tendenz des Materials«, an deren historischer Relevanz Dahlhaus noch 1966 keine ernsthaften Zweifel zeigte[18], wird bereits 1974 in einem Beitrag für Eggebrechts »Terminologie der Musik im 20. Jahrhundert« deutlich: Was Adorno als »Stand des Materials« bezeichne und mit einem nahezu universellen Geltungsanspruch ausstatte, sei letztlich »nichts anderes als der Inbegriff der Spuren früherer Werke in den Tonzusammenhängen, in denen sich das musikalische Denken eines Komponisten bewegt.«[19] In den 1980er Jahren schließlich, als sich Dahlhaus von der Vorstellung eines dominierenden »Hauptstrom[s]« der kompositionsgeschichtlichen Entwicklung endgültig zu distanzieren begann[20], erkannte er sowohl den Schritt in die Atonalität als auch die Dodekaphonie als »Gewaltstreich[e]«[21] – als (»strenggenommen unbegründbar[e]«) Entscheidungen eines autonomen künstlerischen Subjekts, deren historische Tragweite zwar sofort erkannt wurde[22], die aber weder historisch notwendig waren noch selbst aus der kompositorischen Entwicklung Schönbergs zwingend hervorgingen.[23] Und er bekannte freimütig, dass ihm als Historiker dieses Zugeständnis schwerfalle.[24]
Der nunmehr unübersehbare historische Abstand zur Position Schönbergs, zugleich aber der unbedingte Anspruch des Historikers, diese verstehen zu wollen, finden ihren Niederschlag im Titel und Gegenstand seines Beitrags: »Schönbergs ästhetische Theologie.«
All diese Korrekturen sind nicht Ergebnis einer wachsenden Einsicht in die kompositorischen Problemstellungen, die sich aus einer intensiven analytischen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand ergeben hätte.[25] Sondern es sind Versuche, ein satztechnisch einmal ›begriffenes‹, aber offenbar zunächst überbewertetes Phänomen theoriegeschichtlich, ästhetisch und historiographisch zu kontextualisieren und damit eine vermeintliche kompositionsgeschichtliche Notwendigkeit als das zu sehen, als was sie heute überwiegend verstanden wird: als individuelle, wenngleich folgenreiche Entscheidung.
Und sie sind immer auch kritische Stellungnahmen im jeweiligen institutionellen und geistesgeschichtlichen Umfeld: Für den jungen Dahlhaus sowie für seine Göttinger Kommilitonen Rudolf Stephan und Joachim Kaiser[26] wurde die Lektüre der 1949 publizierten Philosophie der Neuen Musik[27] zum selbstverständlichen und zunächst kaum hinterfragten Ausgangspunkt ihrer Beschäftigung mit der Zweiten Wiener Schule und der zeitgenössischen Musik[28] – dies auch in Abgrenzung gegenüber einem musikwissenschaftlichen Establishment, das – den gemeinsamen Lehrer Rudolf Gerber eingeschlossen[29] – vor 1945 ebenso zuverlässig seine ›Pflicht‹ getan hatte wie nach 1945, und dem das Bekenntnis zu Schönberg und zu Adorno[30] bis in die späten 1960er Jahre als der sicherste Weg galt, sich eine akademische Laufbahn zu verbauen.[31] Die Situation wendete sich schlagartig durch einen Generationswechsel zwischen 1965 und 1970, der deshalb besonders dramatisch verlief, weil, wie Dahlhaus in seinem letzten Interview anmerkte, eine ganze Generation kriegsbedingt ›ausfiel‹.[32]
Umgekehrt ist Dahlhaus’ allmähliche Distanzierung von der Perspektive Schönbergs und Adornos ab den 1970er Jahren ein Reflex auf aktuelle Entwicklungen in der zeitgenössischen Musik: auf das Aufbegehren einer jüngeren Komponistengeneration gegen den »Materialfetischismus« der ›alten‹ Avantgarde[33], auf die »Emanzipation der Konsonanz«[34], der Harmonie überhaupt, auf den zunehmenden oder vielmehr zunehmend sichtbaren Pluralismus in der Neuen Musik. Äußert Dahlhaus bereits 1978 in Darmstadt den Verdacht, dass die stillschweigende Prämisse des Musikhistorikers, es müsse jederzeit einen »Hauptstrom« der kompositorischen Entwicklung geben, »längst hinfällig ist«[35], so zwingt ihn die Auseinandersetzung mit den Theoretikern der sogenannten ›Posthistoire‹ schließlich endgültig zur Korrektur bzw. Historisierung eines Geschichtsbildes, das, wie er 1985 feststellt, allzu sehr vom Fortschrittsgedanken des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt war.[36] Hinter Adornos »Tendenz des Materials« verberge sich, so seine entwaffnende Diagnose von 1985, »nichts anderes als der musikalische Weltgeist«.[37]
II.
Wie bereits eingangs festgestellt, hat sich Dahlhaus mit der ›Emanzipation der Dissonanz‹ und mit der Harmonik der freien Atonalität analytisch nur ein einziges Mal schriftlich auseinandergesetzt: In dem auf der Darmstädter Frühjahrstagung von 1965 gehaltenen Vortrag Schönbergs Lied: Streng ist uns das Glück und spröde.[38] Gerade dieser Text aber lässt den Leser aufgrund der Vielzahl an theoretischen Fragen, die er aufwirft, in einer gewissen Ratlosigkeit zurück.[39]
Um so mehr scheint es legitim, hier nur den Passus zur ›emanzipierten Dissonanz‹ herauszugreifen. Von deren »Konsequenzlosigkeit«, wie in den späteren Schriften, ist dabei bezeichnenderweise noch keine Rede – im Gegenteil: Nimmt man Dahlhaus’ analytische Stichprobe beim Wort, so wird die Freiheit, die durch die ›Emanzipation der Dissonanz‹ gerade erst gewonnen ist, durch die Setzung eines alternativen Bezugssystems sofort wieder eingehegt.
Beispiel 1: Arnold Schönberg, op. 15/9, Streng ist uns das Glück und spröde, T. 1–4
Im ersten und letzten Akkord aus Beispiel 1 ist, so Dahlhaus, das Prinzip der Terzenschichtung durch eines der Quartenschichtung abgelöst. Demnach wären auch die Halbtonbewegungen der Oberstimme in den Takten 2 und 4 reale Vorhalte, mit denen sich eine übermäßige Quarte in eine reine auflöst; der Akkord in Takt 4 ist insofern ›konsonanter‹ als der in Takt 2, als er ausschließlich aus reinen Quarten besteht. Beides zusammen aber lässt eine Interpretation der beiden Zweitakter als Vordersatz und Nachsatz zu. Die Analyse kann sich auf das vorletzte Kapitel in Schönbergs Harmonielehre stützen, in dem dieser die vorsichtige Erwartung äußert, »daß vielleicht später ein Quartensystem (anfangs vielleicht das Terzensystem ergänzend) Chance hat, alle Vorkommnisse der Harmonie [d.h. auch die bisher ›harmoniefremden‹] zu erklären.«[40] Dass Schönberg den Passus, der bereits in der ersten Ausgabe durch den Kontext stark relativiert wird, aus der dritten Auflage ganz entfernt hat, verschweigt Dahlhaus; und er ist klug genug, das »Quartensystem« nicht anhand einer Analyse des gesamten Liedes durchdeklinieren zu wollen.[41]
Und doch ist die These durchaus naheliegend, dass Schönberg – bewusst oder unbewusst – dem mit der ›Emanzipation der Dissonanz‹ drohenden Chaos durch die Setzung alternativer Ordnungsprinzipien zumindest für die Dauer eines Werks eine Struktur zu geben versuchte. In welche Richtung diese neuen Ordnungsprinzipien zunächst u.a. tendierten, soll im Folgenden anhand des von Dahlhaus nicht besprochenen vorletzten Liedes aus Schönbergs op. 15 gezeigt werden.
Ausgangspunkt der Analyse sind drei Fragen, die sich einem Musiktheoretiker des 21. Jahrhunderts bei der Lektüre der Schönberg-Texte Dahlhaus’ aufdrängen:
Was genau heißt ›Emanzipation der Dissonanz‹ in dieser frühen Phase der Atonalität? Sind die betreffenden Klänge wirklich ›konsequenzlos‹? Oder gibt es, wie in der soeben referierten Analyse angedeutet, alternative Ordnungsprinzipien, in denen sie nicht nur ›harmonie-eigen‹, sondern auch kontextuell eingebettet sind, d.h. eine eigene Konsequenzlogik entwickeln?
Wie ist das Verhältnis zur Tonalität? Heißt »Emanzipation der Dissonanz«, wie von Schönberg behauptet und von Dahlhaus nie in Zweifel gezogen[42], automatisch auch »Verzicht auf ein tonales Zentrum«?[43] Oder gilt auch für diese Phase der frühen Atonalität, was Schönberg in Bezug auf die vagierende Harmonik des späten 19. Jahrhunderts sagte, dass nämlich »die Herrschaft [des] Grundtons immer mehr bloß gedanklich nachweisbar und immer weniger sinnlich wahrnehmbar« ist?[44]
Ist Dodekaphonie zwangsläufige Folge dieses kompositionsgeschichtlichen Moments? Oder hätte die kompositorische Entwicklung um 1909, wie der späte Dahlhaus einräumte, für Schönberg auch andere Optionen offen halten können?
Da es nicht um punktuelle, sondern um strukturelle Ordnungsprinzipien geht, wird die Analyse notwendig das Lied als Ganzes in den Blick nehmen müssen, d.h. es werden auch Aspekte zu klären sein, die nur mittelbar mit der skizzierten Fragestellung zu tun haben.
III.
1 | Sprich nicht immer |
2 | Von dem laub |
3 | Windes raub |
|
|
4 | Vom zerschellen |
5 | Reifer quitten |
6 | Von den tritten |
7 | der vernichter |
8 | spät im jahr. |
|
|
9 | Von dem zittern |
10 | Der libellen |
11 | In gewittern |
12 | Und der lichter |
13 | Deren flimmer |
14 | Wandelbar. |
Abbildung 2: Stefan George, Das Buch der Hängenden Gärten, [Sprich nicht immer]. Betonungen (fett) und ›Strophen‹-Gliederung
Georges Gedicht[45] (Abb. 2) ist eine Paralipse: Das mit der ersten Zeile eingeklagte Redeverbot wird durch die anschließende Auflistung dessen, von was nicht mehr die Rede sein soll, wortreich durchbrochen. Der Tonfall ist bereits durch die Anfangszeile mit dem dreimaligen ›i‹ und drei Zischlauten auf ein ängstliches Flüstern festgelegt. Ab der vierten Zeile sind die i- und e-Reime endgültig in der Überzahl. Da der Akzent in all diesen Zeilen auf der dritten Silbe liegt, erzeugen die Zeilen 3, 8 und 14 mit ihrem Akzent auf der ersten Silbe und ihrer stumpfen und ›dunklen‹ Endung eine Zäsur; sie klingen in der Pause nach, ›geben zu denken‹ und betonen genau jene Vergänglichkeit, von der eigentlich nicht die Rede sein sollte.[46] Die drei Teilsätze, die auf diese Weise voneinander abgesetzt werden, wachsen durch sukzessive syntaktische Anlagerungen von drei bis auf sechs Zeilen an.
Beispiel 2: Arnold Schönberg, 15 Gedichte aus »Das Buch der hängenden Gärten« von Stefan George für eine Singstimme und Klavier op. 15/14 (»Sprich nicht immer von dem Laub«), Singstimme.
Schönbergs Singstimme (Bsp. 2) hält sich sowohl hinsichtlich des Rhythmus als auch der Kontur eng an die Textvorlage. Schönberg verlagert jedoch den Beginn des dritten Teils von der neunten in die zwölfte Zeile bzw. von Takt 7 nach Takt 9 – erkennbar nicht nur an der Pause, sondern auch an einer zunächst vor allem rhythmischen Korrespondenz zwischen Takt 2.2–3 und T. 10–11.1 Diese Dreiteiligkeit bestätigt sich beim Blick auf die Kontur: Die Takte 2–3 und 9–11[47] beginnen fallend von einem gedehnten Hochton (mit oder ohne Auftakt) und enden nahezu gleich[48]; die Takte 4–8[49] bilden als zweifaches Ab und Auf und großer, im Gerüst fast durchweg chromatischer Abgesang eine Einheit (siehe die Rhomben in Bsp. 2).[50] Die Hochtöne aller drei Teile fallen auf Silben, die mit ›-ich‹ bzw. ›–icht–‹ enden. Nimmt man das ›nicht‹ in Takt 2 hinzu[51], so ergibt sich eine chromatisch absteigende Reihe von Hochtönen (siehe die Einkreisungen in Bsp. 2).[52]
Beispiel 3: Arnold Schönberg, op. 15/14, der Hauptgedanke und dessen nächstliegende Varianten
Beispiel 4: Arnold Schönberg, op. 15/14, entferntere Varianten des Hauptgedankens
Ausgangspunkt der Klavierstimme ist der in Takt 1 exponierte, aus Arpeggio und Vorhalt zusammengesetzte Hauptgedanke (Bsp. 3).[53] Während die drei nächstliegenden Varianten – Takt 3, 6.2 und 11 – jeweils zäsursetzende Zeilen des Gedichts begleiten[54], schließen sich die entfernteren Varianten in den Takten 4–5 und 7–8 (Bsp. 4) zu sequenzartigen Reihungen zusammen, wie man dies aus klassischen Mittelteilen kennt. Mit der Zäsur in Takt 8 wird eine Phase der Erstarrung und des Innehaltens eingeleitet, die erst mit der Wiederanknüpfung an den Beginn in Takt 11 aufgelöst wird. Damit bestätigt sich die an der Singstimme beobachtete Dreigliederung als Exposition, verarbeitender Mittelteil, spannungsvolles Innehalten und (veränderte) Rückkehr zum Ausgangspunkt.
Was nun die Harmonik als den für unsere Fragestellung zentralen Aspekt betrifft, so zeigt bereits die Zusammensetzung des Hauptgedankens aus Arpeggio und Vorhalt, dass mit einer Verwurzelung in satztechnischen Denkweisen der durmolltonalen Tradition prinzipiell zu rechnen ist.
Geht man zunächst von den abstrakten intervallischen Vorgaben aus, so ist der Vorhalt (s. die gestrichelten Balken in Bsp. 3) durchweg halbtönig fallend, während das Arpeggio in zwei Teilkomponenten mit je eigener Intervallgröße zerfällt (s. die durchgezogenen Balken). Die Komponente mit den größeren Intervallen liegt dabei zumeist ›unten‹.[55] Von den drei nächstliegenden Varianten des Hauptgedankens (T. 3, T. 6.2 und T. 11) beginnt die in Takt 11 – wie Takt 1 – mit ungleichen Septimen; die Varianten in Takt 3 und Takt 6.2 schichten kleine Septimen aufeinander, so dass sich eine ganztönige Komponente durchsetzt, in der der Vorhalt tatsächlich ›fremd‹ ist. Zugleich suggeriert Takt 3 eine auf d, Takt 6 eine auf e bezogene Dominante[56], in der der Vorhalt (fis-f bzw. gis-g) als spätromantische Tredezime erscheint.
Dass die Auflösung zwingend wäre, lässt sich in diesem stilistischen Kontext kaum behaupten; erst durch die motivische Behandlung des fallenden Halbtons rückt eine Interpretation als Vorhalt und Auflösung[57] in die Nähe einer Erwartungshaltung. Ähnlich wird man auch den Eintritt der Singstimme in Takt 2 als Nonvorhalt in D-Dur wahrnehmen, so dass rückwirkend auch das b2-a2 des Klaviers in Takt 1 als Vorhalt zum Quintton interpretierbar wird.
Spricht also eine ganze Reihe tonaler Relikte in den Takten 1–3 für eine zumindest gedankliche Zentrierung um d, so zeigt sich andererseits eine deutliche Tendenz, diese Zentrierung durch konkurrierende Ordnungsstrukturen zu relativieren. Tatsächlich scheint Schönberg seine ›Tonika‹ sogar dezidiert durch ihre halbtönigen Nachbarn zu umschatten bzw. zu verdrängen:[58] so gegen Ende von Takt 2, wo der Ton d durch es und des ›umschrieben‹ (und vermieden) wird, sowie zu Beginn von Takt 4, wo er ›fällig‹ wäre, aber von es bzw. dis und cis nahezu symmetrisch umstellt (und verdeckt) wird.[59] Was aber zunächst als ›bestimmte Negation‹ erscheint, lässt sich auch als Überlagerung eines latent tonalen Gerüsts durch symmetrische Ordnungsstrukturen beschreiben (Bsp. 5):
Beispiel 5: Arnold Schönberg, op. 15/14, T. 2–4 mit Markierung des ganztönigen Feldes; Dreieck: Nicht-Bestandteil des ganztönigen Feldes
Es und cis sind zugleich Teil eines ganztönigen Feldes, das von der alterierten Dominante in Takt 3 auf deren unmittelbares Umfeld ausstrahlt und das nur durch die (in Bsp. 5 als Dreieck markierten) Töne fis2, d und gis1 durchbrochen wird.[60] Ähnlich ist das vorübergehende D-Dur in Takt 2 in einen harmonischen Kontext eingebettet, der im Wesentlichen durch die Kleinterzachse c-a-fis-es bestimmt ist (Bsp. 6).[61]
Beispiel 6: Arnold Schönberg, op. 15/14, T. 1–3; Kleinterzachse A-C-Es-Fis (weiße Markierung), Dreieck: Nicht Bestandteil der ›octatonic collection‹ A-H-C-D-Es-[F]-Fis-As.
Auch die Singstimme akzentuiert hier sowie im folgenden ganztönigen Segment die beiden gemeinsamen Töne a und es. Jeder der beiden Töne erscheint zunächst in Begleitung seines halbtönigen, dann seines ganztönigen unteren Nachbarn.[62]
Geht man davon aus, dass zu Beginn des Liedes neben dem thematischen Hauptgedanken auch die harmonische Struktur vorgegeben wird, so wäre diese vorläufig dahingehend zu charakterisieren, dass eine latente Tonika D durch ihre halbtönigen Nachbarn Es und Cis beschattet und durch zwei Formen der symmetrischen Oktavteilung in ihrem Einfluss zurückgedrängt wird, die sich im Quintton a und dem mit ihm tritonusverwandten es berühren.[63] Die aus tonaler Sicht störenden Komponenten (es und cis) sind mithin tragende Komponenten symmetrischer Strukturen, in denen umgekehrt der Ton d entweder nachrangig[64] oder ›fremd‹ ist.[65]
Die Takte 4–8, die als Mittelteil fungieren, werden durch Konstellationen der Töne cis, d und es (bzw. dis) umrahmt und geteilt (s. die Umrahmungen in Bsp. 7); dabei wird der Ton d in den Takten 8–9 und in Takt 4 durch cis und es umkreist (und damit strukturell zurückgedrängt), während er zu Beginn von Takt 6 (als Scheitelpunkt des Mittelteils) klanglich kaum zu identifizieren ist. Die Stelle trennt in der Klavierstimme zwei äquidistanziale Strukturen, die sich im Ton es berühren: Den Kleinterzzirkel es-c-A-Ges-Es, und den Großterzzirkel Es-H/h1-g1-es1 (s. die in Bsp. 7 eingekreisten bzw. umrahmten Töne).[66] Der Wechsel zwischen den Terzachsen wird durch eine der beiden ›dominantischen‹ Varianten des Hauptgedankens markiert (T. 6).[67]
Beispiel 7: Arnold Schönberg, op. 15/14, T. 4–9
Die Singstimme, die diese Terzstrukturen nur bedingt unterstützt, akzentuiert zunächst die strukturell tragenden Töne es, d, a und cis[68]; cis wird schließlich Ausgangspunkt des benannten, überwiegend chromatischen, aber ganztönig akzentuierten ›Oktav-Zuges‹, der – ähnlich wie die Klavierstimme – d als ›eigentlichen‹ Zäsurton des Mittelteils (T. 8.6) überspielt.
Der Begriff der ›emanzipierten Dissonanz‹ ist hier, wo die Tonika so dezidiert beschattet und zurückgedrängt wird und wo tonale Bezüge – abgesehen von Takt 6.2 – keine Rolle mehr spielen, durchaus wörtlich zu verstehen: Angesichts eines überwiegend zweistimmigen, nur noch selten akkordischen Tonsatzes, der überwiegend von Nonen, Septimen und Quarten geprägt ist, scheint eine traditionelle Hörweise – beispielsweise der hier eingekreisten Vorhalte – kaum mehr plausibel. Dagegen kristallisieren sich zumindest in der Klavierstimme überraschend klare symmetrische Strukturen heraus: Die Halbtonganztonskala, die sich in Takt 5.2 um die Kleinterzachse herum anlagert, beeinflusst bereits das Arpeggio in Takt 5.1.[69] Ähnlich bewegt sich die Großterzsequenz in den Takten 7–8 in einem neuntönigen ›Set‹, das Messiaens Modus 3 entspräche.[70] Die nicht-ganztönigen Töne der Singstimme stehen zu dieser Struktur allerdings ebenso quer wie der Quartolenrhythmus, in dem sie vorgetragen werden. Es scheint also, als habe Schönberg in einer satztechnischen Situation, in der die traditionellen Unterscheidungen zwischen Konsonanz und Dissonanz irrelevant geworden sind, bewusst oder unbewusst einen gewissen Halt in symmetrischen Strukturen gesucht, ohne dass er sich diesen Strukturen vollständig hätte ausliefern mögen.[71]
Der Schluss (T. 9–11) fokussiert in der Klavierstimme nochmals die Anfangskonstellation Es-D-A (entsprechend den drei Anfangstönen der Singstimme) in unterschiedlichen ›Funktionen‹: Als Zusammenklang, in dem die linearen Bezüge vorübergehend ruhen bzw. erstarren (T. 9), und als Variante des Hauptgedankens, d.h. als Arpeggio und Vorhalt, womit die strukturellen Hierarchien zwischen A, Es und D wenigstens auf dem Papier abschließend geklärt wären (T. 11). In der Singstimme, die in komplexer Weise auf ihren Anfang Bezug nimmt, ragen die gedehnten Töne c2 und b1 auch dadurch heraus, dass sie bis dahin weitgehend unverbraucht sind. Wie zu Beginn spielen auch hier versteckte tonale Bezüge eine Rolle: c2 entspräche in tonaler Musik, gerade in seiner ›Harmonisierung‹ durch die Strukturtöne d, a und es, einer ›Abschiedsseptime‹, b1 könnte vor diesem Hintergrund als Vertreter einer Mollsubdominante aufgefasst werden[72], und der davon ausgehende übermäßige Dreiklang repräsentiert die Tonika ebenso wie a-cis-f in Takt 3 die Dominante.
Dass diese tonalen Bezüge nur eingeschränkt zur Geltung kommen, verdankt sich in Takt 9 der Tatsache, dass der Ton d (der ja, als ›Fundament‹, die ›Abschiedsseptime‹ erst zu einer solchen macht) nach wie vor durch seine Nachbartöne verdeckt ist[73] und in Takt 11 der Art, wie der übermäßige Dreiklang der Singstimme in eine Reprise des Hauptgedankens eingebunden und zumindest ein Stück weit verdeckt wird.[74]
Resümee
Was also heißt ›Emanzipation der Dissonanz‹ konkret? Was hat es mit dem behaupteten ›Verzicht auf ein tonales Zentrum‹ auf sich? Und was unternimmt Schönberg, um den Wegfall der tonalen Ordnungsstrukturen auszugleichen?
Was zunächst die Emanzipation der Dissonanz betrifft, so erleben wir die Dissonanz hier eher im Prozess als im Zustand der Emanzipation, d.h. in einem Stadium, in dem die Anwendung des Begriffes (›Emanzipation der Dissonanz‹) eigentlich erst bzw. noch sinnvoll ist (siehe die Behandlung des Vorhalts in den verschiedenen Versionen des Hauptgedankens). Ähnliches gilt für das ›tonale Zentrum‹ D, das zwar ›gedanklich‹ vorhanden und strukturell wirksam, aber über weite Strecken als solches nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar ist. Exemplarisch für beide Befunde sei hier auf die Ambiguität des Tons es verwiesen: einerseits – vor allem in den Rahmenteilen – nach wie vor Vorhalt zur ›Tonika‹ D und in dieser Funktion ›gerade noch‹ nachvollziehbar, andererseits – vor allem im Mittelteil – Schnittstelle dreier Strukturen, in denen die Tonika ihrerseits ›fremd‹ ist: zweier symmetrischer Terzachsen und eines ›Zentralklangs‹, der sich aus den beiden Nachbartönen der ›Tonika‹ zusammensetzt (in dem diese als ›fremder‹ bzw. strukturell nachrangiger Ton gleichwohl präsent ist). Der Gefahr der ›Konsequenzlosigkeit‹ der emanzipierten Dissonanz und der durch sie verursachten Orientierungslosigkeit ist sich Schönberg also sehr wohl bewusst. Was er jedoch dagegen unternimmt, lässt sich kaum als ›Vorgeschichte der Reihenkomposition‹ vereinnahmen.[75] Im Gegenteil: Die Tendenz, einige Töne besonders hervorzuheben, nicht nur vertikal (durch Oktavierung), sondern auch linear, gehört aus Sicht der Dodekaphonie zu den ›tonalen Relikten‹, die es zu überwinden gilt. Vielmehr scheint Schönberg hier vorübergehend an einer allgemeinen Tendenz zur Polyzentrik, zur symmetrischen Oktavteilung und zum Zentralklang zu partizipieren, die seinerzeit in Europa überall dort zum Durchbruch kommt, wo man sich der Brüchigkeit der durmolltonalen Ordnung bewusst wurde – einer Tendenz freilich, deren Wurzeln weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen. So scheinen sich im vorliegenden Fall die beiden Terzachsen, die immerhin sieben von elf Takten des Liedes strukturell bestimmen, als Alternativen zu einer tonalen Struktur mit Zentrum D förmlich aufzudrängen. Die freie Art aber, in der Schönberg mit diesen Strukturen umgeht, und der Höreindruck sprechen eher dagegen, diesen Strukturen eine ähnlich bestimmende Rolle beizumessen, wie man dies bei Bartók, Ravel oder Strawinsky gleichzeitig oder wenig später beobachten kann.[76] Eher scheint es sich um den Versuch zu handeln,
im Grenzgebiet zwischen schwebender Tonalität und freier Atonalität Ordnungsstrukturen zu bewahren, die – als symmetrische[77] –noch nicht im gleichen Maße ›verbraucht‹ sind wie die Durmolltonalität,
diese Strukturen an einem gleichsam ›verschwiegenen‹ tonikalen Zentrum d auszurichten, das insofern ›negativ‹ wirksam ist, als das strukturelle Gerüst nicht nur des Mittelteils wesentlich durch dessen chromatische Nachbartöne es und cis bestimmt ist.
Letztlich handelt es sich um die bestimmte Negation einer um D zentrierten Tonalität, darin möglicherweise Analogon zur Figur der Paralipse, die die dichterische Vorlage kennzeichnet.
Anmerkungen
Dahlhaus 2005i/GS8. | |
Dahlhaus 1965. | |
Schönberg 1976a. Ähnlich bereits in Schönberg 1976b. | |
Vgl. Schönberg 1976a, 74: »Ein Stil, der auf dieser Voraussetzung beruht [›Emanzipation der Dissonanz‹], behandelt Dissonanzen genauso wie Konsonanzen und verzichtet auf ein tonales Zentrum.« | |
Vgl. ebd., 74. | |
Vgl. Webern 1960b, 52: »Er hatte es als Lehrer furchtbar schwer: das rein Theoretische hatte aufgehört. Auf rein intuitivem Wege hatte er, unter furchtbaren Kämpfen, mit seinem ungeheuren Formgefühl gespürt, was nicht stimmt.« | |
Vgl. Schönberg 1976a, 75. | |
Ebd., 73: »Die Methode, mit zwölf Tönen zu komponieren, erwuchs aus einer Notwendigkeit.« Schönbergs Begründung ist allerdings fragwürdig: 1. Die Behauptung, die Reihe verhindere die zu frühe Wiederholung einzelner Töne (und damit deren Akzentuierung bzw. Tonikalisierung, vgl. ebd., 76), ist durch die kompositorische Praxis der Zweiten Wiener Schule hinlänglich widerlegt worden. 2. Dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen Horizontale und Vertikale nur durch die »Einheit des musikalischen Raumes« (d.h. indem beiden dieselbe Reihe zugrunde liegt, ebd., vgl. 77–79) hergestellt werden könne (und nicht ebenso gut durch Kontrast), ist teils Niederschlag der individuellen kompositorischen Erfahrung, teils Ideologie, aber alles andere als kompositionsgeschichtliche Notwendigkeit. Vgl. hierzu kritisch Adorno 1978, 147. | |
Vgl. Dahlhaus 2005i/GS8, 636. | |
Vgl. Schönberg 1976c und Adorno 1978. | |
Dahlhaus 2005g/GS8, 653. Hinsichtlich des zweiten Arguments (»Umschlag differenzierter Harmonik in Polyphonie«) verweist Dahlhaus auf die Tristanharmonik, in der gerade die komplexesten (und dissonanzreichsten) Akkorde aufgrund des nach wie vor bestehenden Auflösungsbedürfnisses »Stimmen aus sich hervortreiben, deren Verhältnis zueinander […] als Kontrapunkt erscheint.« (ebd.) Er paraphrasiert damit – abgesehen vom expliziten Wagner-Bezug – im Wesentlichen eine Passage aus Adorno 1978, 150f. Als Beispiele für eine vordodekaphone »Behandlung von Akkorden als Motive« nennt Dahlhaus Schönbergs op. 11 sowie (ohne Beleg) Wagner (vgl. Dahlhaus 2005g/GS8, 653). | |
Dahlhaus 2005g/GS8. Der Beitrag erschien in einer Festschrift zum 65. Geburtstag von H.H. Stuckenschmidt (1.11.1966), dürfte also im Wesentlichen 1966 entstanden sein. | |
Während die traditionelle Dissonanz bekanntermaßen in den Kontext eingreift, indem sie ihm ihre kontrapunktische Fortschreitungslogik aufzwingt (vgl. Dahlhaus 2005f/GS8, 668). | |
Dahlhaus 2005f/GS8, 672. | |
Ebd. | |
Dahlhaus 2005j/GS8, 681. Vgl. auch Dahlhaus 2007a/GS10, 538. | |
Dahlhaus 2005k/GS8, 679. (Hervorhebung V.H.) Die Notwendigkeit, die ›Emanzipation der Dissonanz‹ vor dem Hintergrund von Schönbergs Poetik zu sehen, deutet Dahlhaus bereits im letzten Absatz in Dahlhaus 2005i/GS8 an. | |
Vgl. Dahlhaus 2005a/GS8, 18. | |
Dahlhaus 2005c/GS8, 279. Vgl. auch Adornos Replik auf eine Kritik an seinem Materialbegriff, wiedergegeben in Dahlhaus 2007d/GS10, 552. | |
Vgl. etwa Dahlhaus 2005b/GS8. Dass allerdings »die Vorstellung der einen, unteilbaren Geschichte, die in den fünfziger Jahren das Bezugssystem sowohl historischer als auch ästhetischer Urteile bildete, den Tendenzen oder Stimmungen der sogenannten Posthistoire wirklich zum Opfer fallen sollte«, stand für Dahlhaus »einstweilen nicht eindeutig« fest (ebd., 165). | |
Dahlhaus 2005l/GS8, 728. Die Formulierung bedarf zumindest in Bezug auf die freie Atonalität einer Relativierung: Denn der Schritt in die sogenannte Atonalität ist zunächst eher ein weiteres Stadium in der Entwicklung der sogenannten »schwebenden Tonalität«. Vgl. hierzu Webern 1960a, 40f. | |
Vgl. Dahlhaus 2005l/GS8, 729. | |
Zwei Jahre später schwenkt der Dahlhaus in einem anderen Punkt auf Schönbergs Argumentationslinie zurück und behauptet, »dass jedenfalls die Strukturprobleme, die durch die Emanzipation der Dissonanz entstanden waren, durch die Dodekaphonie gelöst wurden […]« (Dahlhaus 2005m/GS8, 746; vgl. das obige Zitat aus Dahlhaus 2005j/GS8, Anm. 16). Der ›Widerspruch‹ zwischen den Äußerungen würde sich auflösen, wenn man davon ausgeht, dass Dahlhaus unterscheidet zwischen Struktur einerseits – Zwölftonstruktur als ›Rechtfertigung‹ der kompositorischen Einzelentscheidung – und musikalischem Zusammenhang andererseits. Vgl. hierzu Schönberg 1957, 189: Einerseits rechtfertige die Logik der Reihe die Fortschreitung (insofern Akkorde vertikale Projektionen der Reihe sind), andererseits stehe eine Wertung dieser quasi-harmonischen Fortschreitungen noch aus; sie sei aber mehr Sache des Lehrers als des Komponisten. | |
Vgl. Dahlhaus 2005l/GS8, 729. | |
Jedenfalls lässt sich eine solche Auseinandersetzung aus seinen Veröffentlichungen nicht entnehmen: Abgesehen von Dahlhaus 2005h/GS8, der sich u.a. – und noch sehr affirmativ – zur ›emanzipierten Dissonanz‹ äußert, spielen diese Fragen in seinen analytischen Texten kaum eine Rolle. | |
Kaiser begann seine publizistische Laufbahn mit einer Rezension der Philosophie der Neuen Musik (1951), Stephan nimmt in seinem Band Neue Musik: Versuch einer kritischen Einführung (1958) Bezug auf Adorno. | |
Vgl. Dahlhaus 2007d/GS10, 549. Seit seiner Rezension der Dissonanzen (1957) war Dahlhaus Adorno in einer Beziehung verbunden, »die freundschaftlich zu nennen weit übertrieben wäre, die aber immerhin eine gewisse Kontinuität und Substantialität hatte« (ebd.). Adorno soll unmittelbar vor Dahlhaus’ Wechsel von Saarbrücken nach Berlin (1967) dessen Berufung nach Frankfurt betrieben haben (vgl. Stephan 2011, 23). | |
Siehe Nyffeler 2001. | |
Rudolf Gerber, bei dem neben Dahlhaus, Kaiser und Stephan auch Ludwig Finscher und Walter Gieseler studierten, hatte zwischen 1939 und 42 mit Herbert Gerigk und dessen Hauptstelle Musik im Amt Rosenberg zusammengearbeitet und 1939 die Musikgeschichte zum »Anschluss« Österreichs geschrieben (»Die Musik der Ostmark«), die Fred Prieberg mit der Bemerkung zitiert, der »tschechische Ghetto-Jude Gustav Mahler habe, als erster Hauptvertreter des internationalen Judentums, eine Ära des Zerfalls« eingeleitet (Gerber 1939/40, 77–78, hier zitiert nach Prieberg 2004, Art. »Gerber«). Gerber soll sich über den jungen Dahlhaus beschwert haben, dieser »blicke immer so ›kritisch‹ drein während der Gerber’schen Hauptvorlesungen« (Kaiser 2011, 34). | |
Siehe hierzu Feurich 2004, 534f. | |
Siehe auch die Erinnerung Reinhold Brinkmanns (Nyffeler 2001). Abgesehen von Hans Heinz Stuckenschmidt (TU Berlin) waren die Zweite Wiener Schule und die Neue Musik in der westdeutschen Musikwissenschaft weder in den Seminaren in den offiziellen Organen in nennenswertem Umfang präsent (vgl. Stanley 2006, 241). Nyffeler 2001: »Jemand wie Adorno, der Schönberg verteidigte, wurde damals noch kaum gehört, zumindestens nicht in Musikwissenschaftler-Kreisen.« Er galt »den etablierten Musikforschern […] als journalistischer Propagandist einer glücklich längst überholten Musikrichtung« (Stephan 2011, 23). Die Dissertationen von Reinhold Brinkmann und Elmar Budde, beide 1967 bei Hans Heinrich Eggebrecht in Freiburg, und Dahlhaus’ Analyse von op. 31 in den Meisterwerken der Musik von 1968 (Dahlhaus 2005f/GS8) markieren hier einen Wendepunkt (vgl. Stanley 2006, 242). | |
Vgl. Dahlhaus 2007d/GS10, 557. Tatsächlich wurden in dieser Zeit gerade in Berlin einige ›progressive‹ Musikwissenschaftler berufen: Dahlhaus (TU 1967), Stephan (FU 1967), Brinkmann (FU 1970), Burde (HdK 1970), Budde (HdK 1972). Auch Ludwig Finscher, wenngleich ohne Schwerpunkt in der Neuen Musik, wurde 1968 nach Frankfurt berufen. Die vom Krieg dezimierte Generation ist zumindest durch Eggebrecht vertreten (Freiburg 1961), der über die Zweite Wiener Schule immerhin promovieren ließ (s.o.). | |
Spätestens 1978 und nochmals 1984 in Darmstadt. | |
Dahlhaus 2007b/GS10, 287. | |
In Bezug auf die Musik der 1960er Jahre in Dahlhaus 2007c/GS10, 517f. Vgl. aber bereits Dahlhaus 2005d/GS8, 310. | |
Vgl. Dahlhaus 2005b/GS8, 158f. | |
Ebd., 159. | |
Dahlhaus 2005/GS8. Die Darmstädter Frühjahrstagung von 1965 Musikhören – Musikdenken, Neue Wege der musikalischen Analyse, auf der der Text zum ersten Mal vorgetragen wurde, war mit dem Anspruch angekündigt worden, »zu zeigen […], inwieweit es möglich ist, den Gehalt der Kompositionen an deren Kompositionstechnik aufzuzeigen.« (Stephan 1967, 6) Doch sah sich Rudolf Stephan als Herausgeber zu der Vorbemerkung veranlasst, die in dem Band versammelten Analysen seien »weniger Modelle als Versuche« (ebd.). | |
Der Vortrag ist offensichtlich unter Zeitdruck entstanden. Abgesehen von der Arbeit an der Habilitationsschrift (1966) und der Monografie über Brahms’ 1. Klavierkonzert (1965) stand Dahlhaus auf derselben Frühjahrstagung noch mit dem Vortrag Zur Rhythmik in Beethovens Diabelli-Variationen auf dem Programm. Neben dem Versuch, das auf den ersten Blick ›unlyrische‹ Gedicht in die Liedästhetik Georges und seiner Zeit einzuordnen, geht es darin im Wesentlichen um die Exemplifikation genau jener, z.T. noch recht unscharf gefassten Termini aus der Musiktheorie Schönbergs, an deren Präzisierung sich Dahlhaus in den Folgejahren abarbeiten wird: »Entwickelnde Variation«, »Musikalische Prosa« (Dahlhaus 1965, 661f.) und »Emanzipation der Dissonanz«, sowie um Dahlhaus’ These vom »Akkord als Motiv« (ebd., 659), die in den späteren Schriften immer dort begegnet, wo es um die Vorgeschichte der Dodekaphonie geht. | |
Schönberg 1911, 446. | |
Er weist sogar selbst darauf hin, dass am Übergang von Takt 5 zu Takt 6 ein Klang, der aus der Perspektive der Quartenschichtung als ›Vorhaltsklang‹ zu sehen wäre (F-es-a-cis), als tonales Relikt die Aufmerksamkeit auf sich zieht, entsprechende tonale Konsequenzen fordert und damit die ›schöne neue Ordnung‹ ins Wanken bringt. Der Effekt ist allerdings hörend kaum nachvollziehbar: Zwar ist der Akkord bereits in der Wiener Klassik gängig; im betreffenden Kontext tritt er aber gegenüber der ›halbverminderten‹ Akkordkomponente der Oberstimmen (die Dahlhaus wohl – zusammen mit der chromatischen Stimmführung – den Tristanakkord assoziieren lässt) klar zurück. | |
Noch in Dahlhaus 2005l/GS8 sind »Atonalität« und »Emanzipation der Dissonanz« zwei Aspekte desselben gewaltsamen Vorgangs, der laut Dahlhaus in den »Ausnahmezustand«, ja – Schönbergs Gegner beim Wort nehmend – in die »Anarchie« führte (ebd., 728f.). | |
»Ein Stil, der auf dieser Voraussetzung [nämlich der ›Emanzipation der Dissonanz‹] beruht, behandelt Dissonanzen genauso wie Konsonanzen und verzichtet auf ein tonales Zentrum.« (Schönberg 1976a, 74) Die ersten Stücke in diesem neuen Stil aber seien 1908 von ihm und »bald darauf« von Webern und Berg geschrieben worden. | |
Schönberg 1976b, 210. Vgl. Webern 1960b, 52: »Ich habe zwar dann wieder ein Quartett geschrieben, das in C-Dur war – aber nur vorübergehend. Die Tonart, der gewählte Grundton, ist sozusagen unsichtbar – ›schwebende Tonalität‹! – Alles hatte aber noch Beziehung zu einer Tonart, vor allem am Schluss, um den Grundton herzustellen. Der Grundton selbst war aber nicht da – er war im Raume schwebend, unsichtbar, nicht mehr notwendig. Es hätte umgekehrt bereits gestört, wenn man sich wirklich auf den Grundton bezogen hätte.« | |
Als vorletztes im Zyklus geht das Gedicht der Trennung der Liebenden und ihrer Vertreibung aus dem Paradies der Hängenden Gärten unmittelbar voraus. | |
Klanglich sind sie einerseits durch den Reim zwischen spät im Jahr und wandelbar, andererseits durch Alliteration zwischen »Windesraub« und »wandelbar« aufeinander bezogen. – Rhythmisch ambivalent sind nur die erste und fünfte Zeile (»Sprich nicht immer« und »Reifer Quitten«). Die Anfangszeile, in der die erste und dritte Silbe etwa gleich stark sind, ist als ganze ›auftaktig‹. | |
Entsprechend Zeile 1–3 und 12–14. | |
Sie heben also die Alliteration zwischen »Windesraub« und »wandelbar« hervor. | |
Zeilen 4–11. | |
Das Absetzen der drei letzten Zeilen durch die Fermate auf »Lichter« ist auch rhetorisch motiviert: Nur so werden diese Zeilen, die ja sprachlich nur das letzte Glied eines übergreifenden Parallelismus sind, als Schluss überhaupt erst erfahrbar. Das letzte Wort »wandelbar« erhält so die Markierung, die es braucht, um nachzuwirken. | |
Weitere ›-ich-‹-Silben gibt es nicht. | |
Zwischen cis2 in Takt 6 und c2 in Takt 9 vermittelt der benannte chromatische Oktavzug cis2–cis1. | |
Er korrespondiert mit dem ersten Takt der Singstimme über eine rhythmische Vertauschung und Umkehrung der Bewegungsrichtung. – Indem vor allem der Rhythmus der ersten Takthälfte im weiteren Verlauf sehr prominent ist (vor allem in der Singstimme), erhält das Lied – singulär im gesamten Zyklus – einen mitunter tänzerischen, walzerartigen Einschlag – eine Konnotation, die der Position des Liedes im Zyklus (im Sinne eines letzten Tanzes vor der Trennung und Vertreibung) durchaus angemessen erscheint. Variabel ist vor allem das Verhältnis zwischen den Teilmotiven: Mal ist der Vorhalt Teil (und Ziel) des Arpeggio (T. 1 und T. 11), mal unabhängige Oberstimme (T. 3 und T. 6), mal Bassstimme (T. 4f.), mal wird er abgespalten und zur None vergrößert (T. 5.2), mal ganz abgesetzt (T. 8); in Takt 9 scheint er – ebenso wie das Arpeggio – vorübergehend erstarrt zu sein. | |
Mit der Positionierung des Hauptgedankens in Takt 6 (d.h. zu Zeile 8 des Gedichts) reflektiert Schönberg dessen ursprüngliche Dreigliederung. | |
Zu Beginn Septime und Quinte, in Takt 4 und Takt 5 Septime (bzw. Sekunde) und Terz, Takt 7 Quarte und Terz, Takt 11 wiederum Septime und Quinte. Sind Quinten oder Quarten beteiligt, so ist immer eines der beiden Intervalle rein und das andere Tritonus bzw. verm. Quinte. Septimen- und Terzenkomponenten bestehen teils aus gleichen, teils aus kleinen und großen Intervallen. | |
Der tonale Eindruck ist in Takt 6 flüchtiger, aber zugleich deutlicher: nicht nur wegen des vorausgegangenen E-Dur-Dreiklangs, sondern auch weil die nichtganztönige Tredezime gis hier noch hörbar als tonales Relikt in den ansonsten ganztönigen Akkord hineinragt, während fis an analoger Stelle in Takt 3 beim Eintritt des Akkords bereits weitgehend verklungen ist. | |
Anstelle einer Verwendung als Reizdissonanz, wie häufig bei Debussy oder Ravel. | |
Vgl. Adorno 1959, 78f.: »Sprengen die Georgelieder die Tonalität, so sind sie doch allerorten von deren Bruchstücken durchsetzt. Dies Verhältnis aber ist keines von unreinem Stil sondern das Spannungsfeld, in dem die Komposition selbst lebt. Ihre neuen Klänge leisten die bestimmte Negation der alten […].« | |
Zugleich ist die Klavierstimme in Takt 4 sehr plausibel aus den diastematischen und rhythmischen Vorgaben von Takt 1 und Takt 3 ableitbar: Als rhythmische Komprimierung und Verkleinerung der beiden Intervallklassen zu kleiner Sekunde (bzw. großer Septime) und großer Terz. | |
Die ausschließliche Verwendung symmetrischer Skalen, selbst für kurze Passagen, scheint für Schönberg in der Phase der freien Atonalität (anders als etwa in op. 2 und op. 9) keine Option mehr gewesen zu sein (siehe auch Fußnote 71). Doch sind die ›fremden‹ Töne keineswegs willkürlich, sondern durch klangliche oder motivische Vorgaben begründet, die gegenüber der Ausrichtung an der Ganztonskala offenbar Vorrang haben: 1): Alle drei Töne stehen im (oktavversetzten) Halbtonabstand zu einem der gleichzeitigen Töne. 2): fis2 ist Teil des halbtönigen ›Vorhalts‹-Motivs, d ist Teil einer Variante des Arpeggio, die aus zwei Intervallen der Klasse (0,1) und zwei der Klasse (0,4) besteht. 3): Das gis1 der Singstimme dagegen scheint mir vor allem als (ästhetisch gebotene) ›Störung‹ des übermäßigen Dreiklangs im Klavier zu fungieren. | |
Nur zwei der 14 Töne in den Takten 1–2 (nämlich der Vorhalt b und des, das bereits zum Ganztonfeld gehört) sind nicht Teil einer Halbtonganztonskala c-d-es-[f]-fis-as-a-h; der Ton f fehlt. | |
Entsprechend der jeweils bestimmenden symmetrischen Skala (Oktatonik, Ganztönigkeit). | |
Die Töne cis, d und es sind dabei nicht gleichrangig, sondern als mehr oder weniger latentes tonikales Zentrum (d) und Vorhalt (es) oder leittöniger Gegenklang (es/cis) voneinander abhängig. Während jedoch der Ton es im Folgenden selten ohne seine unmittelbare Auflösung nach d begegnet, scheint die Funktion von cis vor allem im Mittelteil (T. 4–9.1) gerade darin zu bestehen, den Ton d zu verdrängen. Der Ton a dient als Scharnier zwischen der tonalen und den beiden symmetrischen Ordnungsstrukturen. | |
Der Ton d als Teil einer Halbtonganztonleiter, in der – was eher selten ist – nicht die ›mi‹- sondern die ›re‹-Stufen das strukturelle Gerüst bilden. Vgl. Ravel, Le Gibet (Gaspard de la nuit), Takt 23f., Pantoum (Klaviertrio, 2. Satz), Zif. 6. | |
Und es ist sicher kein Zufall, dass die Töne a, cis sowie – zum Vorhalt zusammengefasst – es und d als einzige im Verlauf des Liedes durch Oktavierung hervorgehoben werden (T. 2, 9, 11). | |
Der Ton cis zu Beginn von Takt 4 ist noch Teil des ganztönigen Feldes aus Takt 3. | |
Im ›Auftakt‹ zu dieser Variante werden Komponenten der Kleinterzachse und des E-Dur Dreiklangs so kombiniert, dass gerade nicht die lineare – und leittönige – Verbindung zwischen einem verminderten Septakkord und einem Dur-Dreiklang (›Dv-T‹), sondern die (vertikale) Schichtung zweier terzverwandter Komponenten (›c-Moll‹ und E-Dur) hervortritt. Die Tonfeld-Theorie würde dazu wohl anmerken, das (flüchtige) Erscheinen von Konstrukt IIa diene hier dazu, einen formalen Wendepunkt in der dem Konstrukt eigenen Schärfe hervorzuheben. Vgl. Polth 2011, Abschn. III.3 (246f.) und III.5 (252ff.). | |
Es und d wiederum als potentieller Vorhalt unmittelbar miteinander verknüpft. | |
Insofern Schönberg den im Sinne der Sequenz fälligen übermäßigen Dreiklang f-a-cis durch f-a-c ersetzt. | |
H-cis-d-es-f-fis-g-a-b. Analog der Kleinterzachse in Takt 5 besteht hier eine strukturelle Hierarchie zwischen dem übermäßigen Dreiklang der ›Basstöne‹, dessen ›Vervollständigung‹ zur Ganztonleiter durch die jeweils zweiten Töne, und dem Dreiklang der rechten Hand, den man entweder als Oberquinttransposition des Dreiklangs der Basstöne oder als chromatisch versetzte ›Reizdissonanz‹ auffassen kann – das heißt als zwar nachrangigen, aber dennoch unverzichtbaren Bestandteil der Harmonik dieser Passage. | |
Wie aus einer Polemik gegenüber Capellen und Busoni gegen Ende der Harmonielehre hervorgeht, empfand Schönberg ein ›Komponieren nach Skalen‹ als Verrat an der gerade erst erkämpften Freiheit (vgl. Schönberg 1911, 441). | |
Zu diesem Eindruck trägt auch der unmittelbar vorausgehende ›Vorhalt‹ a-g bei (so dass sich ein melodisches Gerüst c-h-a-g-b ergäbe). | |
Und zwar sowohl in der Singstimme als auch in der Klavierstimme. | |
Dass der Hauptgedanke in Takt 11 auf h beginnt – das damit als ›Fundament‹ des Schlussklangs erscheint –, dürfte vor allem stilistisch und kompositionstechnisch motiviert sein: Betrachtet man den übermäßigen Dreiklang der Singstimme und den Schluss mit den Strukturtönen a, es und d als kompositorische Vorgabe, und geht man davon aus, dass im Kontext der Zweiten Wiener Schule als Ergänzungstöne zum übermäßigen Dreiklang vor allem solche infrage kommen, die zu einem der drei Töne im Abstand einer großen Septime stehen, dann ist h der einzige, der auch lokal (zum übergebundenen b) die gewünschte ›Reizdissonanz‹ erzeugt. Doch ähnlich wie in den Takten 1–3 der Ton a als Teil einer Kleinterzachse erscheint, ist es auch hier denkbar, den Ton h als Kleinterzvertreter – vulgo ›Tp‹ – der ›Tonika‹ d aufzufassen. | |
Und dies gilt wohl für das gesamte Buch der Hängenden Gärten. | |
Aus diesem Grund wurde auch von einer Tonfeld-Analyse Abstand genommen: 1): Es ist nicht einzusehen, warum durch Großterz-Achsen geprägte Strukturen grundsätzlich nach dem Modell des Konstrukts geformt sein müssen und nicht ebenso gut nach dem der Ganztonreihe oder dem des dritten Messiaen’schen Modus. 2): Die These, dass die Musik der sogenannten Freien Atonalität auf eine ähnlich Weise mehrschichtig strukturiert ist wie ein Großteil der tonalen Musik (nur eben nicht nach dem Modell des Schenker’schen Ursatzes, sondern in Tonfeldern nach Albert Simon), ist als Arbeitshypothese legitim, aber für die Analyse nicht immer hilfreich. 3): Den Anspruch, es müsse jeder Ton aus einer übergeordneten Struktur erklärbar sein – auch die ›fremden Töne‹ der Singstimme in Takt 7–8 –, halte ich in dieser kompositionsgeschichtlichen Situation für übertrieben. | |
Geht es um Sequenzen und lineare Fortschreitungen (›Züge‹), so ist der Rückgriff auf Formen der symmetrischen Oktavteilung unter den Bedingungen der 12-tönigen Temperatur letztlich auch nahezu alternativlos. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1949), Philosophie der neuen Musik, Tübingen: Mohr.
––– (1959), »Nachwort« zu Schönberg, Arnold, Fünfzehn Gedichte aus ›Das Buch der hängenden Gärten‹ von Stefan George, Frankfurt a.M.: Insel, 76–83.
––– (1978), »Die Funktion des Kontrapunkts in der Neuen Musik«, in: –––, Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann, Bd. 16, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 145–169 [Vortrag an der Berliner Akademie der Künste; Erstdruck in: Anmerkungen zur Zeit, Akademie der Künste Berlin, Aug. 1957; Wiederabdruck in: Merkur 119 (1958), 27–48 und in: –––, Klangfiguren, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1959, 210–247].
Dahlhaus, Carl (1965), »Über das Analysieren Neuer Musik. Zu Schönbergs Klavierstücken opus 11, Nr. 1 und opus 33a«, Musik im Unterricht 56, 276–283 [Wiederabdruck in: Fortschritt und Rückbildung in der deutschen Musikerziehung. Vorträge der sechsten Bundesschulmusikwoche, Bonn 1965, hg. von Egon Kraus, Mainz: Schott 1965, 224–236].
––– (2005/GS8), 20. Jahrhundert. Historik – Ästhetik – Theorie – Oper – Arnold Schönberg (= Gesammelte Schriften 8), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber.
––– (2005a/GS8), »Fortschritt und Avantgarde«, in: ––– 2005/GS8, 11–21 [Erstdruck in: –––, Reiner Kluge, Ernst H. Meyer, Walter Wiora (Hg.), Kongreßbericht Leipzig 1966, Kassel: Bärenreiter und Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik 1970, 33–41; Wiederabdruck in: –––, Schönberg und andere. Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik, Mainz: Schott 1978, 40–48].
––– (2005b/GS8), »Geschichte und Geschichten«, in: ––– 2005/GS8, 158–167 [Erstdruck in: ––– (Hg.), Die fünfziger Jahre. Versuch einer Revision (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung 26), Mainz 1985, 9–20].
––– (2005c/GS8), »Adornos Begriff des musikalischen Materials«, in: ––– 2005/GS8, 277–283 [Erstdruck in: Zur Terminologie der Musik des 20. Jahrhunderts (= Veröffentlichungen der Walcker Stiftung 5), hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Stuttgart: Musikwissenschaftliche Verlags-Gesellschaft 1974, 9–17].
––– (2005d/GS8), »Vom Einfachen, vom Schönen und vom einfach Schönen«, in: ––– 2005/GS8, 300–310 [Erstdruck in: 29. Internationale Ferienkurse für Neue Musik 1978 (Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 17), hg. von Ernst Thomas, Mainz: Schott 1978, 22–33].
––– (2005e/GS8), »Abkehr vom Materialdenken?«, in: ––– 2005/GS8, 482–494 [Erstdruck in: Algorithmus, Klang, Natur: Abkehr vom Materialdenken? (= Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 19), hg. von Friedrich Hommel, Mainz 1984, 45–55].
––– (2005f/GS8), Arnold Schönberg: Variationen für Orchester, op. 31, in: ––– 2005/GS8, 619–650 [Erstdruck als: Meisterwerke der Musik 7, München: Fink 1968].
––– (2005g/GS8), »Schönberg und Bach«, in: ––– 2005/GS8, 651–655 [Erstdruck in: Neue Zeitschrift für Musik 128 (1967), 109–111].
––– (2005h/GS8), »Schönbergs Lied ›Streng ist uns das Glück und spröde‹«, in: ––– 2005/GS8, 656–664 [Erstdruck in: Stephan 1967, 45–52].
––– (2005i/GS8), »Emanzipation der Dissonanz«, in: ––– 2005/GS8, 665–673 [Erstdruck in: Aspekte der Neuen Musik. Professor Hans Heinz Stuckenschmidt zum 65. Geburtstag, hg. im Auftr. d. Staatl. Inst. f. Musikforschung, Preuss. Kulturbesitz Berlin von Wolfgang Burde, Kassel u.a.: Bärenreiter 1968, 30–37].
––– (2005j/GS8), »Schönberg und Schenker«, in: ––– 2005/GS8, 677–682 [Erstdruck als »Schoenberg and Schenker« in: Proceedings of the Royal Musical Association 100 (1973–74), 209–215; sowie in: –––, Schönberg und andere, Mainz: Schott 1978, 154–159].
––– (2005k/GS8), »Schönbergs musikalische Poetik«, in: ––– 2005/GS8, 697–704 [Erstdruck in: AfMw 33 (1976), 81–88].
––– (2005l/GS8), »Schönbergs ästhetische Theologie«, in: ––– 2005/GS8, 723–734 [Erstdruck in: Bericht über den 2. Kongress der Internationalen Schönberg-Gesellschaft 1984 (= Publikationen der Internationalen Schönberg-Gesellschaft 2), hg. von Rudolf Stephan und Sigrid Wiesmann, Wien: Lafite 1986, 12–21].
––– (2005m/GS8), »Das Verhältnis zum Text. Zur Entwicklung von Schönbergs musikalischer Poetik«, in: ––– 2005/GS8, 740–748 [Erstdruck in: Festschrift Arno Forchert, hg. von Gerhard Allroggen und Detlef Altenburg, Kassel u.a.: Bärenreiter 1986, 290–295].
––– (2007/GS10), Varia (= Gesammelte Schriften 10), hg. von Hermann Danuser in Verbindung mit Hans-Joachim Hinrichsen und Tobias Plebuch, Laaber: Laaber.
––– (2007a/GS10), »Ist die Zwölftonreihe ein Tonalitätsersatz?«, in: ––– 2007/GS10, 254–256 [Erstdruck in: Neue Zeitschrift für Musik 135 (1974), 538].
––– (2007b/GS10), »Tonalität als Provokation«, in: ––– 2007/GS10, 287–289 [Erstdruck in: Melos/NZ (1976), 438].
––– (2007c/GS10), »Das ›post-serielle‹ Jahrzehnt«, in: ––– 2007/GS10, 517–521 [Erstdruck als: Booklet zu Zeitgenössische Musik in der Bundesrepublik Deutschland, hg. vom Deutschen Musikrat, Folge 5: 1960–1970, EMI/deutsche harmonia mundi 1983].
––– (2007d/GS10), »Aufklärung in der Musik. Erinnern an Adorno«, in: ––– 2007/GS10, 549–558 [Erstdruck in: Geist gegen den Zeitgeist. Erinnern an Adorno, hg. von Josef Früchtl und Maria Calloni, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991, 123–134].
Danuser, Hermann / Peter Gülke / Norbert Miller (2011), Carl Dahlhaus und die Musikwissenschaft: Werk, Wirkung, Aktualität, Schliengen: Argus.
Feurich, Hans-Jürgen (2004), Adorno und die Musikwissenschaft, in: Adorno im Widerstreit. Zur Präsenz seines Denkens, hrg. von Wolfram Ette, Günter Figal, Richard Klein und Günter Peters, Freiburg u. München: Karl Alber, 534–546.
Gerber, Rudolf (1939/40), »Die Musik der Ostmark«, Zeitschrift für deutsche Geisteswissenschaft 2, 55–77.
Kaiser, Joachim (1951), »Musik und Katastrophe« [Rezension zu Theodor W. Adornos Philosophie der neuen Musik], Frankfurter Hefte 6, 435–440.
––– (2011), »Enorm gescheit, gebildet, gerecht«, in: Danuser/Gülke/Miller 2011, 34–36.
Nyffeler, Max (2001), Dem Ton der Epoche nachgehört. Gespräch mit Reinhold Brinkmann, Träger des Ernst von Siemens-Musikpreises 2001. http://www.beckmesser.de/themen/brink/int.html
Polth, Michael (2011), »Zur Artikulation von Tonfeldern bei Brahms, Debussy und Stockhausen«, ZGMTH 8/2, 225–265. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/645.aspx
Prieberg, Fred K. (2004), Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-Rom, Kiel: Kopf.
Schönberg, Arnold (1911), Harmonielehre, Wien: Universal Edition.
––– (1957), Formbildende Tendenzen der Harmonie [Structural Functions of Harmony, London: Williams and Norgate und New York: Norton 1954], übers. von Erwin Stein, Mainz: Schott [Englische Originalfassung lt. Schönberg im »Vorwort des Übersetzers« bereits 1948 abgeschlossen].
––– (1976), Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik (= Gesammelte Schriften 1), hg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt a.M.: Fischer.
––– (1976a), »Komposition mit zwölf Tönen«, in: Schönberg 1976, 72–96 [Nach dem Vortrag »Style and Idea: Composition with twelve tones«, erstmals gehalten in der University of Southern California 1935].
––– (1976b), »Gesinnung oder Erkenntnis?«, in: Schönberg 1976, 209–214 [Erstdruck in: 25 Jahre Neue Musik. Jahrbuch der Universal Edition in Wien, Wien 1926, 21–30].
––– (1976c), »Nationale Musik«, in: Schönberg 1976, 250–254 [Manuskript vom 24.2.1931].
Stanley, Glenn (2006), »Musikgeschichtsschreibung im geteilten Deutschland 1945–1970: Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit? Neue Impulse? Flucht ins Unverfängliche?«, in: Deutsche Leitkultur Musik? Zur Musikgeschichte nach dem Holocaust, hg. von Albrecht Riethmüller, Stuttgart: Steiner, 235–263.
Stephan, Rudolf (1958), Neue Musik. Versuch einer kritischen Einführung (= Kleine Vandenhoeck-Reihe 49), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
––– (1967), Neue Wege der musikalischen Analyse (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 6), Berlin: Merseburger. [Referate der Frühjahrstagung 6.–10.4.1965].
––– (2011), »Gedenkrede zum Tode von Carl Dahlhaus« (1989), in: Danuser 2011, 21–28.
Webern, Anton (1960), Der Weg zur Neuen Musik, hg. von Willi Reich, Wien: Universal Edition.
––– (1960a), »Der Weg zur neuen Musik«, in: Webern 1960, 9–44 [8 Vorträge von Februar bis April 1933].
––– (1960b), »Der Weg zur Komposition mit zwölf Tönen«, in: Webern 1960, 45–61 [8 Vorträge von Januar bis März 1932].
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.