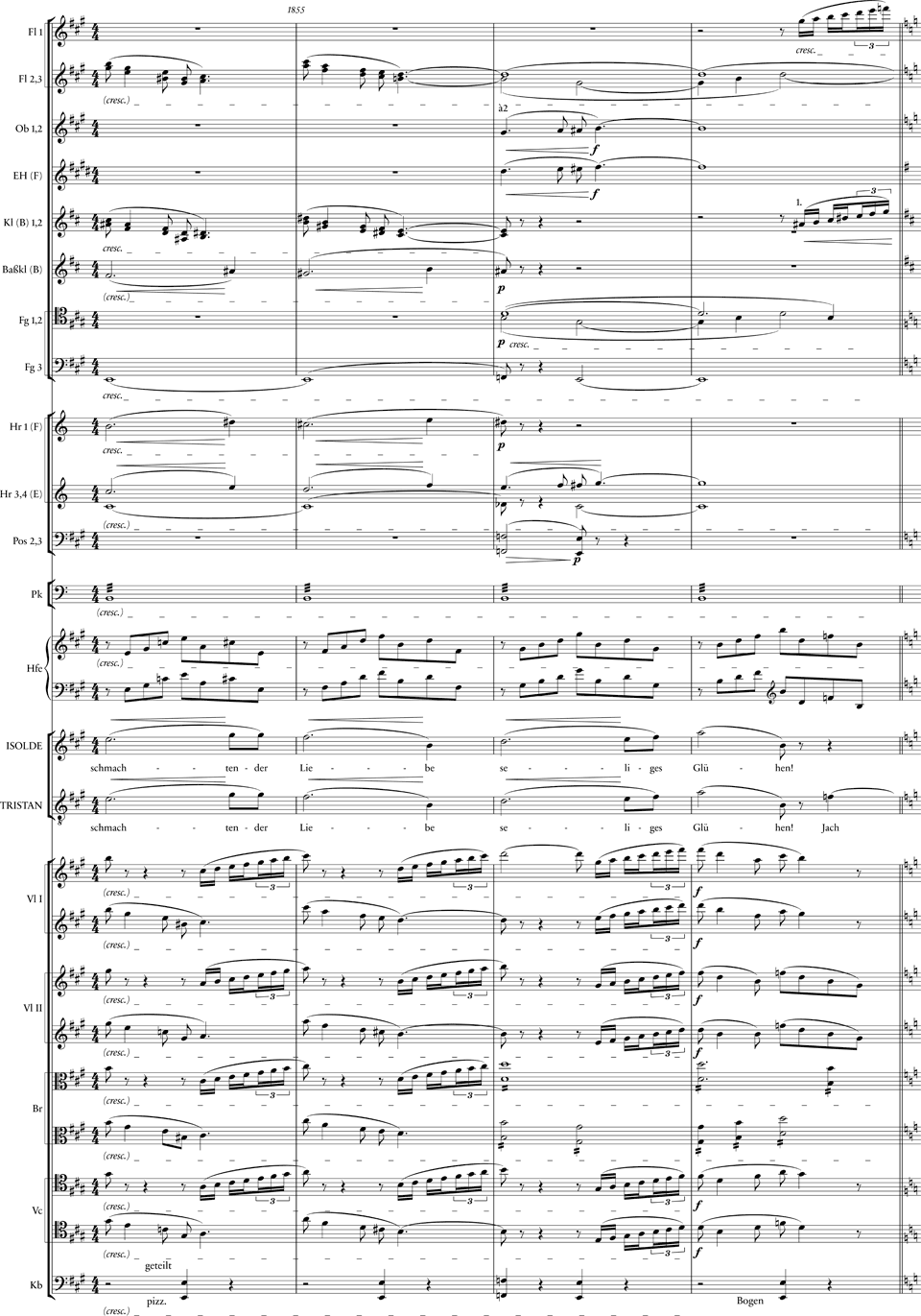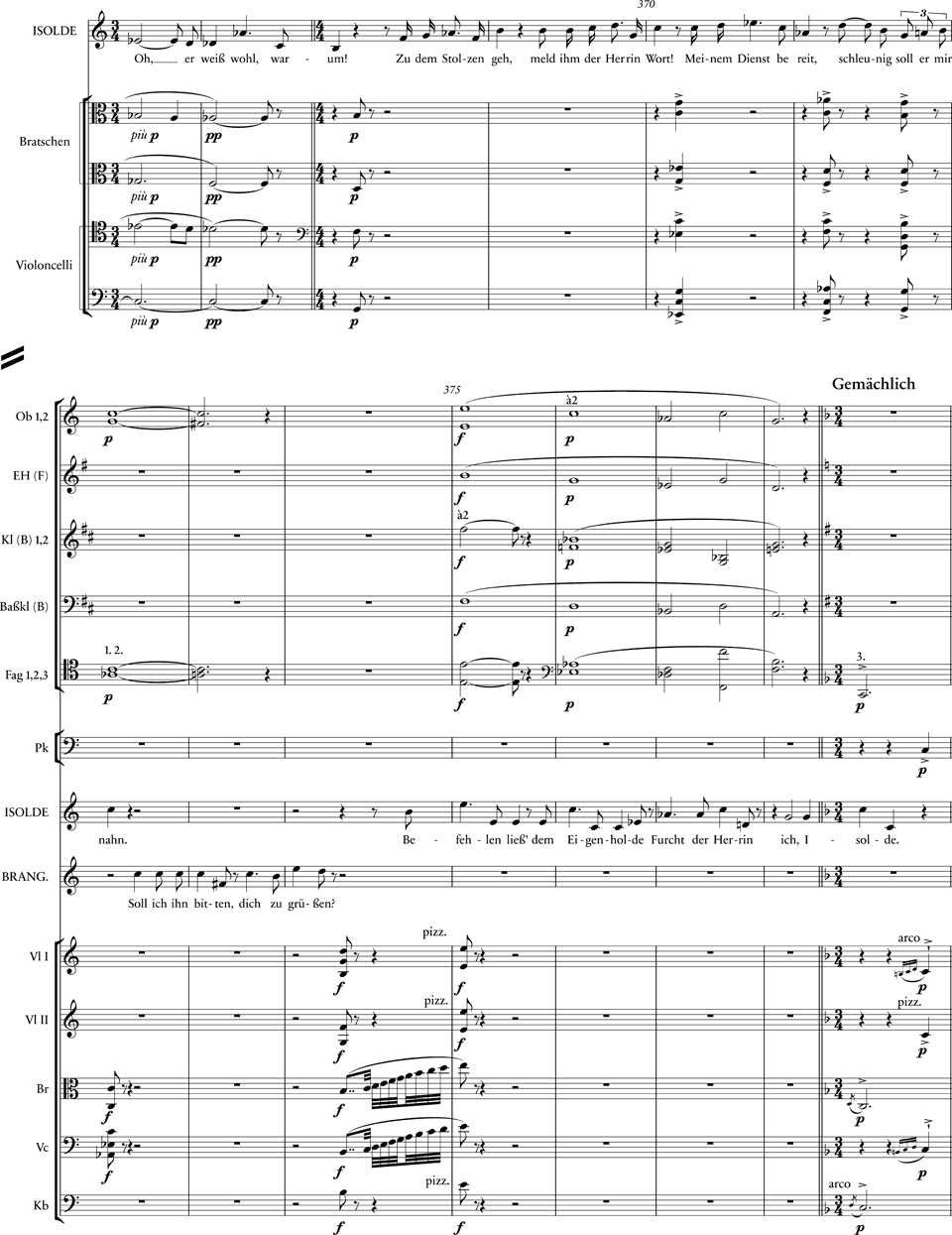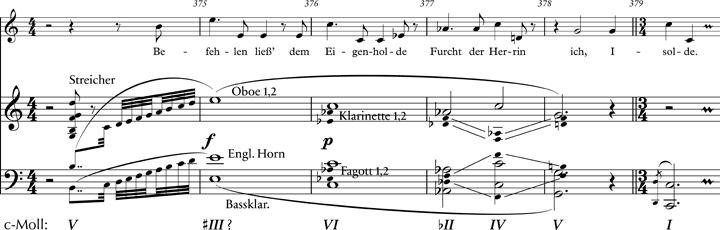Klangfarbe und musikalischer Zusammenhang
Beobachtungen zum Orchestersatz Richard Wagners
Johannes Kohlmann
Ausgehend von den Ideen zur Klangdramaturgie von Tobias Janz soll anhand dreier kurzer Beispiele aus Tristan und Isolde exemplarisch aufgezeigt werden, wie Wagner die Techniken der Instrumentation in die Vorstellungen vom musikalischen Zusammenhang integriert. Dabei zeigt sich, dass die Instrumentation mit satztechnischen und harmonischen Mitteln interagiert, wodurch von traditionellen tonalen Funktionen abweichende ›Klangfunktionen‹ entstehen.
With reference to the idea of sound dramaturgy conceived by Tobias Janz, three short examples from Tristan und Isolde are analysed in order to show how Wagner’s concept of musical coherence comprises the technique of instrumentation. Thereby can be demonstrated that instrumentation interacts with textural and harmonic means, thus generating ›timbre functions‹ differing from traditional tonal functions.
Einleitung
Zahlreiche Aspekte der Klangfarbe – die Techniken ihrer Erzeugung, ihre Funktion innerhalb der Komposition sowie die Weise ihrer Wahrnehmung – erfahren im Laufe des 19. Jahrhunderts eine deutliche Wandlung.[1] In erster Linie sind es die vielfältigen Erweiterungen des Orchesterapparates und Veränderungen der Instrumentationstechnik, die in den Partituren ins Auge stechen.[2] Mit der Vergrößerung des Klangapparates und der Differenzierung der Instrumentationstechnik gehen zwangsläufig auch Veränderungen in der ästhetischen Wahrnehmung des klanglichen Resultates einher. Insbesondere in den Musikdramen Richard Wagners scheint die Klangfarbe eine vorher nicht dagewesene ästhetische Präsenz zu erhalten. Vor allem Theodor W. Adorno hat die Diskussion um den veränderten Stellenwert der Klangfarbe im Werk Wagners angestoßen und sehr nachhaltig geprägt.[3] Seine These, dass in den Partituren Wagners die Auflösung der ›alten‹ Dichotomie zwischen ›Zeichnung‹ und ›Farbe‹ bzw. dem musikalischen Satz und der Klangfarbe vollzogen wird, ist bis heute vielfach rezipiert und aufgegriffen worden.[4] Gleichwohl dieser ästhetische Eindruck nicht von der Hand zu weisen ist, so gilt auch heute noch, was Carl Dahlhaus vor dreißig Jahren schrieb, dass eine ›Theorie der Instrumentation‹, die der gewachsenen ästhetischen Bedeutung der Klangfarbe für den musikalischen Konnex gerecht wird, noch immer nicht existiere.[5] Eine solche Theorie könne nur mit einem Analyseansatz gelingen, der satztechnische, harmonische, metrische und klangfarbliche Phänomene als integrale Bestandteile der Komposition begreift, d.h. den musikalischen Satz nicht als Summe von Teilmomenten, sondern als »konkretes – zusammengewachsenes – Resultat von Wechselwirkungen versteht«.[6] Die Frage, wie eine solche Analyse aussehen könnte, wurde bislang noch nicht abschließend geklärt und wird es auch in diesem Artikel nicht. Aber immerhin lassen sich aus der genauen Beobachtung instrumentationstechnischer Details Anhaltspunkte über die Funktion der Klangfarbe für den musikalischen Zusammenhang gewinnen.
I. Klangfarbe und musikalischer Zusammenhang – ein Kommentar zu Tobias Janz
In der deutschsprachigen Diskussion hat zuletzt Tobias Janz in seiner umfangreichen Publikation Klangdramaturgie. Studien zur theatralen Orchesterkomposition in Wagners »Ring des Nibelungen« die These Adornos aufgegriffen und den Bedeutungswandel der Kategorie ›Klang‹ in der Musik Wagners detailliert nachvollzogen.[7] Janz geht davon aus, dass die sogenannte »sinnliche Präsenz« der Wagner’schen Musik ein Zeichen dafür darstellt, dass die Klangfarbe nicht mehr als Medium musikalischen Sinns fungiert, den nach traditionellen Verständnis der Tonsatz konstituiert, sondern selbst »zum primären Träger komponierten Sinns avanciert«.[8] Indem die Analyse vor allem die Gestaltung der klanglichen Oberflächenstruktur in den Blick nimmt (ohne die traditionellen analytisch-kompositorischen Kategorien dabei aus den Augen zu verlieren), vermag sie für Janz, »das Problem der Dichotomie von Komposition und Instrumentation« zu überwinden.[9] Er verfolgt dabei ausdrücklich einen »phänomenologischen Ansatz«, der nicht die »strukturalistische Einbindung der Materialität der Musik« unternimmt, sondern »diese in ihrem Anderssein, in ihrer Spezifik beläßt und so den Blick auf ganz andere Bereiche musikalisch-kompositorischer Gestaltung auftut«.[10]
Janz setzt zu Beginn seiner Ausführungen voraus, dass es sich bei dem Medium der Musik des 18. Jahrhunderts allein um die »akustische Erscheinungsform« der Musik gehandelt habe, die wesentlich durch die Instrumentation geregelt wurde. Durch diese sei dem Hörer von damals »Form, Struktur, Sinnzusammenhang« der Musik vermittelt worden. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts sei die »Erscheinungsform« selbst zum Sinnträger aufgestiegen.[11] An der Gültigkeit dieser Voraussetzung sind allerdings Zweifel angebracht: Könnte es sein, dass Janz die (metrisch bzw. rhythmisch eingebundene) Tonhöhendisposition für den Zusammenhang selbst hält, obwohl auch sie besser als ein (damals gültiges) ›Medium‹ des musikalischen Zusammenhangs zu begreifen wären? Als Medium würde der Tonhöhenverlauf nicht – wie Janz annimmt – musikalischer Sinnzusammenhang sein, sondern musikalischen ›Sinnzusammenhang‹ ›transportieren‹. Dieser Zusammenhang selbst wäre das Verbunden-sein der Töne und Klänge zu funktionalen Einheiten.
An derjenigen Musik, die spätestens vom 17. Jahrhundert an entstanden ist, lässt sich musikalischer Zusammenhang als das Erscheinen von Funktionen an den konkreten Ereignissen erfahren, seien es Tonhöhen oder Klangfarben (oder beides im Zusammenspiel).[12] Eine Funktion ist ein Eigenschaft des musikalischen Kunstwerks, an der eine bestimmte Klangwirkung festgemacht wird. Eine funktionale Klangeigenschaft ist eine, die ein musikalisches Ereignis (z.B. ein Ton) nur innerhalb des konkreten musikalischen Gefüges besitzt. Funktionen sind also immer singuläre Bestimmungen, die als Teilmomente eines individuellen musikalischen Zusammenhangs erfahrbar werden. Auch wenn Funktionen stets singulär sind, bilden sich häufig bestimmte Funktionstypen aus, die Funktionen mit ähnlichen aber nie genau gleichen Klangwirkungen zusammenfassen. Ein ›Halbschluss‹ ist beispielsweise ein allgemein bestimmbarer Funktionstyp, der in jedem konkreten Stück eine jeweils leicht andere Klangcharakteristik aufweist.[13] In der traditionellen Tonalität des 17. und 18. Jahrhunderts sind es in erster Linie Strukturen im Tonhöhenverlauf, an denen man solche Funktionen des musikalischen Zusammenhangs festmachen kann. Ein Halbschluss wird in erster Linie durch eine Konstellation von Tonhöhen deutlich: Der Halbschluss ist eine Schlusswendung in die harmonische fünfte Stufe einer Tonart. Nicht jede fünfte Stufe, die am Ende eines Abschnitts oder einer Phrase steht, ist aber ein Halbschluss! Zu der notwendigen Bedingung ›Schlusswendung in die fünfte Stufe‹ kommen eine Vielzahl weiterer möglicher (weder notwendiger noch hinreichender) Bestimmungsmomente, durch die ein Komponist deutlich machen kann, ob eine Wendung als Halbschluss gehört werden soll oder nicht. Solche Bestimmungsmomente liegen auf verschiedenen Ebenen – etwa im Verhältnis der beiden Außenstimmen zur Harmonik oder in der metrischen Einbindung der Schlusswendung. An der Hervorbringung der Funktion ›Halbschluss‹ sind alle Momente des Tonsatzes beteiligt, auch wenn sie primär an der Harmonik festgemacht wird.
Anders als von Janz behauptet, geht es bei der Untersuchung der Veränderungen im 19. Jahrhundert also nicht um die Bewältigung einer medientheoretischen Problematik (der Zuordnung der musikalischen Parameter zu Medium und Sinngehalt), sondern um die angemessene Beschreibung des sich ändernden Verhältnisses zwischen zwei verschiedenen Medienbereichen: Die Frage ist also nicht, ob der Zusammenhang auf einer logisch-strukturellen tonhöhebasierenden Ebene oder einer sinnlich-phänomenologischen klanglichen Ebene zu suchen ist, sondern in wie weit sich der musikalische Zusammenhang ändert, wenn neben der Tonhöhe und dem Rhythmus auch verstärkt farbliche oder stoffliche Eigenschaften der Töne eine Rolle spielen, und wie man diese neuen Formen der Zusammenhangsbildung verstehen und beschreiben könnte.
Die Zuordnung zwischen den musikalischen Parametern und den Begriffen Sinn und Medium, die Janz vornimmt, ist also nicht die einzig denkbare, und eine Entscheidung zwischen den Alternativen stößt auf Probleme, die in der Sache selbst begründet sind. Sie hängen mit Eigenarten der Klangfarbe zusammen, die Janz an anderer Stelle – mit Bezug auf bestimmte Richtungen der analytischen Philosophie – als ein Problem der ›qualia‹ beschreibt.[14] Klangfarben können prinzipiell benannt und gegeneinander abgegrenzt werden. Eine Einteilung der Klangfarben kann aber nicht aus einem klaren und durchgängigen Prinzip abgeleitet werden.[15] Klänge erscheinen zwar dunkel, hell, matt, glänzend oder schrill, um ein paar Begriffe zu erwähnen, können damit aber nicht systematisch sortiert und benannt werden.[16] Die Schwierigkeit dabei ähnelt derjenigen bei der Betrachtung des ›Charakters‹ von Musik: Man kann den Charakter genau beschreiben und treffen, man kann ihn aber nicht in eine Skalenordnung mit anderen Charakteren bringen. Hierin unterscheidet sich Klangfarbe fundamental von den Tonhöhen. Erlaubt die klare Fixierung der Tonhöhen, gehörte Sinnzusammenhänge an eben diesen Tonhöhen festzumachen und quasi zu objektivieren, fehlt eine solche Möglichkeit bei den Klangfarben.[17] Als ›objektiver‹ und klassifizierbarer Bestand an Klangfarben bliebe lediglich die Identifizierung von Klangfarben mit einzelnen Instrumenten. Eine solche Vereinfachung der Klangfarben auf eine Handvoll Instrumentalklänge wäre aber sehr unbefriedigend. Instrumenten-Bezeichnungen sind aus folgenden Gründen keine geeignete Reduktion, um Klangfarben zu klassifizieren:
Erstens kann ein und dasselbe Instrument unterschiedliche Klangfarben hervorbringen. Was an einem Instrument als dessen Farbe wahrgenommen wird, ist abhängig von Register, Spielweise und instrumentatorischem bzw. satztechnischem Zusammenhang. Eine Trennung von Farbe und Zeichnung wäre bei Instrumentallinien eine Fiktion.
Zweitens kann eine Klangfarbe durch die Kombinationen mehrerer Instrumente hervorgebracht werden.
Drittens fehlt – wie bereits gesagt – die Möglichkeit, den Unterschied zwischen Klangfarben auf eine ähnlich bestimmte Weise zu kategorisieren wie denjenigen zwischen harmonischen oder tonalen Phänomenen. Zugleich bedeutet dies, dass auch eventuelle Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Klangfarben nicht kategorial erfasst werden können. So lange aber Abgrenzung und Zusammenhang zwischen Klangfarben nicht systematisch beschrieben werden können, ist es zu früh, Klangfarben mit der Farbe einzelner Instrumente gleichzusetzen.
Tobias Janz möchte mit seiner phänomenologischen Herangehensweise der andersartigen Wesensart der Klangfarbe Rechnung tragen. Ihm schwebt ein Perspektivwechsel vor, mit dem es gelingt »sowohl die sinnliche-qualitative Dimension der Musik […] als auch ihre strukturellen und funktionalen Aspekte« zu berücksichtigen.[18] Aufgrund der zweifelhaft Zuordnung von Medium und Sinn sucht Janz musikalischen Zusammenhang aber nur auf einer phänomenologisch-klanglicher Ebene. Die Tonhöhenstrukturen dienen lediglich als analytisches Werkzeug. Er verpasst damit die Chance Zusammenhang als funktionales Zusammenspiel aller Teilmomente zu begreifen – unabhängig von einer gedanklichen Aufspaltung des Tonsatzes in Farbe und Zeichnung oder in einen logisch-strukturellen tonhöhebasierenden und einen sinnlich-phänomenologischen klanglichen Bereich. Man muss Tobias Janz aber Recht geben: Geht man davon aus, dass die Klangfarbe als wesentlicher Faktor mit in die Zusammenhangsbildung der Musik hineinspielt, dann wird die eigene und andersartige Wesensart der Klangfarbe sicher die Art des musikalischen Zusammenhanges und dessen Analyse beeinflussen und prägen.
Janz untersucht also eigentlich nicht den musikalischen Zusammenhang als Ganzes, er erreicht mit seinem Ansatz aber eine differenzierte Analyse des sinnlich-klanglichen Geschehens der Ringpartitur. Seine Forschung legt die vielfältigen Oberflächenstrukturen gewissenhaft und detailliert offen. Der vorliegende Aufsatz will an dieser Vorleistung anknüpfen. Das von Janz analysierte klangliche Geschehen soll in eine funktionale Analyse überführt werden, die die musikalische Zusammenhangsbildung als Resultat von Wechselwirkungen tonaler und klanglicher Teilmomente versteht. Der von Janz etablierte Begriffsapparat zur Beschreibung des orchestralen Klangs in den Werken Wagners stellt eine fundierte Ausgangsbasis für weitere Forschungen auf diesem Gebiet dar. Insbesondere sind es der Klang-Begriff als »Formkategorie« und Begriffe wie »Texturprinzip« und »Farbintervall«, die wertvolle Ansatzpunkte für die Arbeit liefern.[19]
II. ›Klangfarbenharmonik‹ – Ansatzpunkte für eine Analyse
In diesem Abschnitt werden einige Überlegungen von Janz aufgegriffen, die der späteren Analyse dienen können. Die zentralen Punkte, auf die dieser Beitrag näher eingeht, finden sich bei Janz vor allem im Kapitel »Harmonik als Klang«.[20] Traditionell bedeutet der Begriff ›Klang‹ sowohl ›Harmonie‹ als auch ›Klangfarbe‹. Wir sprechen von Tonika-Klängen ebenso wie von dem Klang eines Instruments. Zu Recht weist Janz darauf hin, dass die Begriffe ›harmonischer‹ und ›instrumentaler Klang‹ eine Trennung suggerieren, die der Sache nach kaum besteht. Janz unterscheidet eine faktische von einer konzeptionellen Indifferenz:
Faktische Indifferenz: Kompositorische Entscheidungen bei der Einrichtung einer Orchesterpartitur lassen sich nur selten einem der Bereiche, Harmonik oder Klangfarbe, eindeutig zuordnen.[21] So können beispielsweise Stimmverdopplungen von zwei unterschiedlichen Instrumenten sowohl klangfarbliche Gründe haben, etwa die Modifizierung (z.B. Verdunkelung, Abdeckung) des einen durch das andere Instrument oder die synthetische Mischung beider Instrumentalfarben, als auch harmonische: Die Verdopplung gibt dem Ton im harmonischen Zusammenhang ein stärkeres Gewicht gegenüber anderen, nicht verdoppelten Tönen.[22] Ein anderes Beispiel stellt die Mixturtechnik der ›impressionistischen‹ Musik dar. Einerseits sind parallel verschobene Klänge ein satztechnisches Mittel, um eine bestimmte Art der Harmonik zu erzeugen, andererseits ruft die Technik eine besondere klangfarbliche Wirkung hervor: Instrumente, die etwa in Terz- oder Quintintervallen parallel laufen, klingen lockerer, luftiger oder farbiger als solche, die man im Unisono führt.[23]
Konzeptionelle Indifferenz: »Damit ist gemeint, daß Wagner Harmonien, Akkordfarben, Akkordverbindungen immer auch – gelegentlich sogar ausschließlich – als Farben konzipiert, die sich dann mit den entsprechenden Instrumentalfarben unter einer umfassenden Klangimagination verbinden.«[24] Janz meint mit diesem Begriff, dass Wagner durch verschiedene technische Mittel Harmonik und Klangfarbe zu einer ästhetischen Wahrnehmungseinheit verschmelzen kann. Janz entdeckt in der Ring-Partitur drei Kompositionstechniken, die diese konzeptionelle Indifferenz belegen:
Ein langes Verweilen auf einem Akkord isoliere diesen von anderen. Er werde weniger als Teil eines tonalen Kontexts denn in der »Relation zu sich selbst«[25] wahrgenommen. Wenn Wagner zudem mit einem Akkordwechsel die instrumentale Farbe ändert, dann bilden beide Bereiche nach Janz eine Wahrnehmungseinheit.
Durch die klangfarbliche Unterscheidung simultan erklingender Töne könne Wagner bestimmte satztechnische Phänomene aus ihrem traditionellen Kontext herauslösen. Beispielsweise ändere sich der Dissonanzgrad oder »Dissonanzcharakter«, wenn die beteiligten Töne klangfarblich voneinander abgehoben würden, und der Zusammenklang selbst erhalte eine »Tiefendimension«.[26]
Der Wagnersche Orchestersatz differenziere sich in klangliche Schichten. Insbesondere ließen sich Textur- und Pedalschichten[27] voneinander unterscheiden. Diese klangliche Staffelung des Satzes in Pedal- und Texturschichten korrespondiert bei Janz mit einer harmonischen Staffelung in Orgelpunkte (bzw. Liegetöne) und der darüber liegenden sekundären Harmonik.
Im Begriff der konzeptionellen Indifferenz deutet sich der Versuch an, klangfarbliche und harmonische Momente des Satzes zusammenzudenken. Es lohnt sich, die von Janz angesprochenen Ideen aufzugreifen und weiterzudenken. Der erste angesprochene Punkt basiert auf dem von Ernst Kurth übernommenen Konzept der »absolute[n] Klangwirkung« von Akkorden.[28] Kurth beobachtete eine Tendenz in der Wagner’schen Harmonik, dass Akkorde häufig ihren Eigenklang hervorkehren. Beispielsweise scheint der Dur-Sextakkord im Vergleich zu vielen Werken früherer Komponisten in besonderer Weise seinen typischen warmen und schwebenden Eigenklang zum Leuchten zu bringen. Erst in der ›Klangmusik‹ des 19. Jahrhunderts wird die ›Akkordfarbe‹ zu einer ästhetischen Kategorie. Gerade in der Harmonik der Ring-Musik scheint dieses Phänomen durch die lange liegenden Akkorde und Orgelpunkte besonders zur Geltung zu kommen. Die auffällige Verknüpfung von Akkord- mit Klangfarbenwechseln, die Janz anspricht, lässt beide Bereiche in der Tat im konkreten Hörerlebnis stark zusammenrücken. Man muss allerdings aufpassen, dass diese richtige Beobachtung nicht zu unzulässigen Vereinfachungen verleitet:
Erstens darf die Verknüpfung von Tonhöhe und Klangfarbe nicht einseitig auf das Verhältnis von Harmonik und Klangfarbe reduziert werden. Harmonik ist neben der Satztechnik nur ein Teilbereich der musikalischen Tonhöhenstruktur.
Zweitens darf die Tatsache, dass Klänge im besonderen Maße ihren Eigenklang hervorkehren, nicht zu einer Analyse verführen, die die Einzelklänge ohne ihr harmonisches, klangliches und satztechnisches Umfeld betrachtet.
Untersucht man die Verschmelzung von Akkord- und Farbklängen zu einer Wahrnehmungseinheit auf der Basis einer differenzierten Analyse, die das Zustandekommen der scheinbar isolierten Klänge im jeweiligen konkreten musikalischen Kontext ernst nimmt, so ist es möglich, die ›auf sich selbst bezogenen‹ Akkordklänge als Resultat einer funktionalen Zusammenhangsbildung zu begreifen.[29] Auch die Ideen, die sich im zweiten und dritten Punkt andeuten, erweisen sich als fruchtbare Ansätze. Dass sich nicht nur Akkorde, sondern auch einzelne Töne und Klangbestandteile durch die klangfarbliche Inszenierung voneinander abgrenzen könnten, ist eine sehr interessante Perspektive: Eine Hörweise, die klangfarbliche Beziehungen bei der Betrachtung von Zusammenklängen mit einbezieht, würde die Bildung von tonalen Zusammenhängen ermöglichen, die nicht mit traditionellen akkordischen Strukturen zusammenfallen. Genauso ist die enge Verbindung der räumlich-klanglichen Schichtendifferenzierung mit verschiedenen harmonisch-satztechnischen Ebenen nicht von der Hand zu weisen, wenn auch die bei Janz angedeutete These einer starren Kopplung von Pedalschicht und Orgelpunktharmonik zu pauschal und undifferenziert sein dürfte. Die neuen technischen Möglichkeiten einer klanglichen Differenzierung des Orchestersatzes bieten wohl viele Möglichkeiten, den musikalischen Zusammenhang in einer neuen Weise zu gestalten und hörbar zu machen.
In diesem Beitrag wird versucht, neben satztechnischen und harmonischen Beobachtungen, die in erster Linie an konkreten Tonhöhen festgemacht werden, auch solche zu instrumentationstechnischen Details in die Analyse aufzunehmen und die gegenseitige Bedingtheit und Durchdringung der Bereiche in ihrer ästhetischen Wirkung ernst zu nehmen. Drei kurze Beispielstellen sollen zeigen, auf welche Art und Weise es gelingen könnte, die Klangfarbe (und die damit verbundenen instrumentationstechnischen Details) in eine Analyse zu integrieren. Die enge Verbindung von Satztechnik, Harmonik und Instrumentation soll dabei im Fokus stehen. Die Beispiele sind dem Wagner’schen Schlüsselwerk Tristan und Isolde entnommen. Im Gegensatz zu der bunteren und illustrativeren Instrumentation im Ring des Nibelungen, die die unterschiedlichen dramatischen Situationen und deren Gegensätze deutlich zum Vorschein bringt, erscheint diejenige des Tristan-Orchesters weniger dramatisch-illustrativ als kompakt und ›symphonisch‹.[30] Dieser Umstand kann eine Hilfe sein, die musikimmanente Bedeutung der Klangfarbe von der dramatischen zu unterscheiden und dadurch die Klangfarbe als funktionales Teilmoment der Komposition zu begreifen.
III. ›Nackte‹ Linien und ›Rätselklang‹
Das erste Beispiel soll die enge ästhetische Verzahnung der Bereiche Satztechnik, Harmonik und Klangfarbe demonstrieren und belegen. Hierzu böte sich eine Vielzahl an Beispielstellen an. Der Beginn des Vorspiels zum 1. Akt wurde dabei nicht nur wegen seiner enormen Bekanntheit gewählt, sondern auch deswegen, weil er zwar immer mit harmonischen, selten aber mit instrumentatonstechnischen oder klangfarblichen Aspekten in Verbindung gebracht wird.
Der allseits bekannte Tristanakkord gehört sicherlich zu den meistbesprochenen und -analysierten Musikbeispielen in der Geschichte der Musiktheorie. Nicht von ungefähr sieht man in der Eröffnungsphrase des Musikdramas (und ihrer zweimaligen Sequenzierung) eine Art ›Quintessenz‹ des gesamten Tristan-Stiles. Heinrich Poos und Sebastian Urmoneit haben in jüngerer Zeit ausführlich über die Struktur, die möglichen historischen Hintergründe und Modelle und über Deutungsmöglichkeiten des Tristan-Anfangs berichtet.[31] Beide bemängeln an den meisten Erklärungsansätzen der Vergangenheit, dass sie die Bedeutung des ersten Akkordes eindeutig klären wollten. Aus Systemzwang verfehlten diese Interpretationen die Pointe der Eröffnung, die gerade darin bestehe, dass die harmonische Situation strukturell unklar bleibt. Die Eröffnungsphrase, die Poos als »Tristan-Hieroglyphe« und »Rätselspruch« bezeichnet, sei absichtlich rätselhaft und uneindeutig inszeniert, damit sie sich einer systemischen Deutung entziehe und – so die These von Urmoneit – im Verlauf des Musikdramas unterschiedlichen möglichen Deutungen unterzogen werden kann. Dabei ist der entscheidende Anteil der Klangfarbe an der Bildung des »Rätselspruchs« weder von Poos noch von Urmoneit beachtet worden.
Beispiel 1: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 1. Akt, T. 1–7
Interessant ist zunächst, dass jede ›Tonsatz-Stimme‹ von einem einzelnen realen Instrument ausgeführt wird. Lediglich im bedeutungsschwangeren Tristanakkord (T. 2) werden alle vier Stimmen für die Dauer von genau vier Achteln verdoppelt (die zweite Oboe doppelt die Erste, die beiden Klarinetten verdoppeln die Töne der beiden Fagotte, und das Englischhorn übernimmt den Schlusston der Celli), was den Effekt einer leicht akzentuierenden dynamischen Betonung des Akkordes erzeugt. Die Setzweise ist kammermusikalisch und lässt keinerlei orchestrale Klangentfaltung zu. Kein Instrument des Satzes tritt als Solist hervor. Die Oboe steht als Oberstimme und als bestimmende Klangfarbe zwar im Vordergrund – die Oboenlinie setzt sich aber weder in satztechnischer noch in klangfarblicher Hinsicht deutlich von den anderen Stimmen ab, so dass eine traditionelle Aufteilung des Satzes in ›Melodie und Begleitung‹ verhindert wird. Der Satz ist aber ebenso wenig als Mischklang zu verstehen. Hätte Wagner eine Mischung der Instrumentalfarben erzeugen wollen, so hätte er durch Hinzunahme weiterer Bläser (etwa tiefer Flöten oder Hörner) und durch Tondopplungen und Überkreuzungen der Instrumente die einzelnen Instrumentenfarben miteinander verwoben. Selbst die Klarinetten in Takt 2 fungieren nicht als klangliches Bindeglied, um die Instrumentalfarben zusammenzuschweißen, sondern dienen lediglich der dynamischen Verstärkung der beiden Fagott-Töne. Es scheint also, als sei ein Mischklang bewusst vermieden worden. Das Vermeiden jeder orchestralen Klangentfaltung lässt die Takte äußerst ›nackt‹ und einsam wirken. Erst mit dem Ende der ›Einleitungtakte‹ im engeren Sinne beginnt in Takt 16, durch den Anfangsakzent des Pizzicatos und den ersten orchestralen Basston deutlich markiert, das eigentliche orchestrale Klang- und Satzgefüge des Vorspiels.[32] Die untypische und offene Instrumentation korrespondiert mit der neuartigen Offenheit des Tonhöhenverlaufs: Es ist selbstverständlich möglich in der Tristanwendung eine Folge zweier Akkorde zu hören (Halbschlussendung d-E). Einige Details weisen aber auf Unterschiede des Tristanakkordes zu traditionellen Akkorden der Vergangenheit hin: Der individuelle Intervallaufbau des halbverminderten Septakkordes im Tristanakkord (von unten nach oben: Tritonus, großer Terz und Quarte) und der fehlende eindeutige Grundton- und Tonartbezug verhindern die Wahrnehmung als ›Akkord‹ im traditionellen Sinne. Inszeniert wird kein ›Akkord‹ (eine sich auf einen Grundton beziehende Wahrnehmungseinheit mehrerer Tönen), sondern ein individuelles Klanggebilde aus Einzeltönen (bzw. -intervallen). Die einzelnen polyphonen Linien, die sich selbst zwar klanglich aufeinander beziehen, aber eben nicht zu kompakten Akkorden verschmelzen, treten bei dieser Inszenierung sehr deutlich in Erscheinung. Die Einzelstimmen des Tonsatzes korrespondieren mit den Einzelfarben der Instrumentation. Beide Bereiche beeinflussen sich gegenseitig – sie sind quasi zwei Seiten derselben Medaille – ohne dass man entscheiden könnte, welcher die offene und individuelle Klanglichkeit der Stelle primär hervorruft.
Die fast holzschnittartige Klangfarbe ist einzigartig in Wagners Instrumentationsstil und darf keinesfalls bei der Betrachtung der Anfangstakte vernachlässigt werden. Gerade die Klangfarbe hebt die »Tristan-Hieroglyphe« vom Ideal des Mischklangs, das die übrige Partitur prägt, deutlich ab – auch bei ihrem wiederholten Erscheinen im weiteren Verlauf der Oper. Stets ist die Sequenz mit einer besonderen Instrumentationsweise und einer offenen, oft kammermusikalischen Klanglichkeit verbunden, mit der dramatisch ein Eindruck der völligen Entrückung einhergeht. Selbstverständlich ist dafür nicht alleine die Klangfarbe verantwortlich. Immer ist es die Gesamtkonstellation, die für die Funktionsweise einer Stelle verantwortlich ist, ohne dass man den Anteil einzelner Momente eindeutig bestimmen kann.
Einen indirekten Beleg für die Besonderheit der »Tristan-Hieroglyphe« bilden Stellen, die der speziellen satztechnischen und klanglichen Inszenierung entbehren. In Takt 1856 im ersten Akt beispielsweise greift Wagner den Tristanakkord mit seiner (›halbschlüssigen‹) Auflösung (Bsp. 2) wieder auf – zumindest von den Tonhöhen her betrachtet. Alles Rätselhafte wirkt in dieser Phrase jedoch wie abgestreift. Die zitatartige Reminiszenz an den Anfang ist zwar aufgrund der eingeblendeten düsteren Akkordfarbe des halbverminderten Tristanakkordes deutlich hörbar, der funktionale Zusammenhang der Musik ist aber ein völlig anderer. Die Wendung ist eingebettet in einen dichten orchestralen Tuttiklang.[33] Trotz des sich überschäumend steigernden Charakters und der sequenzierenden Anlage des Tuttis wird eine einheitliche klanglich-harmonische Fläche erzeugt, in der die harmonischen Zwischenstationen keine eigenständige funktionale Relevanz besitzen. Der Zitatcharakter des aufscheinenden Tristanakkordes kann damit gut erklärt werden. Das veränderte funktionale Umfeld – vor allem die veränderte orchestrale Einbindung in die Tuttitextur, was in erster Linie durch die Instrumentation erzeugt wird, aber auch der nivellierende Orgelpunkt in der Pauke oder das Fehlen der charakteristischen Pausen – erzeugt also einen neuen musikalischen Zusammenhang.
Beispiel 2: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 1. Akt, T. 1854–1857
IV. Klangliche Differenzierung einer tonalen Funktion
Im folgenden Abschnitt sollen genaue satztechnische, harmonische und instrumentatorische Beobachtungen in eine funktionale Deutung überführt werden. Das Beispiel ist vor allem wegen seiner Kürze und guten Überschaubarkeit gewählt. Es geht um eine kurze Stelle aus dem 1. Akt, an der zu Isoldes »Befehlen ließ dem Eigenholde« ein homogener Holzbläsersatz erklingt (vgl. Bsp. 3 und 4).
Beispiel 3: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 1. Akt, T. 366–379
Beispiel 4: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 1. Akt, T. 374–379, analytische Skizze
In den Takten 375–379 gibt es eine führende Hauptstimme, die in drei Oktavlagen erklingt (im Schaubild durch die unausgefüllten Notenköpfe dargestellt): Die höchste Lage übernehmen die beiden Oboen, die Mittellage das Englischhorn und die tiefste die Bassklarinette. Diese sehr präsente Instrumentallinie bildet auch die Grundlage für die Gesangsstimme. Bestimmend für die Klangfarbe der Linie ist der obertonreiche Oboenklang, der durch die Dopplung und durch die exponierte Lage hervorsticht. Charakteristisch für den Tonhöhenverlauf ist zunächst das Absinken in großen Terzen (e-c-as) worauf eine kadenzierende ›bassklauselartige‹ Wendung folgt (c-g-c).
Die Klarinetten- und Fagott-Töne füllen die Melodielinie von Takt 376 an akkordisch auf, ohne selbst als eigenständige Stimmen wahrgenommen zu werden. Letzteres liegt daran, dass erstens die ungelenken Tonfolgen nicht als sinnvoller Verlauf von ›Stimmen‹ wahrgenommen werden und zweitens die Töne selbst klanglich und dynamisch unauffällig bleiben.
Ein weiteres wichtiges Detail an dieser Stelle bildet die Tatsache, dass die erwähnte führende Stimme zugleich den ›Außenstimmensatz‹ darstellt (mit Ausnahme des f-Moll-Akkordes in T. 377). Obwohl die Bassklarinette faktisch die tiefsten Töne spielt, werden diese doch nicht als Bassstöne im traditionellen Sinne wahrgenommen. Das verhindern die Koppelung der Bassklarinette an die Oboen und das Englischhorn sowie die Klangfarbe der Bassklarinetten selbst. Der hohe Oboenklang, der dominiert, erhält durch das Englischhorn zusätzlich eine dunklere Substanz und damit eine gewisse Erdung. Die bleiche Bassklarinetten-Farbe hingegen wirkt wie ein ›Schatten‹ der Oberstimme in der Tiefe. Damit ist aber auch gesagt, dass die Bassklarinette keine ›Bassstimme‹ spielt. Und da die übrigen tiefen Instrumente für diese Aufgabe ebenso wenig geeignet sind, kann man etwas zugespitzt behaupten, dass der Satz gerade dadurch klanglich geprägt ist, dass keine Bassfunktion hörbar wird. Entgegen dem ersten Eindruck prägt Wagners Partitur an dieser Stelle alles andere als einen ›vierstimmigen Tonsatz‹ aus. Vielmehr handelt es sich um eine einzige Stimme im ›Vordergrund‹, jene präsente Unisono-Linie, die im ›Hintergrund‹ durch weiche Akkorde klanglich beleuchtet wird. An die Stelle der traditionellen Dichotomie von ›Oben und Unten‹ – die beiden primären ästhetischen Wahrnehmungsbereiche des klassischen Tonsatzes – tritt diejenige von ›Vorne und Hinten‹.
* * *
Wagner verfügt über vielfältige Möglichkeiten, den Orchestersatz als virtuelles ›dreidimensionales‹ Gebilde zu inszenieren. Solche räumlichen Satzbilder sind ohne die Integration von speziellen satz- und instrumentationstechnischen Mitteln kaum vorstellbar. Die Veränderungen der Satzstruktur, die mit dem kompositorischen Erschließen neuer Satzbilder einhergehen, bleiben nicht ohne Auswirkung auf das Erscheinungsbild oder die Struktur der Tonalität. Wie Schönberg bemerkt hat, lässt sich die Harmonik der zuletzt analysierten Stelle auf den Grundton C beziehen.[34] Ohne Übertreibung ließe sich sogar von einem erweiterten Kadenz-Zusammenhang in c-Moll sprechen.[35] Dass diese Feststellung die harmonischen Eigentümlichkeiten der Takte nicht trifft, liegt auf der Hand. Dazu müssen die Beobachtungen durch andere ergänzt werden.
Ein besonderes harmonisches Licht, das nicht durch Rekurs auf Kadenzharmonik erklärt werden kann, geht vom Eintritt des As-Dur-Sextakkordes, dem zweiten Ereignis der Stelle, aus. Sein weicher und entrückter Klang ist auch ein Ergebnis der Tatsache, dass er einem ersten Spitzen- und Anfangston E folgt. Repräsentiert der Unisono-Ton E einen Akkord, oder wird er ausschließlich als Einzelton gehört? Einerseits ist das Faktum ernst nehmen, dass E ein Einzelton ist und dass er als solcher und durch das Forte einen Kontrast zu den folgenden leisen Akkorden bildet. Andererseits ist er nicht frei von harmonischen Implikationen. Es ist aufschlussreich, diesen Implikationen nachzuspüren. Trotz des vorangehenden G-Dur-Septakkordes kommt eine Deutung des Tones E als Terz eines C-Dur-Akkordes (›verdurte‹ Tonika) kaum in Frage. Eine derart gewöhnliche Akkordwendung – als Erklärungsmuster unterlegt – würde dem scharfen und dominanten Charakter des Einzeltones E nicht gerecht. Gerade das Interessante der Akkordfolge bliebe unerklärt (im Übrigen herrscht eine c-Moll-Umgebung). Hingegen käme die Annahme einer dem ›phrygischen Halbschluss‹ ähnelnden Wendung (h7-E) dem Charakter der Stelle deutlich näher. An eine solche Wendung erinnern vor allem die Stimmbewegungen d2-e2 (Vl. 1) und f1-e1 (Vl. 2) sowie die Auftaktquarte in den Bässen (H-e) und dem Gesang (h1-e2). Da der Takt – probeweise mit einem E-Dur-Akkord unterlegt – schlüssig klingt, scheint der Ton E eine (sich gegen c-Moll sehr scharf abgrenzende) erhöhte III. Stufe zu repräsentieren.
Eine wichtige Frage, die sich im Zusammenhang der harmonischen Analyse stellt, betrifft die Bedeutung der oben beschriebenen Instrumentations- bzw. Satztechnik: Wie ist das Fehlen einer Bassstimme harmonisch zu interpretieren? Augenscheinlich verändern sich durch diese Behandlung des Orchestersatzes die Eigenschaften der Akkorde. Zwar sind die Zusammenklänge selbst und ihre Relation zum tiefsten Ton (ihre vermeintliche ›Stellung‹) auch ohne Bassstimme zu erkennen (so der aparte As-Dur-›Sextakkord‹ oder der weiche Des-Dur-›Quartsextklang‹). Doch ohne eine funktionale Bassstimme, durch die sich Akkorde auch stimmführungstechnisch aufeinander beziehen können, nimmt man die Klänge selbst mehr in ihrem ›stofflichen Klanggehalt‹ wahr. Die Akkorde bekommen ihre Färbung also nicht durch ihre tonale Einbindung, sondern über einen farblichen Bezug, der an den Tönen und Akkorden selbst zu haften scheint, wodurch auf eine eigentümliche Weise besonders ihr Eigenklang zum Vorschein kommt. Oder anders formuliert: Gerade durch die Herauslösung aus dem satztechnischen Zusammenhang kommt die Akkordumkehrung als Akkordfarbe zur Geltung.
* * *
Eine mögliche funktionale Deutung der Stelle, die die obigen Beobachtungen aufgreift und tonale und farbliche Beobachtungen zu integrieren versucht, könnte etwa folgendermaßen aussehen: Der Rahmen, der die Stelle funktional aufspannt, ist durch die wichtigen tonalen Stationen T-D-T (C, G und C) gegeben. Die Stelle hat schließlich als Schluss eines vorangehenden rezitativischen Abschnittes in c-Moll eindeutig Kadenzcharakter. Nicht aber die Akkorde mit ihrer auf den Grundton C bezogenen Stufenfolge sind das entscheidende, sondern die ›Vordergrundstimme‹ ist es, die diese Gerüsttöne vorführt (Bsp. 5).
Beispiel 5: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 1. Akt, T. 374–379, Struktur der Gesangstimme
Der Anfangstonika wird dabei aber nicht nur durch den Ton C repräsentiert. Dem C werden die große Ober- und Unterterz (E und As) zur Seite gestellt. Die tonale Stufe erklingt farblich aufgespalten in einen besonders harten und strahlenden Ton E und einen weiches und warmes As. Die tonale Funktion ›Anfangstonika‹ bekommt eine farbliche Differenzierung, die auf einer ganz anderen als auf der tonalen Ebene anzusetzen scheint. Der große klangliche Kontrast, der durch die beiden Klangsphären erzeugt wird, kann sich innerhalb einer tonalen Funktion entfalten, ohne diese zu zerstören.
Die Harmonik unterstützt diese Inszenierung der Anfangstonika und verschärft sie sogar, indem sie den enormen Kontrast der beiden Farbbereiche in die ersten zwei Takte (T. 375–376) bündelt. Das E wird als äußerst scharfer und isolierter Hoch- und Einzelton im Unisono vorgeführt, der gerade wegen dieser Inszenierung als Repräsentant eines harten E-Dur-Grundakkordes gehört werden kann. In Takt 376 wird dem Ton E ein harmonisch und klangfarblich weicher und dadurch stark kontrastierender As-Dur-Sextakkord entgegen gestellt, der dem Melodieton C unterlegt ist. Das Aufeinandertreffen der beiden Sphären in diesem Moment scheint mir das wesentliche klangliche Ereignis der Stelle zu sein, das durch die Gesamtkonstellation aus klangfarblichen und tonal-harmonischen Mitteln erzeugt wird. Im folgenden Takt wird dann der Ton As in der Melodie nachgereicht. Die Akkorde dieses Taktes (Des-Dur und f-Moll) scheinen als angedeutete Vorbereitungsakkorde der Dominante G-Dur (T. 378) vor allem die tonalen kadenzierenden Aufgaben der Melodie zu unterstützen.
V. Texturen und Klangeinheit
Tobias Janz hat mit dem Begriff ›Texturprinzip‹ eine wichtige Wesensart der Wagner’schen Orchestertechnik beschrieben. Der Begriff verbindet satztechnische, harmonische und klangfarbliche Bereiche, um so den schichtenmäßigen Aufbau und die klanglich-räumliche Kompositionsweise vieler Orchestertutti-Stellen im Ring beschreiben zu können. Janz erklärt den Begriff wie folgt:
Im Prinzip Textur zeigt sich […] ein Satzprinzip, in dem primär die spezifisch materialen Qualitäten des Orchesterklangs dargeboten werden und dabei zugleich für dessen Klangstruktur konstitutiv sind. Der klangliche Aufbau von Texturen hängt unmittelbar mit der räumlichen Struktur des Orchesterklangs zusammen, indem sich die Klangstruktur auf mehrere Ebenen und Schichten verteilt, wobei zwar die farbliche Abstufung der instrumentalen Gruppen in der Zusammenstellung der Besetzung bereits vorgegeben ist, gleichzeitig jedoch erst die satzmäßige Differenzierung der Schichten die eigentliche räumliche Qualität erzeugt und plastisch hervortreten läßt.[36]
Zu Recht spricht er von verschiedenen Differenzierungsgraden dieses Prinzips. Typisch für die Ringpartituren seien Abschnitte, in denen sich der harmonische Rhythmus verlangsame und ein Akkordklang flächig ausbreite. Der Eindruck einer in sich stehenden Harmonik werde in erster Linie durch gehaltene Orgelpunkte und Pedalklänge erzeugt, die die Ringpartituren vielfach durchziehen. Die musikalische Bewegung, ganz gleich ob mit motivischem Charakter oder als reine Klangauffächerungen, finde dann vor allem innerhalb der gehaltenen Klänge statt. Schon Monika Lichtenfeld hat für solche Stellen den Terminus ›Klangfläche‹ vorgeschlagen.[37] Das Janzsche Texturprinzip schließt aber auch Tuttistellen mit ein, die sich durch harmonische Bewegungen oder melodische Entwicklungszüge auszeichnen und daher nicht mehr als Klangfläche bezeichnet werden können.
Janz demonstriert anhand einiger Beispiele, dass alle musikalischen Teilmomente an der Erzeugung differenzierter Orchester-Texturen beteiligt sind.[38] Diese wichtige Feststellung dient als Ausgangspunkt für die folgende Überlegung, die über die Janzschen Ausführungen hinausgeht: Die von Janz beschriebene neuartige und an der räumlichen Klangtotalen orientierte Kompositionstechnik kann für den musikalischen Zusammenhang nicht folgenlos bleiben. In einem Satzzusammenhang, der sich als ›Textur‹ beschreiben lässt, sollten Teilmomente (beispielsweise harmonische Ereignisse), die aus traditionellen Tonsätzen nicht nur als technische ›Elemente‹, sondern auch mit den dort generierten Klangeigenschaften bekannt sind, mit neuen veränderten Klangeigenschaften begegnen. Das bedeutet aber auch, dass – wie oben bereits dargestellt – die von Janz gegebene Interpretation (gehaltene Pedalklänge seien ein Mittel der Isolierung von Akkordfarben, die hauptsächlich in der Relation zu sich selbst wahrgenommen werden), obwohl zutreffend, als Erklärung harmonischer Zusammenhänge nicht ausreicht. Im folgenden Beispiel sollen daher – auf die Janz’schen Beschreibungen der Wagner’schen Orchestertechnik aufzubauend – die Konsequenzen aufgezeigt werden, die eine veränderte Orchestertechnik für den harmonischen bzw. formalen Zusammenhang der Musik zeitigt. Von der Beobachtung ausgehend, dass der technische Begriff ›Texturklang‹ auch ein ästhetisches Korrelat besitzt, wird erklärt, wie die Verfahren der Bildung, des Abwechselns und des ineinander Verwandelns verschiedener Texturen, formale Abschnitte und Grenzen entstehen lassen, die einen Einfluss auf Bildung und Erscheinungsweise des tonalen Zusammenhangs ausüben. Klangfarbliche Einheiten könnten demnach mit wichtigen Tonhöhen-Einheiten korrespondieren. Das Zusammenspiel beider Bereiche ergäbe ein gemeinsames Netz von Formkategorien und Formabschnitten. Solche ›Klangeinheiten‹ wären funktionale Gebilde. Sie sind formbar, abgrenzbar, gestaltbar und man kann ihnen bestimmte funktionale Aufgaben zuweisen.
VI. Harmonische Differenzierung einer klanglichen Funktion
In der Mitte des großen »Zwiegesprächs«[39] im zweiten Akt des Tristan, nach einer Phase des Jubels über das nächtliche Wiedersehen und einer die ›Tages-Verstrickungen‹ reflektierenden Phase, beginnt eine sehr flächig gestaltete Musik, deren Ausdruckscharakter szenisch mit dem Entschluss der beiden Liebenden korrespondiert, sich der ewigen Nacht zu weihen. Der Abschnitt startet in Takt 1121 mit einem As-Dur-Akkord, dessen Entstehung – er geht durch mehrfaches ›Unterterzen‹ aus dem Liegeton es1 (bzw. es) hervor – in den unmittelbar davor liegenden Takten 1117–1120 vorgeführt wird (Bsp. 6).
Beispiel 6: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 2. Akt, T. 1117–1141
Die synkopische Rhythmusfigur, die den Satz schon von Takt 1107 an in den Celli grundiert, spielt sich an dieser Stelle in den Vordergrund und spannt einen flächigen und schlichten Begleitsatz auf, der wegen des hinkenden Rhythmus dennoch eine gewisse Grundspannung aufrecht erhält. Dass die folgenden Takte als zusammenhängender Texturklang, als ›Klangeinheit‹ wahrgenommen werden, wird neben der homorhythmischen Figur und der sehr homogenen Klangfarbe (gedämpfte Streicher + die besonders mischfähigen Holzbläser [Klarinetten, Fagotte und Hörner]) auch durch den Orgelpunkt As erzeugt, der die Takte 1121–1138 harmonisch verbindet. Nachdem zu Beginn schon der As-Dur-Akkord durch eine Entfaltung des Einzeltons Es in die Tiefe hin entstanden ist, erweitert die Singstimme zusammen mit der Oberstimme der Streicher (1. Violinen) den entstandenen Klang ab Takt 1123, indem sie neue Töne (und damit Akkordmodifikationen) ins Spiel bringt und den Tonraum nach oben erweitert (Bsp. 7). In Takt 1126 scheint mit dem Einsatz der Holzbläser und dem weichen Des-Dur-Sept-Non-Vorhaltsakkord das Zentrum des Klangabschnittes erreicht zu sein. Der »sehr weich[e]« Einsatz der Holzbläser markiert dabei keinen Bruch, sondern gibt der zarten Streicherfarbe einen sehr warmen und substanzreicheren Klangkern.[40] Technisch wird das vor allem dadurch erreicht, dass Blasinstrumente (Klarinetten, Fagotte und Hörner) verwendet werden, die mit den Streichern gut verschmelzen, und dass jeder Ton in dem dichten Streicher-Akkord genau von jeweils einem Holzblasinstrument gedoppelt und damit zwar eingefärbt, aber nicht überdeckt wird. Im Sinne von Tobias Janz könnte man bei dieser Satzaufteilung von zwei Pedalschichten sprechen. Beide Schichten bedienen zwar denselben ›Satz‹, also dieselben Tonhöhen, differieren aber in ihrer klanglichen Oberflächenstruktur: Die Streicher grundieren weiterhin durch ihre repetierte rhythmische Figur die Klangfläche, auf der sich die Singstimmen bewegen. Die Bläser sind durch ihre Haltetöne zwar auch an diesem Klanggrund beteiligt, haben aber wegen ihrer zweitaktigen Seufzer-Phrasierung darüber hinaus eine strukturierende bzw. motivische Funktion.
Mit Takt 1126 beginnt ein neuer Abschnitt. Der metrische Akzent, den die Bläser durch ihren Einsatz erzeugen (trotz der Pianissimo-Anweisung), markiert einen Neubeginn. Dieser Neubeginn ist aber keine ›Klanggrenze‹, die die beiden Taktgruppen voneinander trennen würde. Dadurch, dass sich die vorhergehenden Takte in diese Stelle hinein entwickeln und die Holzbläser, wie oben beschrieben, keinen Farbbruch, sondern eine klangliche Erweiterung und Intensivierung bringen, erlebt man in dem Akzent des Taktes 1126 keine Abgrenzung, sondern eher den Eintritt in eine neue Phase des Klanges. Der Texturaufbau ist zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und es beginnt der eigentliche ›Klangkern‹. Oder anders formuliert: Der Klang hat mit dem einsetzenden Bläsereinsatz seine strukturelle Mitte erreicht. Dass eine Orchester-Textur nicht nur im technischen Sinne aufgebaut wird, sondern dass der Aufbau zugleich als Vorführung der Entstehung angelegt ist, kann häufig bei Wagner beobachtet werden und ist typisch für die orchestrale Musik des späten 19. Jahrhunderts.
Nach viermaliger Wiederholung bzw. Versetzung des zweitaktigen Seufzermotivs bei konstanter Textur und Klangfarbe, werden Bläserstimmen und Streichersatz in Takt 1134 reduziert und um eine Oktave nach unten gelegt. Der Klangkern wird damit verlassen, die Takte 1134–1137 wirken echohaft.
Beispiel 7: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 2. Akt, T. 1117–1137, harmonische Reduktion
Die flächige Orchestertextur der Stelle hängt maßgeblich mit dem bereits erwähnten Orgelpunkt und den Techniken seiner Harmonisierung zusammen. Traditionell bedeutete ein Orgelpunkt, dass die Komposition auf einer harmonischen Stufe verweilt und dass die Akkorde über dem Orgelpunkt eine Art ›sekundäre Harmonik‹ bilden, die der Auskomponierung der gehaltenen Stufe dient. Im Prinzip geht die traditionelle Funktion der Orgelpunkte bei Wagner auf die Klangflächen über, die als satztechnische Nachfolger der Orgelpunkte erscheinen. Dennoch bleibt ein gewichtiger Unterschied: Während die Funktionen der auskomponierenden Akkorde über einem Orgelpunkt erhalten bleiben (eine V. Stufe über einem Tonika-Orgelpunkt bleibt eine Dominante), kann der Stufenzusammenhang von Akkorden, die zu einem Texturklang verbunden werden, in den Hintergrund treten. Im obigen Beispiel wird eindeutig eine As-Dur-Fläche ausgebreiten. Obwohl sich die verwendeten Akkorde als das traditionelle Auskomponieren eines As-Dur-Dreiklangs verstehen lassen, gibt es Anzeichen dafür, dass dieses Verständnis dem musikalischen Sinn der Stelle nicht vollkommen angemessen ist: Der Aufbau der Akkorde im Kernteil entspricht, unabhängig von ihrer Stufe, demjenigen traditioneller dominantischer Akkorde (kleine Dur-Septakkorde bzw. ein ganzverminderter Septakkord), die Eigenschaften der Akkorde entsprechen aber gar nicht denjenigen einer Dominante. Statt einer Tonika zuzustreben, scheinen sie auf sich selbst bezogen. Auch die Folge der Akkorde wäre unter diesen Umständen etwas anders als nach traditionellem Verständnis zu hören: Hier wie auch bei einem traditionellen Orgelpunkt geht es um das Auskomponieren eines eingangs gesetzten Klanges. Doch während die Akkordfolge über einem Orgelpunkt, wenn auch als eine sekundäre, immerhin eine Akkordfolge gewesen ist, so sind die Akkorde hier Bestandteile eines liegenden Klanges, der seine klangliche Oberfläche zwar variieren kann (indem verschiedene Akkorde zum Vorschein kommen), dessen Bestandteile sich aber nicht zu einer logisch-progressiv voranschreitenden Stufenbewegung verbinden. Für diesen Effekt sind die Vorhalte über den Septakkorden (große Sekunden) vermutlich mitentscheidend. Sie verströmen einen intensiven und warmen Klang und bilden zusammen mit dem Orgelpunkt im Bass den stabilen Rahmen, der die Akkorde zusammenschweißt und der für die flächige Wirkung verantwortlich ist. Die schrittweise Sequenzierung der Oberstimme in Takt 1130 intensiviert dabei die Klangwirkung. Die expressiven Vorhalte scheinen außerdem Auswirkungen auf den Dissonanzcharakter der sie grundierenden Septakkorde zu haben. Milde Vierklänge (keine kleine Sekunden oder große Septimen) werden durch schärfere Dissonanzen oder durch einen fünften Ton expressiv umspielt und erscheinen nach der Auflösung als Ruhepunkte. Sie wirken ›stabil‹. Dieses Phänomen begegnet immer wieder in der Wagner’schen Musik und ist auch an dieser Stelle gut wahrzunehmen. Nicht Es-Dur ist die Dominante von As-Dur, sondern beide Akkorde sind innerhalb des Texturklangs Klangvarianten derselben Funktion. Alleine das zusammenschweißende Klangband der Texturtechnik ermöglicht diese radikal neue Hörweise. Die Töne werden zu einer flächigen Einheit zusammengefügt (hier: Klangeinheit genannt), in der die Aufteilung in einzelne Akkorde sekundär wirkt und dadurch einen neuen Funktionstyp ausprägt.
* * *
Um den oben beschriebenen Formabschnitt funktional genauer einordnen zu können, müsste er mit den folgenden Abschnitten zusammen in den Blick genommen werden, was den Rahmen und das Anliegen des Artikels sprengen würde. Anhand eines kleinen harmonischen Details soll lediglich gezeigt werden, wie die Klangfarbe und damit die Instrumentationstechnik über das Etablieren von Klangeinheiten an der harmonischen Zusammenhangsbildung beteiligt ist.
In Takt 1138 folgt auf den erreichten Es-Dur-Septakkord ein Fes-Dur-Akkord (Bsp. 8). Auch in diesem Takt bleibt der Orgelpunkt As die tiefste Stimme, und die hohen Streicher führen den erwähnten Begleitrhythmus weiter. Beim ersten Blick in die Partitur könnte man daher vermuten, dass die Klangeinheit fortgesetzt und variiert würde. Aber beim Anhören der Stelle erkennt man einen deutlichen Bruch in der Klangkontinuität. An dieser Stelle beginnt ein neuer Teilabschnitt mit einer neuen Klangnote. Zu entscheiden, ob das vor allem ein klangfarblicher oder ein harmonischer Kontrast ist, fällt schwer. Beide Momente sind auch hier miteinander verwoben.
Harmonisch ist der Fes-Dur-Akkord sicher ein auffälliges Ereignis. Auf die Tonart As-Dur bezogen ist er eine chromatisch veränderte VI. Stufe, die einer langen Folge von diatonischen Hauptstufen folgt. Diese harmonische Beobachtung alleine reicht aber nicht aus, um die auffällige klangliche Separierung der beiden Akkorde zu erklären.
Erstens sind die neuen Töne des Akkordes (fes und ces) in den Takten 1124–1125 bereits antizipiert worden,
zweitens ist er mit den vorhergehenden Akkorden über den gemeinsamen Basston As verbunden,
und drittens könnte er als umspielende Nebenstufe des Es-Dur-Akkordes oder als chromatische Nebentoneinstellung zu einem evtl. tonikal folgenden As-Dur-Akkord sinnvoll tonal integriert werden.
Das hier ein harmonisch neues und trennendes Ereignis erlebt wird, kann also nicht nur rein harmonische Ursachen haben. Und tatsächlich lassen sich aus Beobachtungen der Instrumentation der Stelle einige Argumente für einen klangfarblichen Kontrast ziehen. Zum Ersten wird der Basston As zwar beibehalten, aber durch das Aussetzen der großen Oktave und der Cello-Klangfarbe wirkt der von den Bratschen gespielte Ton as fast wie ein frischer Basston, der zwar noch im Einflussbereich bzw. im Schatten des Orgelpunktes As liegt, aber eine neue luftigere Klangqualität besitzt. Es ist aber vor allem die neue Solo-Klangfarbe der ersten Oboe, die einen klanglichen Neuanfang und einen Phrasenbeginn markiert. Sie nutzt den vier Takte zuvor geöffneten leeren Raum in der zweigestrichenen Oktave aus, um sich in den Vordergrund zu spielen. Die Solo-Oboe ist über das Englischhorn und die beiden Klarinetten, die den Streichersatz verdoppeln, hörbar an den Begleitsatz angebunden. Die neue Klangqualität der Oboen-Solofarbe beherrscht dadurch scheinbar den ganzen Satz und prägt damit einen neuen Klangabschnitt aus. Der inszenierte Klangkontrast sorgt dafür, dass sich die beiden Klangabschnitte unterscheiden, wodurch sich auch die Harmonik ganz klar abgrenzt. Der Akkord in Takt 1138 hat sicher eine andere Funktion als die Akkorde im vorhergehenden Klangabschnitt. Mit ihm wird eine neue klangfarbliche und harmonische Sphäre etabliert. Der geänderte harmonische Fortgang (beziehbar auf eine lokale Tonart Ces- bzw. H-Dur) scheint ein fast natürliche Konsequenz aus diesem Kontrastmoment zu sein.
Eine genaue funktionale Analyse, die versucht den harmonischen Zusammenhang des gesamten Abschnittes zu deuten und die sich obigen Beobachtungen anschließen könnte, muss solche klanglichen Details berücksichtigen um genaue Ergebnisse zu erzielen.
Beispiel 8: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 2. Akt, T. 1136–1141, harmonische Reduktion
Eine Vergleichsstelle soll die Rolle der Klangfarbe an diesem Übergang verdeutlichen: Nachdem der viertaktige Kontrastteil in den Takten 1138–1141 zweifach sequenziert wurde, drängt die Musik wieder in eine an den Anfang erinnernde dichte Textur in einem zweifachen Orgelpunktrahmen (As + As1 im Bass und as3 im Diskant). In diesem Abschnitt, in den Takten 1152–1153, treffen wieder die beiden Akkorde Es7 und Fes aufeinander (Bsp. 9 und 10). Die Akkorde sind aber motivisch, harmonisch und klangfarblich ganz anders eingebunden: Sie sind Teil eines größeren, deutlich auf As-Dur bezogenen crescendierenden Texturklangs, wodurch sie eine ganz andere klangliche Beziehung zueinander eingehen, obwohl die stimmführungstechnischen Übergänge vollkommen identisch sind.
Beispiel 9: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 2. Akt, T. 1150–1157
Beispiel 10: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 2. Akt, T. 1150–1154, harmonische Reduktion
Der Fes-Dur-Akkord ist auch hier eine Attraktionsstelle, da er als Nebentoneinstellung zu dem folgenden As-Dur in der ansonsten kadenzierenden Harmonik auffällt und in Takt 1155 bekräftigend wiederholt wird. Diese harmonische Besonderung wird subtil durch die Dynamik und die Instrumententation verdeutlicht: In den Bläsern und den begleitenden Streichern ist mit dem Poco Forte ein dynamisches Zwischenziel erreicht, und das Wegfallen des Kontrabasstones zugunsten eines tremulierenden Cello-Klangs gibt der Wendung eine farblich intensivierende Note. Dieses leichte Hervorleuchten innerhalb eines Klangabschnittes ist natürlich ein ganz anderer klanglich-harmonischer Effekt als die Klangbegrenzung in Takt 1138 und muss daher auch anders analysiert werden. Die harmonische Funktion beider Akkordwendungen ist eine andere.
Anmerkungen
Der hier angewandte Klangfarbenbegriff unterscheidet sich von dem im 19. Jahrhundert entstandenen und vor allem von Hermann von Helmholtz (1863) geprägten akustisch-physikalischen Klangfarbenbegriff, der die »tönende Realität« und deren Hervorbringung beschreiben will. Nach Michael Polth (2003, 331) ist die Klangfarbe »eine Funktion des ästhetischen Gegenstandes, eine (durch die Komposition selbst vermittelte) Art, wie der Ton (oder Akkord) in seiner tönenden Realität wahrgenommen werden soll. Als solche schimmert Klangfarbe durch die diversen Techniken der Instrumentierung hindurch, ohne in ihnen aufzugehen.« Die beiden Begriffe »Instrumentation« und »Klangfarbe« sind damit eng miteinander verknüpft. Sie sind, bildhaft gesprochen, verschiedene Seiten derselben Medaille und müssen doch klar auseinander gehalten werden. Instrumentation ist eine Technik des Komponierens und Klangfarbe ist ein Gegenstand der ästhetischen Wahrnehmung. | |
Beschreibungen der instrumentationstechnischen Neuerung insbesondere bei Wagner finden sich seit den ersten Hinweisen in Richard Strauss’ Bearbeitung der Berlioz’schen Instrumentationslehre (Berlioz/Strauss 1904) vor allem in verschiedenen Lehrwerken zur Instrumentation und in einigen Spezialuntersuchungen. Vgl. etwa Thomas 1899, Erpf 1959 und Voss 1970. | |
Vgl. Adorno 1997, 68–81. | |
Ebd., 68. Vgl. Klein 1991, 87. | |
Dahlhaus 1985, 161. | |
Ebd., 161. | |
Janz 2006, 9ff. | |
Ebd., 13. | |
Ebd., 16. | |
Ebd., 14. | |
Ebd., 10. | |
Ähnliches betrifft auch andere Teilmomente der Komposition: Auch die Rhythmik ist kein Medium, das lediglich Tonhöhenstrukturen transportiert. Durch das Benennen von Funktionen hilft die rhythmische Struktur zusammen mit den Tonhöhenstrukturen musikalischen Zusammenhang analytisch festzumachen. Anders als bei der Klangfarbe scheint diese Kopplung aber eher selten zu Verwirrungen zu führen. | |
In diesem Sinne demonstriert Michael Polth verschiedene Funktionen der Medial Caesura in Sonatenexpositionen (2013, 379–387). | |
Vgl. Janz 2006, 18 und 133–137. | |
Bereits die Definition von Klangfarbe bereitet bei genauerem Hinsehen große Probleme. Will man sich nicht auf einen pseudo-naturwissenschaftlichen Erklärungsversuch einlassen, fällt es sehr schwer Klangfarbe, als eigenständigen musikalischen Parameter zu etablieren. Die ästhetische Kategorie Klangfarbe hängt enorm vom jeweiligen Zusammenhang ab. Wollte man alle ›Einflüsse von außen‹ abstreifen, bliebe nicht viel übrig, was man als Klangfarbe bezeichnen könnte. Der Klang einer Klarinette ist ohne eine bestimmte Tonhöhe oder Lautstärke nicht vorstellbar! (Umgekehrt funktioniert das deutlich einfacher: Es ist durchaus möglich sich den Ton A ohne konkrete Klangfarbe zu imaginieren. Vermutlich ist ein hörphysiologisches Phänomen dafür verantwortlich, dass wir Tonhöhen viel leichter aus einem Schallereignis abstrahieren können als die Klangfarbe.) Janz spricht in seinem Buch nie von der Klangfarbe, sondern nutzt Begriffe wie ›Klang‹, ›klangliche Oberflächenstruktur‹ oder ›sinnliche Präsenz‹ um deutlich zu zeigen, dass er keinen einzelnen musikalischen Parameter meint, sondern ein klangliches Resultat aus vielen Momenten des Tonsatzes. Ob er dabei Klangfarbe mit klanglicher Oberflächenstruktur gleichsetzt oder Klangfarbe als ein Teilmoment zur Hervorbringung der Oberflächenstruktur sieht, bleibt vage. | |
Vgl. Födermayr 1996, Spalte 153f. | |
Ein Beispiel soll das illustrieren: Die Möglichkeit Dreiklänge zu definieren und diese als funktionale Gebilde in den konkreten Tonhöhenstrukturen der Musikstücke erleben zu können, hängt stark mit dem objektivierbaren Kriterium zusammen, dass sich nur bestimmte Töne – nämlich drei Töne in einer bestimmten Intervall-Konstellationen – zu Dreiklängen verbinden können. Töne müssen sich je nach konkretem Zusammenhang nicht unbedingt zu Dreiklängen verbinden, tun dies in einer bestimmten Musikepoche aber regelmäßig auf die gleiche objektivierbare Art und Weise. | |
Janz 2006, 9. | |
Ebd., 17–23; 63–87; 133–146. | |
Vgl. ebd., 243ff. | |
Als dritter eigenständiger Bereich, weswegen bestimmte Instrumente benutzt werden, könnte eventuell auch die Dynamik aufgeführt werden. Wobei man anmerken muss, dass bei Wagner im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Gesamtdynamik häufig unabhängig von der instrumentalen Stärke des Satzes ist. | |
Selbst der romantische Klaviersatz kennt vielfältige Möglichkeiten der ›Instrumentation‹. Daher kann an manchen Stellen des Tonsatzes nicht entschieden werden, ob etwa die Lagenverteilung eines Akkordes aus harmonischen oder klangfarblichen Gründen geschah. | |
Aber auch schon bei der fast ›alltägliche‹ Terzkopplung zweier Stimmen, wie sie bereits im 18. Jahrhundert hundertfach verwendet wurde, ist es nicht immer eindeutig bestimmbar, ob die angekoppelte Stimme wirklich als satztechnische Stimme zu verstehen ist oder nur als »Farbkopplung«. Oft scheinen solche Mixtur-Kopplungen deutlich beides – harmonische und klangfarbliche Effekte – hervorzurufen. Sie gehören beiden Bereichen an, ohne vollkommen in einem davon aufzugehen. (Vgl. Janz 2006, 119) | |
Ebd., 255. | |
Ebd. | |
Zur Verdeutlichung betrachte man das von Janz angeführte bekannte Beispiel aus dem 2. Akt der Walküre (ebd., 259f.). | |
Vgl. den Abschnitt »Raum und Textur« (ebd., 63ff.). | |
Ebd., 255. | |
Vgl. die Analyse im Abschnitt IV dieses Artikels. | |
Schon der deutliche Unterschied in der Größe des Orchesterapparates der beiden Werke weist in diese Richtung. | |
Poos 1987, 46ff. und Urmoneit 2005, 54–64 und 112–124. | |
Auch das Metrum scheint erst mit Beginn des orchestralen Klangs in Gang gesetzt zu werden. Das notierte Taktgefüge nimmt man im Eröffnungsabschnitt aufgrund der mit Pausen durchsetzten amorphen rhythmischen Struktur nicht wahr. | |
Die Klangwirkung eines solchen Orchestertuttis wird später mit dem von Janz etablierten Begriff ›Texturprinzip‹ belegt. Vgl. Janz 2006, 63–87 oder Abschnitt V dieses Artikels. | |
Schönberg 2007, 220. | |
Auch der rezitativische Abschnitt unmittelbar vor dem kadenzierenden Holzbläsersatz lässt sich problemlos auf die Tonart c-Moll beziehen (T. 368–374). | |
Janz 2006, 70. | |
Lichtenfeld 1970, 161ff. | |
Vgl. Janz, 2006, 64ff. | |
Der Begriff »Zwiegespräch« wurde von Carl Dahlhaus übernommen (1974, 475). | |
Vgl. die Vortragsanweisung der Holzbläser in T. 1126. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1997), »Versuch über Wagner«, in: Die musikalischen Monographien (= Gesammelte Schriften 13), Frankfurt a.M: Suhrkamp, 7–148.
Berlioz, Hector / Strauss, Richard (1904), Instrumentationslehre, Leipzig: Peters.
Dahlhaus, Carl (1974), »Wagners ›Kunst des Übergangs‹. Der Zwiegesang in Tristan und Isolde«, in: Zur musikalischen Analyse (= Wege der Forschung 257), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 475–487.
––– (1985), »Zur Theorie der Instrumentation«, Die Musikforschung 38, 161–169.
Erpf, Hermann (1959), Lehrbuch der Instrumentation und Instrumentenkunde, Mainz: Schott.
Födermayr, Franz (1996), Art. »Klangfarbe«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, neubearbeitete Ausgabe, hg. von Friedrich Blume und Ludwig Finscher, Sachteil Bd. 5, Kassel u.a.: Bärenreiter, 138–170.
Helmholz, Hermann (1863), Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, Braunschweig: Vieweg.
Janz, Tobias (2006), Klangdramaturgie. Studien zur theatralen Orchesterkomposition in Wagner »Ring des Nibelungen«, Würzburg: Königshaus & Neumann.
Klein, Richard (1991), »Farbe versus Faktur. Kritische Anmerkungen zu einer These Adornos über die Kompositionstechnik Richard Wagners«, AfMw 48, 87–109.
Lichtenfeld, Monika (1970), »Zur Technik der Klangflächenkomposition bei Wagner«, in: Das Drama Richard Wagners als musikalisches Kunstwerk, hg. von Carl Dahlhaus, Regensburg: Bosse, 161–167.
Polth, Michael (2003), »Klangfarbe und Orchestertechnik«, in: Richard Wagner und seine Zeit, hg. von Eckehard Kiem und Ludwig Holtmeier, Laaber: Laaber, 331–346.
––– (2013), »Funktionen der Medial Caesura. Beobachtungen zu Mozarts Klaviersonaten KV 279 – KV 284«, in: Kreativität – Struktur und Emotion, hg. von Andreas Lehmann, Ariane Jeßulat und Christoph Wünsch, Würzburg: Königshausen & Neumann, 379–387.
Poos, Heinrich (1987), »Die Tristan-Hieroglyphe. Ein allegorischer Versuch«, in: Musik-Konzepte, Heft 57/58 (Richard Wagner/Tristan und Isolde), hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: Edition Text + Kritik, 46–103.
Schönberg, Arnold (2007), »Brahms the Progressive«, in: ders., Stile herrschen, Gedanken siegen. Ausgewählte Schriften, hg. von Anna Maria Morazzoni, Mainz: Schott, 215–254.
Thomas, Eugène (1899), Die Instrumentation der Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner, Mannheim: Heckel.
Urmoneit, Sebastian (2005), Tristan und Isolde – Eros und Thanatos, Sinzig: Studio.
Voss, Egon (1970), Studien zur Instrumentation Richard Wagners, Regensburg: Bosse.
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim [Mannheim University of Music and Performing Arts]
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.