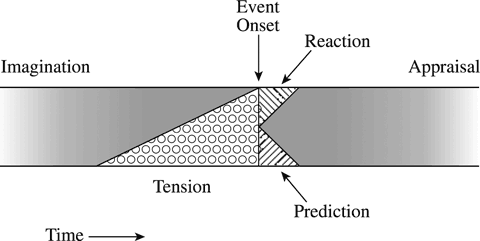David Huron, Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation, Cambridge: MIT Press 2006
Oliver Schwab-Felisch
Der wichtigste Faktor in dem Seelenvorgang, welcher das Auffassen eines Tonwerks begleitet und zum Genusse macht, wird am häufigsten übersehen. Es ist die geistige Befriedigung, die der Hörer darin findet, den Absichten des Komponisten fortwährend zu folgen und voranzueilen, sich in seinen Vermutungen hier bestätigt, dort angenehm getäuscht zu finden. Es versteht sich, daß dieses intellektuelle Hinüber- und Herüberströmen, dieses fortwährende Geben und Empfangen, unbewußt und blitzschnell vor sich geht. Nur solche Musik wird vollen künstlerischen Genuß bieten, welche dies geistige Nachfolgen, welches ganz eigentlich ein Nachdenken der Phantasie genannt werden könnte, hervorruft und lohnt. Ohne geistige Tätigkeit gibt es überhaupt keinen ästhetischen Genuß. Der Musik aber ist diese Form von Geistestätigkeit darum vorzüglich eigen, weil ihre Werke nicht unverrückbar und mit Einem Schlag dastehen, sondern sich sukzessiv am Hörer abspinnen, daher sie von diesem kein, ein beliebiges Verweilen und Unterbrechen zulassendes Betrachten, sondern ein in schärfster Wachsamkeit unermüdliches Begleiten fordern.[1]
Die Einsicht, dass die ästhetische Wahrnehmung musikalischer Gegenstände durch musikbezogene Erwartungen entscheidend geprägt wird, ist, so zeigt das Zitat, keineswegs neu. Erst Leonard B. Meyers 1956 publizierte, eminent einflussreiche Dissertation Emotion and Meaning in Music aber stellte sie in den Mittelpunkt einer eigenen Theorie – einer Theorie, die der genuin musikästhetischen Frage nach den Möglichkeitsbedingungen musikalischer Bedeutung nicht zuletzt im Rekurs auf human- und formalwissenschaftliche Ansätze wie Gestalttheorie, Konflikttheorie der Emotion[2] und Informationstheorie[3] nachgeht.
Seit Erscheinen des Meyer’schen Buches hat sich das Wissen über perzeptive und kognitive Grundlagen der Erwartung immens vermehrt. Musik kommt dabei gerade dort eine besondere Bedeutung zu, wo es um Fragen der kognitiven Repräsentation und Verarbeitung temporaler Ereignisrelationen geht: Musikalische Strukturen sind übersichtlicher als Handlungsstrukturen, zielen häufig auf die Erzeugung von Emotionen, spielen mit den Erwartungen der Hörer und sind im Notentext präzise festgehalten.[4] Mit Sweet Anticipation hat David Huron nun exakt 50 Jahre nach Meyers Buch eine Publikation vorgelegt, die einen beträchtlichen Teil der verstreut publizierten Forschungen zum Thema zusammenfasst, in den Kontext einer neuen Theorie stellt und durch eigene, bis dato überwiegend unpublizierte Forschungen ergänzt. Huron verzichtet auf den Entwurf einer eigenen musikalischen Strukturtheorie[5] und lässt Konflikt- und Gestalttheorie – Angelpunkte der Methode noch bei Meyer – zugunsten von Evolutionsbiologie und Statistik fallen. Beide Schwerpunkte folgen jüngeren Entwicklungen: Evolutionsbiologische Strömungen in der Experimentellen Ästhetik[6] erfahren in den letzten Jahren ebenso wie statistische Verfahren der musikalischen Analyse einen bemerkenswerten Aufschwung.[7]
Ein Großteil unserer Reaktionen auf Musik, so Hurons zentrale These, beruht auf evolutionsbiologisch erworbenen Strategien, das Überleben des Individuums und der Art zu sichern. Die Fähigkeit, Ereignisse vorauszusehen, entscheidet mit darüber, ob sich ein Organismus in einer feindlichen Umwelt zu behaupten vermag: Die imaginative Vorwegnahme des Künftigen kann uns dazu befähigen, negative Erfahrungen zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit positiver Erfahrungen zu erhöhen. Sind unerfreuliche künftige Ereignisse weder zu verhindern noch zu umgehen, helfen Erwartungen dabei, sich bestmöglich auf sie vorzubereiten: Ein künftiges Ereignis, dessen Raum-Zeit-Koordinaten bekannt sind, wird schneller wahrgenommen und verarbeitet als ein unvorhergesehenes; überlebenswichtige Verhaltensweisen werden bei entsprechender physiologischer Aktivierung schneller abgerufen. Schließlich dient der Vergleich von Erwartung und Wirklichkeit der Überprüfung unserer mentalen Repräsentationen von Welt: Die erfolgreiche Vorhersage bestätigt ihre Angemessenheit, die gescheiterte ihre Verbesserungswürdigkeit (109). Emotion ist hier ein entscheidender Faktor: Sie macht uns unsere eigenen Aktivierungszustände fühlbar, belohnt adaptives und bestraft maladaptives Verhalten. Entsprechend sucht Hurons allgemeine Theorie zu erklären, auf welche Weise Erwartungen verschiedene Gefühlszustände hervorrufen und weshalb diese evozierten Gefühle biologisch nützlich sein könnten.[8]
Sweet Anticipation umfasst 380 in 17 Kapitel gegliederte Textseiten, dazu kommen 28 Seiten Anmerkungen, 14 Seiten Glossar, 26 Seiten Literaturverzeichnis, 14 Seiten kombiniertes Sach- und Personenregister, insgesamt 462 Seiten. Eine Website mit weiteren Materialien – Klangbeispielen, einem Online-Glossar und zusätzlichen Indizes – ergänzt das Buch.[9]
ITPRA
Hurons ITPRA-Theorie präzisiert den Zusammenhang zwischen Erwartung und Emotion. ITPRA ist ein Akronym aus den Initialen der Termini ›Imagination response‹, ›Tension response‹, ›Prediction response‹, ›Reaction response‹ und ›Appraisal response‹. Jeder dieser Termini bezeichnet die Aktivität eines von fünf funktional eigenständigen physiologischen Systemen – Systemen, die bestimmte Weisen instantiieren, sich zu einem realweltlichen Ereignis zu verhalten.
– Als Imagination response bezeichnet Huron die mentale Vorwegnahme eines künftigen Ereignisses. Ihr Zweck besteht unter anderem darin, teleologisches Handeln zu motivieren: unerwünschte Ereignisse abzuwenden oder erwünschte Ereignisse herbeizuführen.
– Die Tension response dient der bestmöglichen Vorbereitung auf ein künftiges Ereignis: Sie geht mit einer Schärfung der Aufmerksamkeit und Anhebung des Erregungsniveaus (›Arousal‹) einher und ermöglicht es so, Verhaltensweisen wie Kampf oder Flucht in kürzester Zeit abzurufen.
– Die Prediction Response richtet sich nicht auf das Ereignis selbst, sondern, als autoevaluative Funktion, auf die Güte seiner Vorhersage: Bei einer inkorrekten Vorhersage bestraft sie den Organismus durch ein negatives Gefühl und belohnt ihn bei einer korrekten durch ein positives – und dies sogar dann, wenn das vorausgesagte Ereignis selbst unerfreulich ist.[10] Die Prediction Response liefert auch eine neue Erklärung des sogenannten ›Mere-Exposure Effekts‹ – der Tatsache, dass Dinge und Menschen unter bestimmten Bedingungen umso positiver bewertet werden, je vertrauter sie sind.[11] Hurons Hypothese lautet, das positive Gefühl, mit dem die Prediction response korrekte Vorhersagen belohnt, werde qua Fehlattribution (›misattribution‹) dem auslösenden Objekt zugeschrieben (138).
– Die Reaction response ist eine weniger als 150 Millisekunden nach Beginn des auslösenden Ereignisses einsetzende und ebenso automatisch wie unbewusst ablaufende physische Reaktion, deren konstantes Prinzip die Annahme des schlimmstmöglichen Falls ist: Verspätet zu reagieren kann in einer bedrohlichen Situation weitreichende Folgen haben (13). Überraschungen lösen demnach eine von drei Verhaltensweisen aus: Besteht Aussicht auf einen Sieg, entschließt sich der Organismus zu kämpfen (›fight‹); besteht eine solche Aussicht nicht, sucht er zu fliehen (›flight‹), oder, sofern dies nicht möglich ist, sich tot zu stellen (›freeze‹).
– Die Appraisal response liefert eine zweite, nunmehr bewusste Einschätzung des Sachverhalts und seines situativen Kontexts. Da die Appraisal response eine detaillierte Analyse aller relevanten Informationen vollzieht, läuft sie deutlich langsamer ab als die beiden unmittelbar nach Eintritt des Ereignisses folgenden Reaktionen. Die Appraisal Response kann die erste Einschätzung der Reaction Response entweder bestätigen oder aber ihr widersprechen: Möglicherweise stellt sich bei genauerer Analyse heraus, dass eine Situation nicht so bedrohlich ist, wie die Reaction response zunächst unterstellt hatte.
Abbildung 1: Die Aktivierung der fünf durch das Akronym ITPRA benannten Reaktionssysteme im zeitlichen Ablauf[12]
Überraschung: ›laughter‹, ›frisson‹, ›awe‹
Erwartungen sind eine besondere Quelle musikalischer Lust: Die Vorstellung, die Aktivitäten des Musizierens und Musikhörens seien nicht in erster Linie durch die Erfahrung positiver Emotionen motiviert, hält Huron für biologisch unplausibel (373).[13] Erlebnisse, die Erwartungen bestätigen, werden durch die Prediction response positiv gefärbt. Dass allerdings auch musikalische Überraschungen als eine wichtige Quelle musikalischen Vergnügens gelten sollen, mag auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen – schließlich signalisiert die Reaction Response eine unzureichende Adaption des Organismus. Zur Erklärung muss man ein wenig ausholen: Überraschung, so wurde bereits oben gesagt, löst je nach Situation eine der drei Verhaltensweisen Kämpfen, Fliehen oder Erstarren aus. Als (zum Teil komplex vermittelte) psychophysiologische Korrelate dieser Reaktionen auf eine bedrohliche Situation sieht Huron die ›Emotionen‹ ›Lachen‹ (›laughter‹), ›Ehrfurcht‹ (›awe‹) und ›Schauer‹ (›frisson‹):[14] Schauer gehen auf den Versuch eines kampfbereiten Organismus zurück, durch Piloerektion für den Gegner bedrohlich zu wirken, Lachen ist ursprünglich eine Vokalisation des Hechelns, mit dem sich ein Organismus auf die Flucht aus einer bedrohlichen Situation vorbereitet (31), Ehrfurcht eine Begleiterscheinung des Erstarrens angesichts einer übermächtigen Gefahr. Wann immer also Musik eine der drei Reaktionen auslöst, ist die ›Biologie des Pessimismus‹ am Werk (28). Musikalische Überraschungen nun machen sich die Unabhängigkeit von Reaction Response und Appraisal Response zunutze. Ein in freundlicher Absicht erschreckter Mensch durchläuft zunächst eine Phase, in der die schnellen Systeme der Reaction Response Gefahr signalisieren und die Prediction Response die Unvorbereitetheit ihres Trägers mit einem negativen Gefühl bestraft, erfährt aber in dem Moment, wo ihm das Positive der tatsächlichen Umstände bewusst wird, ein Gefühl der Erleichterung, das durch den ›limbischen Kontrast‹ zu der vorhergehenden negativen Emotion nur noch verstärkt wird. Die Freude an der Musik verdankt sich demnach wesentlich dem Phänomen der ›kontrastiven Valenz‹ (21–25).
Statistisches Lernen und Ordnungen der Wahrscheinlichkeit
Als eine Form der Anpassung an Umwelten, deren Instabilität ein konstantes generationsübergreifendes Reaktionsmuster nicht zu etablieren erlaubt, ist die Disposition zu lernen nicht minder ein Produkt der Evolution als jeder angeborene Instinkt (63).[15] Lernen geschieht nicht immer bewusst und absichtsvoll. Auch ohne explizit erworbenes musikalisches Wissen verfügen enkulturierte Hörer über die Fähigkeit, Musik als einen strukturierten und sinnvollen Zusammenhang wahrzunehmen – eine Fähigkeit, die sich etwa daran zeigt, dass zumindest oberflächliche Störungen regulärer musikalischer Zusammenhänge auch von musikalisch illiteraten Personen zuverlässig erkannt werden. Die Aneignung entsprechenden Regelwissens erfolgt nicht anders als im Fall der Sprache ebenso unbewusst wie mühelos; die Psychologie spricht von implizitem Lernen.[16] Statistisches Lernen, also das Lernen von Häufigkeiten und Übergangswahrscheinlichkeiten, bildet eine spezifische Art impliziten Lernens.
Statistische Regularitäten werden über Ordnungen von Wahrscheinlichkeit differenziert. Wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Ereignisses unabhängig von anderen Ereignissen betrachtet, spricht man von einer ›unbedingten Wahrscheinlichkeit‹ oder ›Wahrscheinlichkeit nullter Ordnung‹. Hängt sie dagegen von einem anderen Ereignis ab, ist von einer ›bedingten Wahrscheinlichkeit erster Ordnung‹ die Rede, kommen zwei Ereignisse in Betracht, von einer ›Wahrscheinlichkeit zweiter Ordnung‹ – und so weiter (56). Im Hinblick auf Tonhöhen analysiert Huron Wahrscheinlichkeiten nullter und erster Ordnung; allein im Hinblick auf metrische Strukturen kommen auch Wahrscheinlichkeiten höherer Ordnung zur Sprache.
Objektive Datenstrukturen analysiert Huron mit Hilfe von Humdrum, einem in den 1990er Jahren von ihm selbst entwickelten System, das die statistische Auswertung entsprechend formatierter Partiturdaten unter im Prinzip unbegrenzt vielen Fragestellungen ermöglicht.[17] Zwar eignet sich Humdrum prinzipiell auch zur Analyse einzelner Kompositionen (Huron demonstriert das mit einer Motiv-Analyse des Streichquartetts op. 51/1 von Johannes Brahms [260–262]). Die meisten statistischen Untersuchungen in Sweet Anticipation aber gelten umfangreichen Korpora wie etwa Helmut Schaffraths Essen Folksong Collection.[18]
Mentale Repräsentationen musikalischer Regularitäten entsprechen keineswegs immer den objektiven statistischen Gegebenheiten: Es scheint, als rekurrierten Hörer bei der Erwartung von Ereignissen häufig auf ›heuristisches Wissen‹ (91) – Faustregeln, die bestimmte Stilcharakteristika lediglich näherungsweise erfassen, dafür aber kognitiv ökonomischer anzuwenden sind. Leonard B. Meyers Prinzip des ›gap-fill‹ etwa, demzufolge nach einem großen Intervall ein Intervall in Gegenrichtung wahrscheinlich ist, entspricht zwar den Hörerwartungen der Versuchspersonen, erklärt faktische Datenstrukturen aber weniger gut als das statistische Prinzip der Regression zum Mittelwert (›Melodic Regression‹): Große Intervalle werden mit größerer Wahrscheinlichkeit von Intervallen in der Gegenrichtung gefolgt, wenn sie vom melodischen Mittelwert ausgehen, den Mittelwert kreuzen oder beim Mittelwert enden (80–85). Nähern sie sich dagegen dem Mittelwert, ohne ihn zu kreuzen, zeigt sich eine leichte Tendenz zu einem Folgeintervall in gleicher Richtung. Differenzierungen wie diese angemessen zu repräsentieren, erforderte Einiges an Gedächtnisleistung; das allgemeine Prinzip des ›gap-fill‹ bzw. ›post-skip-reversal‹ dagegen ist wesentlich unaufwändiger umzusetzen und annähernd ebenso effektiv (92f.) Ein zweites Beispiel: Die Tendenz zur Fortsetzung eines Musters schrittweiser melodischer Fortschreitungen kommt in Melodien häufig nur bei fallenden melodischen Intervallen vor (›Step Inertia‹), Hörer aber erwarten sie ebenso für steigende: Die Übergeneralisierung realisiert ein optimales Verhältnis von Genauigkeit und Geschwindigkeit der Vorhersage (77–80). Statistisches Lernen erfolgt somit keineswegs stimulusgetreu, sondern wird durch die spezifischen Bedingungen des menschlichen kognitiven Apparates beeinflusst.
Mentale Repräsentationen
Die mentale Repräsentation statistisch gelernten Wissens wird in zwei separaten Kapiteln behandelt. Kapitel 7 beleuchtet Fragen der merkmalsbezogenen perzeptuellen Analyse sensorischer Daten: So unterscheidet Huron am Beispiel der Schalllokalisation eine basale Ebene der neuronalen Codierung von übergeordneten Repräsentationsebenen, auf denen niedrigstufige Repräsentationen von Laufzeit- und Amplitudendifferenzen in höherstufige Perzepte wie Azimuth, Elevation und Entfernung oder Ort, Geschwindigkeit und Trajektorie umgesetzt werden. Ähnliches gilt für die mentale Repräsentation von Tonhöhen: Auch hier differenziert Huron zwischen einer basalen Ebene der tonotopen respektive temporalen Codierung von Tonhöhen und höheren Repräsentationen etwa von Tonhöhenklassen oder Akkordtypen. Simultane Repräsentationen können einerseits verschiedene Aspekte eines Objekts beschreiben (›Correlated Representations‹ [114–117]), stehen andererseits aber auch in Konkurrenz zueinander (›Neural Darwinism‹ [107–110]), wobei die Prediction Response darüber entscheidet, welche Repräsentationen beibehalten und verstärkt werden (127). Bestimmte Repräsentationen zieht ›das Gehirn‹[19] tendenziell anderen vor: Verbindungen benachbarter Elemente solchen entfernter, Relationen niedriger solchen höherer Ordnung und niedrigere Ableitungsstadien höheren.
Kapitel 12 ordnet den vier wichtigsten Typen des Gedächtnisses vier verschiedene Typen der Erwartung zu:
(1) Das semantische Langzeitgedächtnis liegt der ›schematischen Erwartung‹ zugrunde – einer Erwartung, die sich auf genau die allgemeinen Merkmale eines Objekts, Sachverhalts oder Ereignisses richtet, die zuvor in einem kognitiven Schema abstrahiert wurden.
(2) Das episodische Langzeitgedächtnis (221–224) ist die Voraussetzung der sogenannten ›veridikalen Erwartung‹, die sich auf spezifische Merkmalskonstellationen richtet, die entweder konstant bestehen (wie physische Objekte) oder einen bestimmten singulären Ereignistyp instantiieren (wie etwa Aufführungen musikalischer Kompositionen). Die Unterscheidung zwischen schematischen und veridikalen Erwartungen vermag Huron zufolge auch ein altes Rätsel der Expektanzforschung zu lösen: Über 99% der Zeit, in der wir Musik hören, besteht aus Wiederholungen bereits zuvor gehörter Musiken (241). Wenn nun Überraschung einen wesentlichen Anteil zumindest an emotionalen Reaktionen wie Lachen, Ehrfurcht und Schauer hat, stellt sich das bekannte Problem, dass wir musikalische Überraschungen auch dann noch als Erwartungsdiskrepanzen wahrnehmen, wenn wir ein Stück mehrfach gehört haben und den Gang der Ereignisse vorhersehen können.[20] Meyer versuchte das Problem unter anderem durch die These zu lösen, Kunstmusik sei so komplex, dass sie immer wieder aufs Neue zu überraschen vermöge.[21] Ray Jackendoff schlug ein Analysemodell vor, demzufolge während des Hörens eine Mehrzahl von Analysen gleichzeitig durchgeführt werden, wobei der informationell gekapselt operierende mentale Parser stets so verfährt, als höre er das Stück zum ersten Mal.[22] Hurons Lösung basiert auf der ITPRA-Theorie: Die für Überraschungen zuständige Reaction Response kennt keine Wiederholungen, sie reagiert in jedem einzelnen Fall neu. Das scheinbare Paradox, dass sie dabei einerseits auf eine gelernte Vorstellung musikalischer Regularitäten zugreifen kann, sich andererseits aber durch wiederholte Erfahrungen derselben Stimuli nicht beeinflussen lässt, kann durch die Unterscheidung schematischer und veridikaler Erwartungen aufgelöst werden (225–227): Erstere gründen auf Generalisierungen, letzere dagegen auf Spezifika eines individuellen Stimulus.[23] Erfahrungen vermögen die Reaction Response erst dann zu beeinflussen, wenn sie über die Wiederholung hinreichend vieler verschiedener Instanzen zu einen Schema generalisiert worden sind.
(3) ›Dynamische Erwartungen‹ (227–231) basieren auf der Aktivität des Kurzzeitgedächtnisses und des mittelfristigen Gedächtnisses (›intermediate term memory‹): Sie entstehen aus innerhalb einer Spanne von höchstens 10–12 Sekunden auftretenden Regularitäten und erzeugen die Erwartung, eben diese Regularitäten würden perpetuiert.
(4) ›Bewusste Erwartungen‹ (235–237) verdanken sich expliziten kognitiven Operationen wie etwa der rationalen Einsicht in die strukturellen Prinzipien einer Komposition. Entscheidend ist die Bildung von Erwartungen aus sprachlich artikulierbarem Wissen. Huron sieht hier das Arbeitsgedächtnis als die entsprechende Gedächtnisform – nicht im Sinne des Kurzzeitgedächtnisses, sondern eines ›mentalen Desktops‹, der die für eine Situation relevanten Gedächtnisinhalte für den Zugriff bereithält.
Tonalität: Qualia
Wer unter dem Stichwort ›Tonality‹ (Kap. 9) eine eigene Theorie erwartet, wird enttäuscht: Huron betont, nur einige Aspekte des komplexen Gegenstandes Tonalität diskutieren zu wollen (143f.) – darunter ästhetische Qualitäten von Skalentönen, Carols Krumhansls Tonartenprofile, die Wahrnehmung von Geschlossenheit, Übergangswahrscheinlichkeiten in deutschen Volksliedern und kulturübergreifendes statistisches Lernen von Tonsystemen.[24]
Hier sei nur kurz auf den Abschnitt zu musikalischen Qualia eingegangen. Huron geht von der Beobachtung aus, dass bestimmten Skalenstufen regelmäßig bestimmte Qualitäten zugeschrieben werden. Drei dieser Qualitäten, nämlich ›Tendency‹, ›Closure‹ und ›Pleasure‹, sind Huron zufolge einer statistischen Erklärung zugänglich. Dies sei am Beispiel der Leittontendenz exemplifiziert. Während das klassische energetische Argument besagt, der Leitton sei deshalb nach oben aufzulösen, weil ihm eine »im melodischen Zusammenhang hervortretende, in einen Zielton gerichtete Bewegung« zu Grunde liegt[25], argumentiert Huron umgekehrt: Ihm zufolge lösen Töne dann die Empfindung einer Tendenz aus, wenn eine bestimmte Wahrscheinlichkeit erster Ordnung erwarten lässt, dass ihnen bestimmte andere Töne folgen. Ist dagegen eine Pause das wahrscheinlichste Ereignis, entsteht die Qualität der Geschlossenheit. Auch das Quale ›ästhetische Lust‹ (›pleasure‹) erscheint als direkte Konsequenz der gelernten hohen Wahrscheinlichkeit musikalischer Ereignisse (167): Tritt eine erwartete Stufe tatsächlich ein, belohnt die Prediction response die korrekte Vorhersage. Das positive Gefühl wird aber nicht der Korrektheit der Vorhersage, sondern – qua Fehlattribution – dem vorhergesagten Gegenstand zugeschrieben (138). Allgemein sind positiv besetzte Qualia mit Tönen verknüpft, die häufig erscheinen und mit Geschlossenheit assoziiert sind. So wurden die Töne des Tonikadreiklangs mit Begriffen wie ›Wärme‹, ›Schönheit‹ und ›Liebe‹ beschrieben, während chromatisch erhöhte Stufen – Stufen, die zu einer ebenso hohen wie spezifischen Erwartung führen – den Gebrauch von Epitheta wie ›harsch‹, ›schrill‹ und ›beklommen‹ provozierten.[26] Ähnliches gilt für chromatische mediantische Harmonien (274).
Rezeption
Rezensenten loben die Fülle der in langjähriger Forschungstätigkeit gesammelten Einsichten[27], die Verknüpfung von Erkenntnissen aus Musiktheorie, Evolutionstheorie, Neurobiologie und Kognitionswissenschaften sowie eine Theoriebildung, die sich auf einen breiten konzeptionellen Hintergrund und solide experimentelle Arbeit stütze.[28] Huron habe sich nicht mit der Zusammenfassung existierender Arbeiten begnügt, sondern präsentiere auch eine Vielzahl bislang unpublizierter Forschungen.[29] So beleuchte er mehrere bislang unberücksichtigte Emotionen und mache sie durch plausible psychologische und evolutionsbiologische Erklärungen verständlich.[30] Umfassend sei auch der Gegenstandsbereich des Buches: Musikbeispiele aus unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und stilistischen Kontexten fänden Berücksichtigung. Schließlich gebe Sweet Anticipation eine Fülle von Anregungen für künftige empirische Studien.[31]
Überwiegend positiv wird auch Hurons statistische Methode beurteilt. Während die meisten Musiktheoretiker bislang davor zurückgescheut sein dürften, umfassende Korpora durchzusehen, um sich von der Richtigkeit einer intuitiv gefundenen analytischen Generalisierung zu überzeugen, ermögliche es das statistische Procedere, musikalische Sachverhalte auf der Basis überwältigender Fallzahlen objektiv zu beschreiben.[32] Dass Huron zu Feststellungen gelange wie jener altbekannten, Komponisten wie Wagner, Schönberg oder Stravinsky hätten gegen die Erwartungen ihrer Hörer ankomponiert, zeige gerade die Kompatibilität der statistischen Methode mit traditionelleren musikwissenschaftlichen Verfahren – einer Methode, die zugleich den Vorteil besäße, stilistische Merkmale eines Korpus exakt zu quantifizieren.[33]
Viele Rezensenten heben die antihermetische Präsentationsform des Buches hervor. Vertrautheit mit Verfahren der Cognitive Science, so zeige das Kapitel zu Forschungsmethoden, werde nicht vorausgesetzt.[34] Zudem verstehe es Huron, die Forschung lebendig zu referieren, verwickelte Debatten angemessen zu vereinfachen und den Gang der Darstellung durch Anekdoten und humorvolle Beispiele aufzulockern. Elizabeth Hellmuth Margulis berichtet, Studierende zählten das Buch bald zu ihren Lieblingslektüren und betont, Huron habe, indem er die Beziehung musiktheoretischer Gegenstände zu umfassenderen gesellschaftlichen Diskursen aufgezeigt habe, dem Fach Musiktheorie einen großen Dienst erwiesen.[35]
Hurons Entscheidung, über Fachgrenzen hinaus verständlich zu schreiben, hat freilich auch Kritiker auf den Plan gerufen. Marcus T. Pearce und Daniel Müllensiefen vermissen eine klare Definition des Huronschen Lesers: Einerseits sei das Buch zu spezialisiert für eine allgemeine Leserschaft, andererseits nicht exakt genug für ein Fachpublikum. Zu kritisieren seien insbesondere die mangelhafte Dokumentation der verwendeten Methoden, die weitgehende Beschränkung der dokumentierten Statistik auf die Berechnung von Mittelwerten sowie die Vagheit der Verweise auf Bayesianische Modelle und Neurowissenschaften. Selten, so Pearce und Müllensiefen, werde versucht, konkurrierende Modelle zu falsifizieren; stattdessen setze Huron überwiegend auf positive Evidenzen. Viele Vorschläge Hurons verlangten nach empirischer Überprüfung; etliche quantitative Analysen müssten unter variierten Bedingungen repliziert werden.[36] Sweet Anticipation repräsentiere mithin weder das letzte Wort zur Psychologie der Erwartung noch gebe es einen vollständigen Überblick über die aktuelle Forschung.
Mark A. Schmuckler lobt die explanatorische Kraft der Hypothese, emotionale Reaktionen auf Musik beruhten auf der evolutionsbiologisch relevanten Fähigkeit, künftige Ereignisse korrekt vorherzusagen, vermisst aber eine Diskussion der Rolle von Musik in der menschlichen Evolutionsgeschichte. Angesichts der spekulativen Natur evolutionsbiologischer Argumente erhebe sich überdies die Frage, ob eine detaillierte Theorie der Erwartung das evolutionsbiologische Argument zwingend verlangt – schließlich hätten Hurons Ideen über musikalische Erwartung weitgehend auch dann Bestand, wenn sich die vorgeschlagenen evolutionären Mechanismen nicht bestätigen ließen.[37] Kritisch erörtert wird auch die musikalische Relevanz des ITPRA-Modells. William Benjamin stellt fest, nahezu alle Beispiele Hurons beträfen das unbewusste Wissen untrainierter Hörer und ereigneten sich in so kurzer Zeit, dass sie weder einer Imagination response noch einer Appraisal response zugänglich seien.[38] Adam Ockelford sieht eine Vielzahl unbeantworteter Fragen: Wie arbeitet das Modell bei einem Stimulus, der aus vielen rasch aufeinanderfolgenden Klängen besteht? Gesetzt, Imagination response und Appraisal response kämen in diesem Fall nicht zum Zuge: Überlappten sich dann die TPR-Zyklen oder folgten sie ausschließlich diskret aufeinander? Kann eine Reaction response in Bezug auf ein anderes Ereignis gleichzeitig als eine Tension response dienen? Funktioniert der TPR-Zyklus allein von Note zu Note oder kann er sich auch über Gruppen von Noten hinweg erstrecken? Wie arbeitet das ITPRA-Modell im Fall kontrapunktischer Texturen, bei denen es ja durchaus vorkommen kann, dass mehrere Stimmen zu ein und derselben Zeit verschiedene Erwartungen generieren?[39] Elizabeth Hellmuth Margulis wiederum beobachtet, trotz der zitierten Musikbeispiele von Schönberg über Holst bis zu Schickele beinhalteten die meisten musikalischen Erfahrungen weder Lachen noch Ehrfurcht und Schauer.[40] Musikalische Emotionen ließen sich erst dann durch musikalische Erwartungen erklären, wenn subtilere Verbindungen zwischen der mentalen Verarbeitung von Erwartungen und unseren alltäglichen Erfahrungen im Umgang mit Musik hergestellt werden könnten. Catherine Stevens und Tim Byron schließlich kritisieren, trotz seiner interkulturellen Anlage sei Hurons Buch einseitig: Repetitive Musiken wie Ambient Music und Minimal Music lasse es ebenso unerklärt wie viele Arten außereuropäischer Musik, bei denen die Verbindung von Musik und Tanz im Vordergrund stehe.[41]
Anmerkungen
Hanslick 1922, 133. | |
Dewey 1894; MacCurdy 1925. | |
Meyer 1957. | |
Vgl. Huron 2006, viii. Für weitere Argumente vgl. etwa Pearce/Müllensiefen 2008, 159 und Bailes/Dean/Pearce 2013, 1. | |
Die bis heute lediglich als Torso vorliegende Theorie Eugene Narmours (1990; 1991; 1992) kann als der bislang letzte große Versuch gesehen werden, eine Theorie der musikalischen Erwartung auf Grundlage der Gestaltpsychologie zu entwerfen. Vgl. etwa Schwab-Felisch 2002; Hellmuth Margulis 2005; Pearce/Wiggins 2006. | |
Vgl. etwa Kebeck/Scholl 2011. | |
Die Untersuchung großer Korpora hat sich inzwischen zu einem wichtigen Teilgebiet der empirischen Musikforschung entwickelt. Die Zeitschrift Music Perception etwa widmet dem Thema zwei aktuelle Spezialausgaben (31/1 und 31/3 [2013/14]). Vgl. http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2013.31.issue-1 und http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2014.31.issue-3 | |
»In particular, the ITPRA theory endeavors to account for the many emotion-related elements of expectation. The theory attempts to explain how expectations evoke various feeling states, and why these evoked feelings might be biologically useful.« (Huron 2006, 3) | |
http://musiccog.ohio-state.edu/SweetAnticipation/overview.html. | |
Da nicht die Vorhersage selbst die gemeinte Response darstellt, sondern die Reaktion auf sie, ist die Bezeichung Prediction Response irreführend. | |
Zajonc 1968. – Der enge Zusammenhang zwischen Vertrautheit und einer positiv gefärbten Erfahrung von Musik wird auch durch neuere neurowissenschaftliche Studien belegt (Brattico/Pearce 2013, 55). | |
Huron 2006, 17, Fig. 1.1. | |
Die Idee der ästhetischen Lust verweist auf eine ebenso lange wie kontroverse Diskussion. Vgl. etwa Gilmore 2013, 145: »Likewise, pleasure felt before a work is often a good guide to its artistic or aesthetic value (hence its use as a measure of appreciation); however, it can often instantiate a failure of proper response. For some works of art (such as the disgusting and rebarbative performances of the Vienna Actionists) may be designed to cause one a feeling of distress, without any compensatory pleasure. Moreover, in the case of many works, such as conceptual art and art that aims for cognitive or moral enlightenment, it may be a mistake to assume that their artistic value is always or only a hedonic dimension intrinsic to our experience of them. The merits of such works may not be appropriately characterized in an experiential sense«. | |
Die deutschsprachigen Ausdrücke treffen den Sinn ihrer englischsprachigen Pendants nur ungenau: Insbesondere ›awe‹ ist mit ›Ehrfurcht‹ nur unzureichend wiedergegeben – gemeint ist ein dem Gefühl des Erhabenen verwandter Zustand des atemlosen Überwältigtseins angesichts eines Übermächtigen. | |
Gewöhnlich wird unter dem Terminus ›Baldwin Effect‹ nicht die evolutionär erworbene allgemeine Lernfähigkeit eines Organismus verstanden, sondern der Prozess der genetischen Verankerung eines ursprünglich gelernten Merkmals – eine Verankerung, die durch den Selektionsdruck bewirkt wird, den ein gelerntes Merkmal über mehrere Generationen hinweg ausübt (vgl. Dennett 2003). – Zum komplexen Verhältnis zwischen Biologie und Kultur vgl. etwa Menninghaus 2011. | |
Rohrmeier/Rebuschat 2012. | |
http://www.musiccog.ohio-state.edu/Humdrum/. Vgl. auch Clarke 2008, 389 und Thompson 2007, 69. Für eine ausführliche deutschsprachige Darstellung vgl. Kepper 2011. | |
Vgl. etwa http://essen.themefinder.org. | |
Vgl. etwa Huron 2006, 108: »But how does a brain know which representation is the best?« – Für eine Kritik des neurowissenschaftlichen Usus, das Gehirn als handelndes Subjekt erscheinen zu lassen, vgl. Bennett/Hacker 2003, 111–114. | |
Zur Bezeichung des Problems ist der Terminus ›Information Theory Paradox‹ gebräuchlich (Titchener/Broyles 1973). Huron dagegen bedient sich unter Rekurs auf Dowling and Harwood (1986, 220) der Bezeichung ›Wittgensteins Puzzle‹. Es gibt freilich gute Gründe für die Auffassung, dass Dowling und Harwood die entsprechende Passage bei Wittgenstein bis zur Unkenntlichkeit verzerrt referieren. Vgl. Wittgenstein 2005, 46f. | |
Meyer 1967. | |
Jackendoff 1991, 223–228. | |
Ähnlich hatten bereits Dowling und Harwood argumentiert (1986, 220). | |
Hurons Zurückhaltung gegenüber theoriegeschichtlichen Aspekten des Themas erstreckt sich auch auf seine Behandlung des musiktheoretischen Erwartungsbegriffs: Verweise auf Moritz Hauptmanns Konstruktion des Metrums aus der Relation erklungener und antizipierter Schläge (Hauptmann 1853, 211–213), Hanslicks Analyse der Geistestätigkeit der Hörers (Hanslick 1922, 133), Dahlhaus’ im deutschen Sprachraum weithin rezipierten Text »Musikalische Form als Transformation« (1977) oder David Lewins phänomenologische Auseinandersetzung mit temporalen Aspekten der Hörens (1986) sucht man vergebens. | |
Vgl. Kurth 1917, 40f. | |
In tonalen Kontexten, so Huron, tritt die Auflösung eines chromatischen Tons zu seinem diatonischen Nachbarton mit einer Wahrscheinlichkeit ein, die annähernd statistischer Gewissheit entspricht (328). | |
Pearce/Müllensiefen 2008, 166. | |
Stevens/Byron 2007, 513. | |
Clarke 2008, 391. | |
Thompson 2007, 68. | |
Schmuckler 2006, 141. | |
Hellmuth Margulis 2012, 147. | |
Pearce/Müllensiefen 2008, 162. | |
Stevens/Byron 2007, 513. | |
Hellmuth Margulis 2012, 145 und 148. – Bemerkenswerterweise liest Hellmuth Margulis Sweet Anticipation als primär musiktheoretisches Buch. | |
Pearce/Müllensiefen 2008. | |
Schmuckler 2006, 139f. | |
Benjamin 2007, 334. | |
Ockelford 2008, 370. Dies ist nur eine kleine Auswahl der bedenkenswerten Fragen, die Ockelford aufwirft. | |
Hellmuth Margulis 2012, 147. | |
Stevens/Byron 2007, 513. |
Literatur
Aversa, Eleanor (2009), »Review of David Huron, Sweet Anticipation: Implications for Composers«, Music Theory Online 15/3-4. http://www.mtosmt.org/issues/mto.09.15.3/mto.09.15.3.aversa.html
Bailes, Freya / Roger T. Dean / Marcus T. Pearce ((2013), »Music Cognition as Mental Time Travel«, Scientific Reports 3: 2690, DOI: 10.1038/srep02690.
Benjamin, William (2007), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation by Huron, David«, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 65, 333–335.
Bennett, Maxwell R. / Peter M.S. Hacker (2003), Philosophical Foundations of Neuroscience, Malden, MA: Blackwell Publishing.
Biancorosso, Giorgio (2008), »Whose Phenomenology of Music? David Huron’s Theory of Expectation«, Music & Letters 89, 396–404.
Brattico, Elvira / Marcus Pearce (2013), »The Neuroaesthetics of Music«, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 7, 48–61.
Clarke, Eric (2008), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation – By David Huron«, Music Analysis 27, 389–392.
Dahlhaus, Carl (1977), »Musikalische Form als Transformation. Bemerkungen zur Beethoven-Interpretation«, in: Beethoven-Jahrbuch 9, 1973/77, 27–36.
Dewey, John (1894), »The Theory of Emotion«, Psychological Review 1; 553–569.
Daniel Dennett (2003), »The Baldwin Effect: a Crane, not a Skyhook«, in: Evolution and Learning: The Baldwin Effect Reconsidered, hg. von Bruce H. Weber und David J. Depew, Cambridge, MA: MIT Press, 69–106. http://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/papers/baldwincranefin.htm
Dowling, W. Jay / Dane L. Harwood (1986), Music Cognition, San Diego: Academic Press.
Gilmore, Jonathan (2013), »Normative and Scientific Approaches to the Understanding and Evaluation of Art« (Kommentar zu Nicolas J. Bullot / Rolf Reber: »The Artful Mind Meets Art History: Toward a Psycho-Historical Framework for the Science of Art Appreciation«), Behavioural and Brain Sciences 36, 144–145.
Hanslick, Eduard (1922), Vom musikalisch Schönen, 13.–15 Aufl., Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Hellmuth Margulis, Elisabeth (2005), »A Model of Melodic Expectation«, Music Peception 22, 663–714.
Hellmuth Margulis, Elisabeth (2012), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Music Theory Spectrum 34, 145–148.
Hauptmann, Moritz (1853), Die Natur der Metrik und der Harmonik, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Jackendoff, Ray (1991), »Musical Parsing and Musical Affect«, Music Perception 9, 199–229.
Janata, Petr (2006), »David Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Nature 442/7107, 29–30.
Kebeck, Günther / Henning Scholl (2011), Experimentelle Ästhetik, Wien: facultas.
Kepper, Johannes (2011), Musikedition im Zeichen neuer Medien: historische Entwicklung und gegenwärtige Perspektiven musikalischer Gesamtausgaben, Norderstedt: Books on Demand.
Kurth, Ernst (1917), Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bach‘s melodischer Polyphonie, Bern: Max Drechsel. Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1996.
Lewin, David (1986), »Music Theory, Phenomenlogy, and Modes of Perception«, Music Perception 3, 327–339.
MacCurdy, John T. (1925), The Psychology of Emotion, New York: Hartcourt, Brace and Co.
Menninghaus, Winfried (2011), ›Wozu Kunst?› Ästhetik nach Darwin, Berlin: Suhrkamp.
Meyer, Leonard B. (1956), Emotion and Meaning in Music, Chicago: University of Chicago Press.
––– (1956–57), »Meaning in Music and Information Theory«, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 15, 412–424.
––– (1967), »On Reheraring Music«, in: ders., Music, the Arts and Ideas, Chicago: Chicago University Press, 42–53.
Narmour, Eugene (1990), The Analysis and Cognition of Basic Melodic Structures. The Implication-Realization Model, Chicago: University of Chicago Press.
––– (1991), »The Top-Down and Bottom-Up Systems of Musical Implication: Building on Meyer's Theory of Emotional Syntax«, Music Perception 9, 1–26.
––– (1992), The Analysis and Cognition of Melodic Complexity. The Implication-Realization Model, Chicago: University of Chicago Press.
Ockelford, Adam (2008), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Psychology of Music 36/3, 367–382.
Pearce, Marcus T. / Muellensiefen, Daniel / Geraint A. Wiggins (2008), »A Comparison of Statistical and Rule-Based Models of Melodic Segmentation«, in: ISMIR 2008. Proceedings of the Ninth International Conference on Music Information Retrieval, Philadelphia, 89–94.
Pearce, Marcus T. / Muellensiefen, Daniel (2008), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Musicae Scientiae 12/1, 158–168.
Pearce, Marcus T. / Geraint A. Wiggins (2006), »Expectation in Melody: The Influence of Context and Learning«, Music Perception 23, 377–405.
Pfleiderer, Martin (2011), »David Huron: Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation«, in: Musikselektion zur Identitätsstiftung und Emotionsmodulation (= Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 21), hg. von Wolfgang Auhagen, Claudia Bullerjahn und Holger Höge, Göttingen u.a.: Hogrefe, 204–207.
Rohrmeier, Martin / Patrick Rebuschat (2012), »Implicit Learning and Acquisition of Music«, Topics in Cognitive Science 4, 525–553.
Schmuckler, Mark A. (2008), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Philosophical Psychology 21/1, 137–142.
Schwab-Felisch, Oliver (2002), »Implication – Realization. Eugene Narmours Theorie melodischer Strukturen«, in: Individualität in der Musik, hg. von Oliver Schwab-Felisch, Christian Thorau und Michael Polth, Stuttgart: Metzler, 95–127.
Stevens, Catherine / Byron, Tim (2007), »Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Music Perception 24/5, 511–514.
Thompson, William Forde (2007), »David Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation«, Empirical Musicology Review, 2/2, 67–70.
Titchener, John M. / Michael E. Broyles (1973), »Meyer, Meaning, and Music«, Journal of Aesthetics and Art Criticism 32, 17–25.
Wittgenstein, Ludwig (2005), Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und religiösen Glauben, zusammengestellt aus Notizen von Yorick Smythies, Rush Rees und James Taylor, hg. von Cyril Barrett, 3. Aufl., Frankfurt a.M.: Fischer.
Zajonc, Robert B. (1968), »Attitudinal Effects of Mere Exposure«, Journal of Personality and Social Psychology, Monograph Supplements 9, 1–27.
Technische Universität Berlin [Technische Universität Berlin]
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.