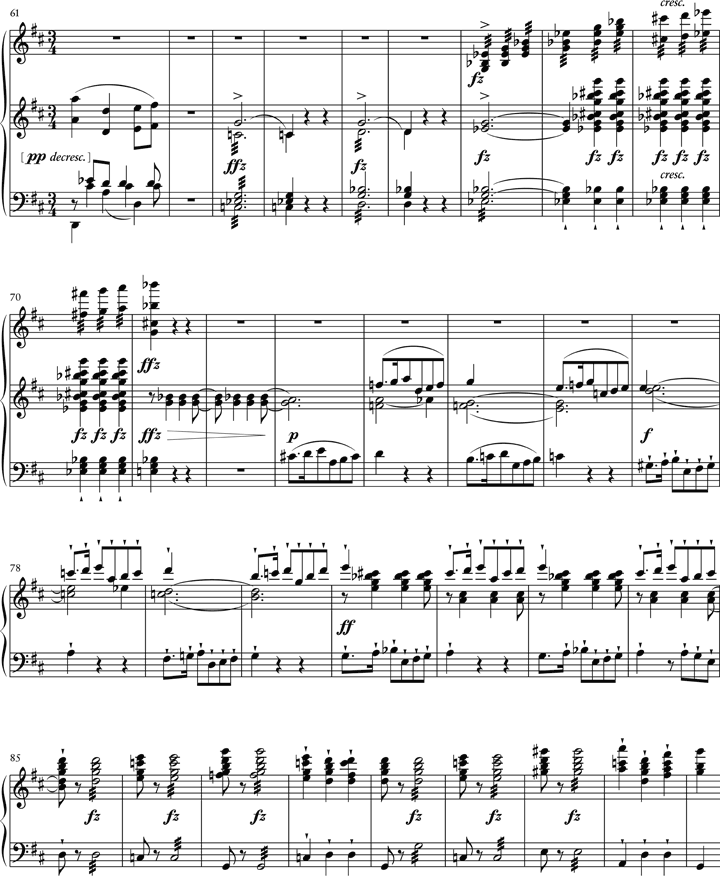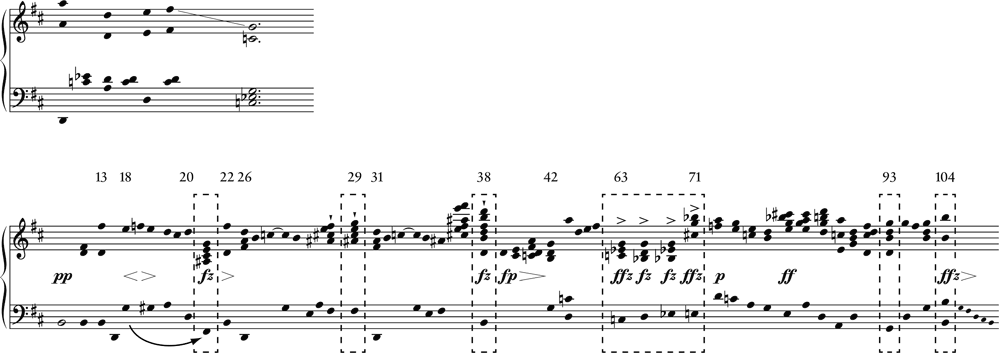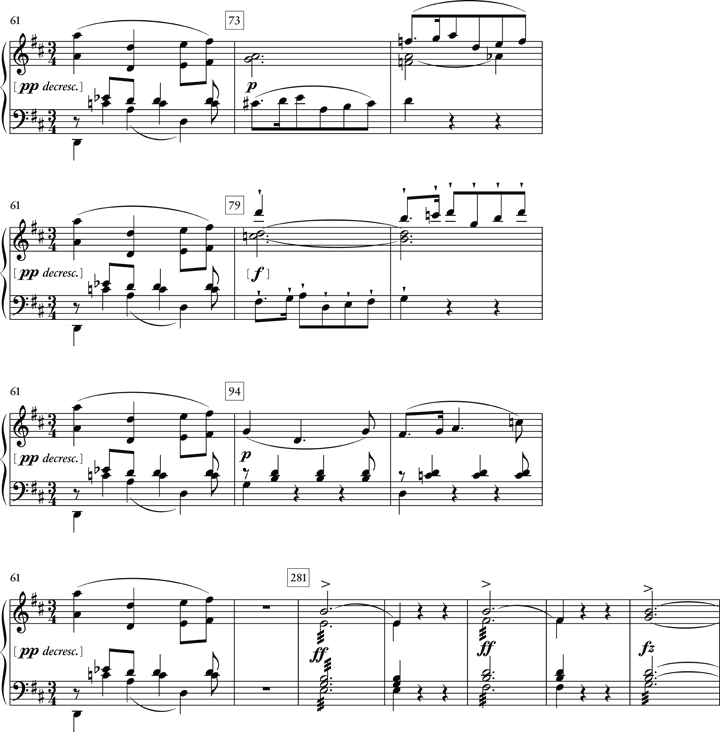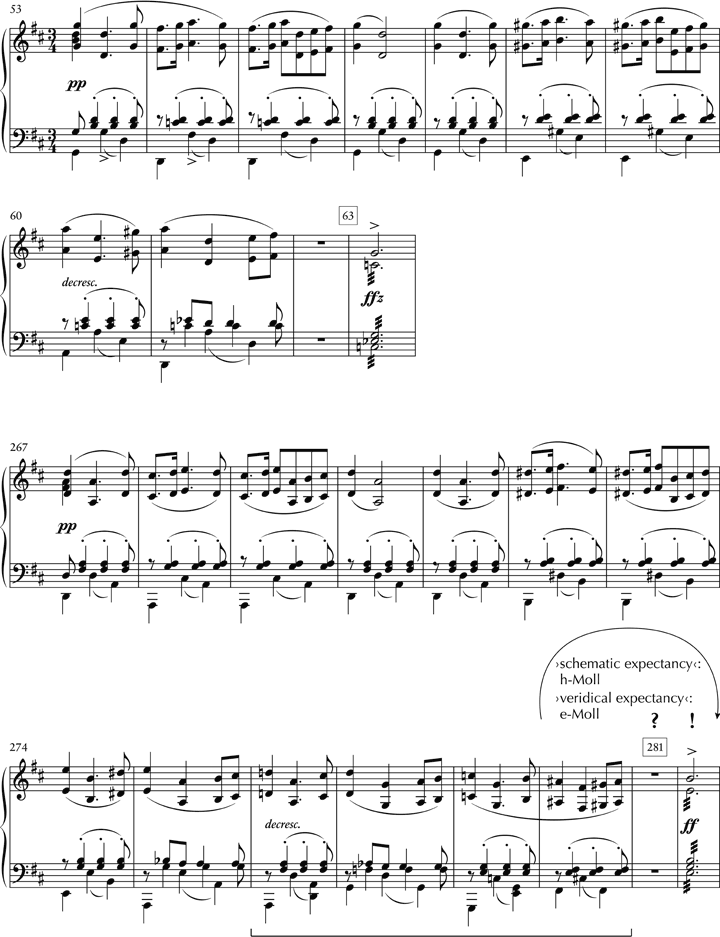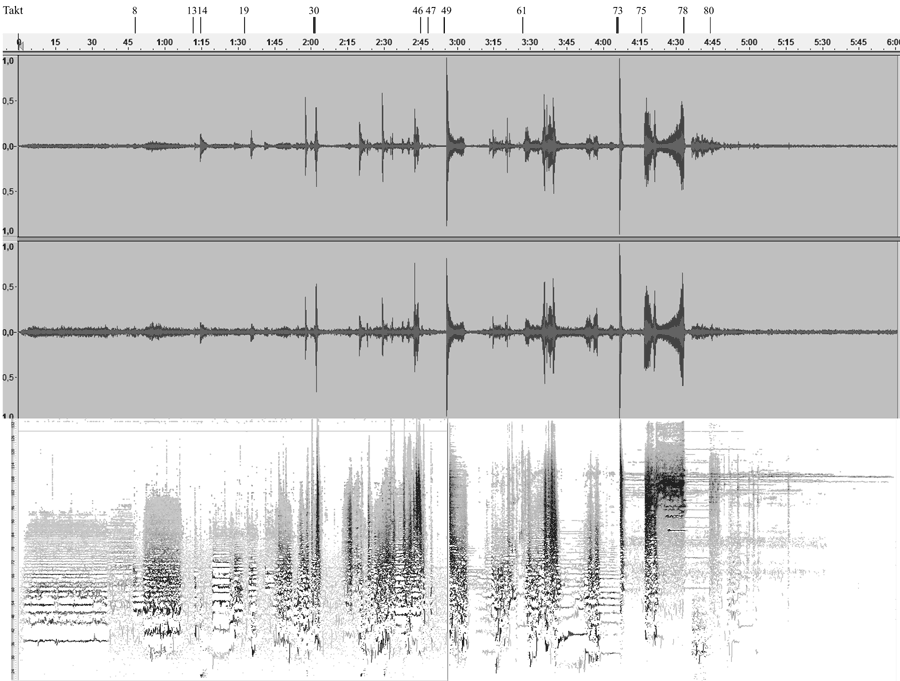Das zweifelnde Gehör
Erwartungssituationen als Module im Rahmen einer performativen Analyse tonaler und posttonaler Musik
Christian Utz
Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit Hörerwartung und -erinnerung in der Geschichte der Musikanalyse und -ästhetik (Weber, Hanslick, Adorno) sowie mit neueren Ansätzen rezeptionsästhetisch konzipierter Theoriesysteme (vor allem Hepokoskis und Darcys Sonata Theory) wird die Rolle von ›Erwartungssituationen‹ im Rahmen einer ›performativen Analysemethode‹ untersucht, die sowohl auf tonale als auch auf posttonale Musik anwendbar ist. Die Differenz zwischen ›implizitem‹ und ›empirischem‹ bzw. ›historischem‹ Hörer macht es notwendig, vom präskriptiven Charakter älterer Analyseansätze abzurücken und eine historisch wie stilistisch kontextsensitive Theorie des Klang-Zeit-Erlebens zu entwickeln. Aus einer Auseinandersetzung mit Theorien der kognitivistisch orientierten Expektanzforschung wird insbesondere das Desiderat einer anti-schematischen Reflexion musikalischer Temporalität sichtbar, da sich Intra- und Extra-Opus-Wissen sowie lokale und globale Erwartungsstrukturen beim Musikhören oft nur schwer trennen lassen und somit kaum kategorial schlüssig reduzierbar erscheinen.
Die in diesem Sinn hier unternommenen ›performativen‹ Analysen von Erwartungssituationen in Franz Schuberts Sinfonie h-Moll D 756 und György Ligetis Werken Apparitions und Aventures heben den modularen Charakter musikalischer Klang-Zeit-Strukturen hervor und orientieren sich am Zusammenwirken von physiologisch-morphologischen und syntaktisch-metaphorischen Erwartungserfahrungen, wie es besonders auch in kompositorischen Poetiken seit den 1970er Jahren (Grisey, Sciarrino) aufscheint. Aufgrund der Mehrdeutigkeit und Kontingenz musikalischer Strukturen zeigen die ›performativen‹ Analysen den Reichtum divergierender Pfade auf, die ein ›zweifelndes Gehör‹ (Gottfried Weber) beim Erfassen der Klang-Zeit-Prozesse nehmen kann; sie wenden sich damit auch explizit gegen jüngere Tendenzen, auf der Grundlage von Affektpsychologie musikalischen Verläufen eindeutige emotiv-narrative ›Plots‹ zuzuschreiben.
Starting from a review of listening expectancy and recollection in the history of music analysis and aesthetics (Weber, Hanslick, Adorno) as well as more recent reception-oriented theoretical systems (in particular Hepokoski’s and Darcy’s Sonata Theory), this essay probes the role of ›expectancy situations‹ within the framework of a ›performative‹ analytical method, applied to both tonal and posttonal music. The difference between an ›implied‹ and ›empirical‹ (or ›historical‹) listener suggests to abandon the prescriptive methods of conventional analysis as well as to develop a historically and stylistically sensitive theory of sound-time experience. An examination of theories developed in cognitively oriented expectancy research reveals the desideratum of a non-schematic reflection of temporality, since intra- and extra-opus knowledge as well as local and global structures of expectancy are difficult to separate from one another in the act of listening and thus seem to be hardly reducible to simple categories in any convincing manner.
Accordingly, the ›performative‹ analyses of Franz Schubert’s Symphony in B minor, D 756, and György Ligeti’s works Apparitions and Aventures concentrate on the modular character of sound-time structures and elaborate on the interaction of physiological-morphological and syntactic-metaphorical experiences of expectancy, a realm also emphasized by important compositional theories since the 1970s (Grisey, Sciarrino). Taking seriously the multivalence and contingency of musical structures, the ›performative‹ analyses reveal the richness of divergent paths which a ›doubtful ear‹ (Gottfried Weber) might take when trying to make sense of sound-time processes; the analyses thus also explicitly oppose more recent tendencies to attribute emotive-narrative ›plots‹ to musical processes on the basis of affect psychology.
Mit musikalischen Klangstrukturen verbundene Erwartungen und Erinnerungen scheinen zum Kern einer kulturell durch die europäische Musikkultur der Neuzeit geprägten Musikwahrnehmung zu gehören. Vor allem seit dem 19. Jahrhundert, als in den Disziplinen der Musikanalyse und Musikästhetik eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Bereich individualisierter Hörerfahrung ins Zentrum rückte, erkannte man im ›Spiel mit der Erwartung‹ ein wesentliches Agens des hörenden Erfassens von Musik. Gottfried Webers berühmte Analyse der Einleitung von Mozarts ›Dissonanzen‹-Quartett[1] inszeniert in unnachahmlicher Weise die sich von Ton zu Ton, Akkord zu Akkord wandelnden Erwartungs-Befindlichkeiten eines ›zweifelnden Gehörs‹, das in der Analyse als Protagonist auftritt. Zwar wird in Webers Argumentation deutlich, dass dem Gehör nur eine »allmählige Lösung harmonischer Mehrdeutigkeiten« »angenehme Befriedigung«[2] bereitet, aber es scheint daneben auch immer die Lust an »dem Gehöre so wenig einleuchtende[n] Ab- und Ausweichungen«[3] der komplexen Anlage durch. Angesichts eines »unentschieden auftretenden Harmoniewechsels« zweifelt das Gehör gar »ob es denn auch wirklich und ernstlich glauben solle was es hört?«[4] – d.h. ob die Ausführenden nicht etwa falsch intoniert, gegriffen oder gelesen hätten –, und Weber erprobt dies, indem alternative Fortsetzungen des musikalischen Satzes systematisch auf ihre Plausibilität hin untersucht werden.[5] Nur das »musikalisch gebildete Gehör«[6], wie es durch Webers minutiöse Analyse repräsentiert ist, kann der Summe solcher »herber Zusammenklänge und Nebeneinanderklänge«[7] am Ende dann doch so etwas wie musikalischen Sinn abgewinnen.
Webers Modell des ›zweifelnden Gehörs‹ scheint in mancher Hinsicht ein ›dialogisches‹ Hörmodell vorweggenommen zu haben, wie es in zahlreichen rezeptionsästhetisch akzentuierten Analyse- und Theorieansätzen, besonders explizit zuletzt in der Sonata Theory von James Hepokoski und Warren Darcy vorausgesetzt wird.[8] Gegenüber konventionellen Unterscheidungen zwischen Norm und Abweichung differenziert die Sonata Theory mittels der Metaphern des »action space«[9] und des ›Spiels‹[10] zwischen einer breiten Palette an Optionen auf der Grundlage mehrfach abgestufter Normen (»defaults«), die Komponisten des klassischen Stils in allen Stadien der Formgestaltung zur Verfügung gestanden hätten. Das dialogische Prinzip ist in dieser Theorie zweifach kodiert bzw. realisiert: als Dialog eines einzelnen Werkes mit stil- und vor allem genrespezifischen Normen (»sets of rules, assumptions, or expectations«[11]) und als die Aktualisierung dieses Dialogs durch einen ›informierten Hörer‹.[12] Die Autoren übernehmen damit wesentliche Konzepte der literaturtheoretischen Rezeptionsästhetik der 1970er Jahre, insbesondere die Vorstellung eines gattungsspezifischen »Erwartungshorizontes«[13], die durch einen in den Text eingeschriebenen ›impliziten Leser‹ bzw. Hörer aktualisiert und konkretisiert wird.[14]
Auch wenn Wolfgang Iser, der den Begriff des ›impliziten Lesers‹ eingeführt hat, vielfach die Differenz zwischen dem ›impliziten‹ und dem ›zeitgenössischen‹ Leser betonte[15], so war doch von Beginn an klar, dass eine Interaktion beider Lesermodelle dringlich ist, soll sich der ›implizite Leser‹ nicht in einer spekulativen Gesamtheit analytischer Text-Deutungen erschöpfen. In diesem Sinn ist mehrfach die für Hepokoskis und Darcys Konzept der ›dialogic form‹ grundlegende These angezweifelt worden, die Komponisten des klassischen Stils hätten in der Tat auch mit historischen Hörern rechnen können, die sich auf einen solchen ›Dialog‹ in all seinen Facetten einließen. Der Vorwurf einer anachronistischen und ahistorischen Anwendung analytischer Methoden[16] wird dabei mit der in der Sonata Theory unhinterfragt fortgeschriebenen Genie- und Heroenästhetik in Zusammenhang gebracht.[17] Besonders relevant für das Thema der Hörerwartung erscheinen Felix Diergartens Ausführungen in Anschluss an Matthew Riley und Matthias Schmidt, die die angenommene Relevanz der Hörerwartung sowohl für Komposition wie für Rezeption klassischer Formen generell und nachhaltig in Zweifel ziehen:
man [darf] zumindest vermuten, dass die Komponisten auch von einer Hörerschicht ausgingen, deren Hörverhalten »von keiner strukturbezogenen Gedächtnisleistung oder Erwartungshaltung« geprägt war, die »bestenfalls rasch und spontan auf die klanglichen Ereignisse reagierte« und angesichts derer für den Komponisten »das unmittelbare Erfassenkönnen der Musik […] Grundbedingung des Erfolgs« war. Gerade wo es um die Auseinandersetzung mit Hörerfahrungen und Hörerwartungen historischer Hörerschichten geht, ist also in Erwägung zu ziehen, dass überraschende ›Abweichungen‹ und Wendungen eher lokal, durch überraschende musikrhetorische Kunstgriffe entstanden, also durch ›Abweichungen‹ auf intratextueller Ebene, weniger durch Abweichungen auf intertextueller Ebene im Sinne eines Vergleichs architektonischer Großformen. Bezeichnenderweise gehen Großform und lokaler Kontext in dieser Hinsicht häufig zusammen, wenn nämlich großräumige ›Abweichungen‹ durch lokale Effekte markiert werden.[18]
Die Zirkelschlüssigkeit, über eine Analyse des Notentextes historisches Hörverhalten rekonstruieren zu wollen, wie es etwa Heinrich Besselers Pionierstudie zur Geschichte des musikalischen Hörens versuchte, wurde bereits in den 1970er Jahren zurückgewiesen.[19] Eine grundlegende Vorsicht ist also gewiss angebracht, wenn man von einer präskriptiv verfassten und an bürgerlichen Hör-Idealen orientierten Theorie oder Ästhetik der Musik unmittelbar auf empirische historische Hörer schließen wollte. Gerade deshalb bieten die historischen Quellen zur Hörerfahrung ein für die Auseinandersetzung mit dem Problem der Hörerwartung unverzichtbares Material. Wenn etwa kein geringerer als Eduard Hanslick so weit ging, in der Dynamik von »bestätigten und angenehm getäuschten […] Vermutungen« ein entscheidendes und besonders musikspezifisches Wahrnehmungskriterium zu sehen[20], kann man davon ausgehen, dass damit – nicht zuletzt angesichts der beträchtlichen öffentlichen Wirkung von Hanslicks Schrift – ein Hörideal vorgegeben war, dem sich das bildungsbürgerliche Konzertpublikum nur allzu bereitwillig anzunähern suchte. Von besonderem Interesse ist hierbei Hanslicks Annahme eines weitgehend unbewussten kognitiven Verarbeitens dieses »intellektuellen Hinüber- und Herüberströmens« zwischen Komponist und Hörer[21] wie es später auch Hugo Riemanns Theorie der ›Tonvorstellungen‹ voraussetzte.[22] Im Sinne des von Hanslick bereits propagierten und von Riemann prominent weiterentwickelten aktiven Charakters des Musikhörens ist es dabei aber keinesfalls ausreichend, sich diesen unbewussten Prozessen lediglich passiv zu überlassen; musikalisches Hören erfordert für Hanslick vielmehr ein »in schärfster Wachsamkeit unermüdliches Begleiten«.[23] Der präskriptive, autoritäre Charakter dieses Hörmodells ist unübersehbar. Gleichwohl ist diese Form hörender Aktivität, verstanden im Sinne performativer Akte oder Handlungen der Wahrnehmung, von ungebrochener Aktualität in einer Gegenwart, in der beiläufiges Hören oder ein passives Hingeben an Klangfluten allgegenwärtig zu sein scheint. Die Auseinandersetzung mit Hörerwartungen sollte also gewiss nicht auf das Modell eines weitgehend passiven ›Achterbahn‹-Hörens[24] reduziert werden, das fortgesetzt von eingelösten oder vorenthaltenen Erwartungen hin- und hergerissen wird, wie es bereits bei Hanslick als karikaturistisches Gegenbild eines idealen Hörens auftaucht.[25]
Wie sehr das Modell eines aktiv mit Hörerwartungen engagierten Hörens insbesondere auch in das Selbstverständnis der musikalischen Moderne deutsch-österreichischer Prägung einfloss, zeigt Theodor W. Adornos Kritik an den von Claude Debussy und vor allem von Igor Strawinski entwickelten alternativen Formen musikalischer Temporalität:
Der Erfahrung des an deutscher und österreichischer Musik Gebildeten ist von Debussy her enttäuschte Erwartung vertraut. Das arglose Ohr spannt das ganze Stück hindurch, ob ›es komme‹; alles erscheint wie Vorspiel, Präludieren zu musikalischen Erfüllungen, zum ›Abgesang‹, der dann ausbleibt. Das Gehör muß sich umschulen, um Debussy richtig wahrzunehmen, nicht als einen Prozeß mit Stauung und Auslösung, sondern als ein Nebeneinander von Farben und Flächen, wie auf einem Bild.[26]
Solche Art der musikalischen Zeitgestaltung war für Adorno »Zeugnis einer Pseudomorphose der Musik an die Malerei«[27] bzw. »der musikalischen Zeit an den Raum, ihrer Sistierung durch Schocks, elektrische Schläge, welche die Kontinuität zersprengen«.[28] Diese oftmals kritisierten Topoi machen deutlich, wie sehr in Adornos Theorie musikalischer Moderne eine konstruktive kompositorische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Hörerwartung als Voraussetzung für (musikalisch schlüssige) Temporalität schlechthin erscheint, selbst wenn dieses Phänomen gerade auch von der Moderne Schönberg’scher Prägung nicht weniger destabilisiert wurde. Nicht nur die vielfach geäußerte Kritik[29] an Adornos allzu schematischer Polarisierung der musikalischen Zeit-Raum-Formen, sondern auch die ästhetisch bei Adorno negativ konnotierte Kategorie des (kalkulierten) ›Schocks‹ machen bewusst, wie sehr Erwartungssituationen nicht nur historisch, stilistisch und gattungsspezifisch vermittelt, sondern wie sehr sie auch als unablösbarer Teil kultureller Vereinbarungen und ästhetischer Diskurse verstanden werden müssen (die Abwertung der Wirkungsästhetik allgemein und der Schockwirkung im Besonderen war ein Erbe prominenter Strömungen in der deutschen Ästhetik des 19. Jahrhunderts).[30] Deutlich wird damit auch, dass generell kaum normativ von ›Erwartungen‹ in einem präzis eingegrenzten Sinn, sondern nur von historisch, kulturell, kontextuell je anders gewichteten ›Erwartungssituationen‹ gesprochen werden kann.
Kognitivistische Expektanzforschung und performative Analyse von Erwartungssituationen
In der musikanalytischen und -pädagogischen Praxis ist ein in diesem Sinn verstandenes Operieren mit oder Hinweisen auf Erwartungssituationen alltäglich und in vielen Fällen äußerst wirkungsvoll einsetzbar: Es genügt den Fluss eines (etwa am Klavier demonstrierten) Musikbeispiels an nahezu beliebiger Stelle abrupt zu unterbrechen, um bewusst zu machen, wie sehr unsere Wahrnehmung infolge des zuvor Gehörten auf Kommendes ›hin-hört‹ bzw. Zukünftiges antizipiert. Freilich bedingt ein solches ›Voraushören‹ stets auch ein rekapitulierendes ›Zurückhören‹, Hörerwartung und Hörerinnerung sind im »Zeitfeld«[31] phänomenologischer Wahrnehmung also aufs Engste ineinander verwoben. Die implizite Temporalität des Hörens in solcher Weise explizit zu machen ist eine Grundmethode zahlloser ›traditioneller‹ musikalischer Analysen. Allerdings werden dabei wahrnehmungspsychologische Voraussetzungen oft kaum reflektiert bzw. erweist sich häufig, dass das Hörverhalten des angenommenen ›impliziten Hörers‹ letztlich wenig mehr als eine Beschreibung subjektiver Hörhaltungen des Analytikers darstellt. Wie schwierig und problematisch es sein kann, die eigene Hörerfahrung als Basis analytischer Ergebnisse heranzuziehen, zeigt sich etwa darin, dass sehr unterschiedliche Deutungen des ›Tristanakkords‹ sich gleichermaßen darauf stützen können, wie ›man‹ den Akkord höre.[32] Die ›hörtheoretischen‹ Deutungen des Akkords lassen sich im Wesentlichen darauf reduzieren, dass der Akkord f-h-dis1-gis1 entweder als eigenständige Einheit gehört wird und das gis1 daher als Akkordton und das darauffolgende a1 als Durchgang aufgefasst werden[33], oder aber im Gegenteil die ›Vorhaltsspannung‹ auf dem gis, die sich ins a löst, als besonders bedeutsam wahrgenommen wird, sodass a, nicht gis als Akkordton erscheint.[34] Abgesehen von Fragen der theoretisch-systemimmanenten Plausibilität sind beide Hörauffassungen grundsätzlich gleichermaßen nachvollziehbar und bezeichnen in ihrer Mehrdeutigkeit das Feld eines performativ sich entfaltenden Hörens. Das Beispiel zeigt daneben auch besonders gut, wie stark Hörerfahrungen von musiktheoretischen Systemen, also von (fachspezifischen) top-down-Prozessen, beeinflusst sein können. Abgeleitet werden kann daraus die Forderung, eine stärker wahrnehmungstheoretisch fundierte Analysepraxis zu entwickeln, bei der auch etablierte musikanalytische Werkzeuge im Lichte jüngerer musikpsychologischer Forschungen grundlegend neu auf ihre Relevanz für die Wahrnehmung von Klang-Zeit-Prozessen hin befragt werden.
Zunächst soll mit diesem Ziel ein knapper Überblick über die musiktheoretisch orientierten Ansätze der Expektanzforschung geboten werden. Im Bereich der kognitiven Musiktheorie wurde die Unterscheidung von ›intraopus style‹ und ›extraopus style‹ vor allem von Eugene Narmour entwickelt, wobei ›intraopus style‹ in erster Linie mit elementaren kognitiven Vorgängen (›bottom up primitives‹), ›extraopus style‹ mit komplexeren, wissensbasierten kognitiven Vorgängen (›top-down structures‹) assoziiert wird.[35] Die Intraopus-Ebene ist dabei eng mit Prozessen adaptiven Lernens verbunden, wie sie bereits Leonard B. Meyer prominent hervorgehoben hat.[36]
Jamshed Bharucha unterschied dagegen zwischen ›veridical expectancies‹ (auf explizitem Vorwissen bzw. auf bewusst erinnerten Elementen eines spezifischen Musikstück basierende Erwartungen – es handelt sich also um eine Kombination von Intra- und Extraopus-Wissen) und ›schematic expectancies‹ (auf abstraktem Regelwissen basierende Erwartungen).[37] David Huron übernahm diese Unterscheidung weitgehend[38] und ergänzte sie durch die Kategorien ›dynamic expectations‹[39] (spontane Erwartungen, die im Kurzzeitgedächtnis während des Hörvorgangs entstehen und sich adaptiv am musikalischen Verlauf orientieren) und ›conscious expectations‹[40] (verbalisierbare Erwartungen, die durch paratextuelle Elemente oder Expertenwissen, aber auch durch musikimmanente Strukturen, z.B. beim Hören unmittelbar offensichtlich werdender Formprozesse, entstehen können – hierbei überschneiden sich allerdings ›bewusste‹ und ›dynamische‹ Erwartungen). Intraopus-Erwartungen können also, wie Bharuchas und Hurons Differenzierungen zeigen, häufig nicht schlüssig von Extraopus-Erwartungen getrennt werden. Die beiden Ebenen gehen in der Regel vielmehr eine komplexe Interaktion während des Hörvorgangs ein.
Huron geht daneben von der durch Meyer bereits 1956 in anderer Weise vorgelegten These aus, dass das Hinauszögern und Einlösen von Erwartungen wesentliche Grundlagen für emotionale Reaktionen auf Musik darstellen. Trotz unterschiedlicher Herleitung dieser Grundthese (Huron deutet sie evolutionsbiologisch im Sinne einer Anpassung an ungewohnte Lebensumstände[41], während sie Meyer konfliktpsychologisch und gestalttheoretisch entwickelt[42]) scheuten beide Autoren nicht davor zurück, insbesondere mit Blick auf Dodekaphonie und serielle Musik Kritik an kompositorischer Komplexität zu üben, die es vermeintlich verhindere, dass Erwartungen noch einen essenziellen Teil des Musikerlebens bilden könnten (sie wären allenfalls noch im Sinne einer permanent enttäuschten Erwartung präsent).[43] Solche Sichtweisen sind Teil einer langen, oft polemisch forcierten Kontroverse über die Wahrnehmung komplexer musikalischer Strukturen, provoziert in erster Linie durch die serielle Musik nach 1950, die von Ulrich Mosch ausführlich dargestellt und differenziert diskutiert wurde.[44]
Elizabeth Margulis schließlich tritt gewissermaßen noch einen Schritt weiter zurück und versucht eine Art Meta-Kategorisierung von musikalischen Erwartungen nach Ursprung, Typus, Zeitdimension, Objekt und Konsequenz.[45] Der ›Ursprung‹ kann physiologisch-viszeral (etwa ein durch plötzliche hohe Lautheit schockierendes Klangerlebnis, das eine Schreckreaktion/›startle response‹ hervorruft[46]) oder aber kognitiv-spezifisch von einem musikalischen System oder Idiom abhängig sein (etwa eine durch unerwartete harmonische Wendungen erzeugte ›Überraschung‹). Unter ›Typus‹ kann die Spezifität und der Bewusstheitsgrad einer Erwartung diskutiert werden. Das ›Objekt‹ der Erwartung mag ein Akkord, eine Phrase, eine bestimmte Textur, ein Dynamikgrad oder auch Stille bzw. Beruhigung oder aber die Zunahme von Aktivität sein. Von besonderer Bedeutung für die musikalische Analyse sind Margulis’ Kategorien ›Zeitdimension‹ und ›Konsequenz‹. Die in der empirischen und statistischen Forschung untersuchten lokalen Erwartungen (bevorzugt untersucht werden in der Regel Verbindungen von Ton zu Ton oder Klang zu Klang) lassen sich in musikalischen Kontexten nur sehr bedingt aus größeren Zusammenhängen isolieren. Als Desiderat erscheint daher eine Verbindung des Phänomens der Hörerwartung mit einer allgemeinen Klang-Zeit-Theorie des musikalischen Erlebens. Im Sinne einer ›performativen Analyse‹[47] sollten dabei sowohl unterschiedliche ›Zeitdimensionen‹ von Erwartungen in ihrem Zusammenwirken beschrieben als auch ›Konsequenzen‹ dieser Erwartung in ihrem mehrdeutigen Potenzial interpretiert und nicht auf allzu eng gefasste hermeneutische oder narratologische Konzepte begrenzt werden.
Gefordert sind daneben Modelle, die alternative Interpretationen der Temporalität von Formverläufen gestatten, bei denen architektonische Schemata nicht mehr dominieren und der Aspekt des Bedeutungswandels musikalischer Elemente in der Zeit mittels Erwartung und Erinnerung stärker Berücksichtigung findet.[48] Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysemethoden müsste eine solche ›performative Analyse‹ von Erwartungssituationen daneben auch eine größere Offenheit gegenüber musikalischer Mehrdeutigkeit kultivieren und Reflexionen alternativer Fortsetzungsmethoden integrieren, wie dies schon Webers eingangs beschriebene Analyse tat. Sie sollte also auch erkunden, worin das ›Zufällige‹ an einem vorliegenden musikalischen Text liegt und ob es auch andere, vielleicht ebenso ›schlüssige‹ Lösungen für den musikalischen Verlauf gegeben hätte.[49] Von einiger Relevanz ist hierbei zunächst, dass für die Theoriebildung vor 1800 in Bezug auf die Makroform die ›Zufälligkeit‹ der Abfolge durchaus eine gängige Kategorie war.[50] Besonders beim Phänomen der ›rekomponierten Reprisen‹, das Markus Neuwirth für die Musik Haydns detailliert untersucht hat[51], handelt es sich um eine plastische Manifestation dieses Prinzips im Zentrum des klassischen Stils.
Das Aufzeigen von Kohärenzen und Korrespondenzen, als tautologisches Moment eine methodische Schwäche zahlreicher Analysen[52], klammert diese Kontingenz des musikalischen Details und dessen produktive Energie weitgehend aus. In Theodor W. Adornos Ästhetischer Theorie ist die Auseinandersetzung mit der kontingenten Schicht von Kunstwerken dagegen ein immer wiederkehrendes Leitthema.[53] Zahlreichen musikalischen Zusammenhängen (wie auch Strukturen anderer Kunstformen) wohnt ein kontingentes Element inne, das mit der Herausbildung der Künste in der ästhetischen Moderne besonders scharf sichtbar geworden ist und durch Methoden der Collage oder Montage nur das allgemeine Phänomen begreifbar werden lässt, dass aus kompositorischen Setzungen keineswegs automatisch ›Beziehung‹ oder ›Zusammenhang‹ hervorgeht.[54]
Gewiss gilt dies im besonderen Maß für jene Tendenzen der musikalischen Avantgarde nach 1945, die sich eine ›Pulverisierung‹ herkömmlicher Syntaxprinzipien zum Ziel setzte. Aber auch in dur-moll-tonaler Musik gibt es stets Momente, in denen anstelle der vom Komponisten gewählten Fortsetzung auch nahezu ›beliebig anderes‹ hätte gesetzt werden können. Die Wahrnehmung einer diskursiv-teleologischen Zwangsläufigkeit des musikalischen Verlaufs, einer musikalischen Logik – ausgebildet vorrangig an der Musik Beethovens – ist nicht zuletzt eine durch die musiktheoretische und -ästhetische Literatur der vergangenen 200 Jahre wesentlich konstituierte Hör-Konstruktion und als solche grundsätzlich anfechtbar.[55] Von hier aus wird besonders sinnfällig, dass eine Theorie musikalischer Syntax kaum je normativ formuliert werden kann, sondern sich an allgemeinen Prinzipien auditiver Wahrnehmung orientieren muss, etwa der Alltagswahrnehmung oder der ›auditorischen Szenenanalyse‹, wie sie Albert Bregman entwarf, und von elementaren Wahrnehmungsprozessen wie der Bildung von ›cues‹, ›streams‹ oder Konturen ausgehen müsste.[56] Grundsätzlich sind die von konventionellen Formtheorien hervorgehobenen Mittel zur Gestaltung musikalischer Zeitgestalten zweifellos ergänzungsbedürftig, nicht zuletzt wenn die äußerst begrenzten Fähigkeiten der Wahrnehmung im Bereich der makroformalen Gliederungs- und Beziehungsaktivität in den Blick genommen wird.[57]
Im Gegensatz zu einem solchen aus der Alltagswahrnehmung hervorgehenden Hörmodell beruht Hörerwartung, wie sie von Weber und Hanslick bis Huron verstanden wurde, auf einem ausschließlich metaphorischen Hören, das eine kausale Kontiguität zwischen Klangereignissen annimmt. Sie setzt die Fiktion eines im engen Sinn musikalischen Geschehens voraus, das isoliert von Alltagserfahrungen ist, in dem Klangereignisse vom Kontext ihrer Hervorbringung unabhängig empfunden und damit als metaphorisches Beziehungsnetz konzipiert werden können, wie es etwa Roger Scrutons »acousmatic thesis« explizit vorschlägt.[58] Gerade dieser in der europäischen Kunstmusik in besonderem Maße ausgebildete Aspekt wurde freilich im 20. Jahrhundert von Komponisten wie John Cage oder Helmut Lachenmann bewusst problematisiert und kritisiert. Diese Kritik ist nicht zuletzt in der Sinfonik Gustav Mahlers oder Charles Ives’ vorgebildet, in der situatives Alltagshören über vertraute Idiome (Marsch, Volkslied, Kinderlied etc.) gezielt in den sinfonischen Kontext hineingenommen wird. Konzepte wie Andy Hamiltons »hearing-in« versuchen vor diesem Hintergrund zwischen einer nicht-metaphorischen, unvermittelten Klangerfahrung und einer holistisch-kausalen Strukturerfahrung zu vermitteln.[59]
Im Lichte dieser Diskussion erscheint es mir sinnvoll, grundsätzlich von einer Interaktion zweier Basistypen musikalischer Hörerwartung auszugehen:
1. Hörerwartung als nur schwer analytisch oder empirisch fassbarer vegetativ-psychologischer Erfahrungswert eines sich mehr oder weniger voraussetzungslos an das Klanggeschehen hingebenden Hörens, das kontemplativ oder auch ›emphatisch-empathisch‹ den musikalischen Prozessen im Sinne von morphologisch fassbaren Klang-Zeit-Gestalten folgt. Gegenüber den ›Implikationen‹ der Struktur bewahrt ein solches Hören eine gewisse Unabhängigkeit; einerseits kann es dabei selbst hochgradige (z.B. harmonische) Überraschungen in den ›flow‹ einer kontemplativen Wahrnehmung integrieren, andererseits in einem Hinhören auf die Plastizität klanglicher Oberflächen auch innerhalb von strukturalistisch ›erwartbaren‹ Vorgängen Unerwartetes erspüren.
2. Hörerwartung als im Wesentlichen strukturalistisch mit dem Notentext korrelierbares und kognitiv in Grenzen ›vorhersagbares‹ Phänomen ist kulturell kodiert und eng an einen spezifischen Stil (z.B. klassischer Stil), eine Gattung (z.B. das sich an ›Kenner‹ wendende Streichquartett der Klassik) oder ein Tonsystem (z.B. Dur-Moll-Tonalität) gekoppelt. Es bedingt einen gewissen Grad an ›Bildung‹ im jeweiligen Stil- und Tonsystem und lässt sich vermittels Distanzierung und erneuter Involvierung hochgradig verfeinern und differenzieren.
Die zweite Kategorie bedarf der fortgesetzten Korrektur und Weitung durch die erste, da sie zum einen Gefahr läuft, Wahrnehmungsprozesse am Ende doch wieder mit musikalischen Strukturen oder etablierten Theoriemodellen gleichzusetzen, zum anderen die oben dargestellte Interaktion zwischen morphologischer und metaphorischer Wahrnehmung nicht erkennt. Aber auch die erste Kategorie sollte nicht im Sinne ›normativer‹ Kopplungen bestimmter musikalischer Texturen oder ›Szenen‹ an bestimmte Affekte oder physiologische Reaktionen verstanden werden wie dies jüngere Untersuchungen suggerieren.[60] Vielmehr kann von einem ständigen Oszillieren zwischen metaphorischen und klangmorphologischen Bedeutungsebenen, von metaphorischer Syntax und viszeraler Responsivität beim Musikhören ausgegangen werden. Im Folgenden sollen nun Beispiele einer solchen Interaktion anhand von Beispielen aus tonaler und posttonaler Musik im Sinne der hier skizzierten performativen Analysemethode untersucht werden.
›Imprévu‹ und Kontextualisierung in Franz Schuberts Sinfonie h-Moll D 759
Es ist bei allen notwendigen und eingangs vorgenommenen historischen Differenzierungen und Einschränkungen gewiss keinesfalls abwegig, ein Komponieren mit Erwartungs- und Erinnerungssituationen als ein wichtiges formbildendes Agens in Werken aus unterschiedlichen Epochen zu beschreiben und dabei insbesondere auch seine Relevanz auf die neue Musik des 20. Jahrhunderts auszuweiten. Bleiben wir aber zunächst im Bereich der Dur-Moll-Tonalität und bei ›Ausläufern‹ des klassischen Stils. Was kann hier mit einem ›Komponieren von Erwartungssituationen‹ gemeint sein? Eine Dimension dieses Komplexes lässt sich etwa durch spielerische Hörexperimente mit der formalen Schlüsselstelle des ersten Satzes von Franz Schuberts Sinfonie h-Moll D 759 (Die Unvollendete) veranschaulichen (Bsp. 1).
Beispiel 1: Franz Schubert, Sinfonie h-Moll D 759, 1. Satz, T. 61–93, Particell
Der harmonisch unvorbereitete plötzliche ›Einbruch‹ eines c-Moll-Klangs im Orchestertutti (T. 63) – »erhaben in seiner Unvorhersehbarkeit«[61] nach vorangegangener Generalpause (T. 62) und einer zuvor auf der Dominante abbrechenden kammermusikalischen Textur (T. 61) – ist zweifellos ein zentraler Moment dieses Satzes, den Michael Spitzer in seiner umfangreichen, auf moderne Affektpsychologie rekurrierenden Analyse mit einer gesteigerten Schockwirkung aufgrund einer fehlenden ›Präpulsinhibition‹ – zusätzlich potenziert durch die Generalpause – assoziiert.[62] Der c-Moll-Akkord in Takt 63 ist also zunächst fassbar als ein besonders drastisches Beispiel des ›imprévu‹, des kompositorisch bewusst gestalteten Moments des Nicht-Voraushörbaren, einer, wie Hermann Danuser gezeigt hat, zentralen Formkategorie europäischer Musik zwischen Carl Philipp Emmanuel Bach und Hector Berlioz.[63] Tatsächlich lässt nach der vorangegangenen Entwicklung nichts diesen Tutti-Schlag erwarten, der zudem durch die Generalpause und das zuvor abrupt unmittelbar vor dem Kadenzziel abbrechende Seitenthema in seiner Wirkung aufs Äußerste zugespitzt ist. Weder melodische Kontinuität (das c-Moll in T. 63 mit der Oberstimme g1 kann als tiefoktaviertes Ziel des in T. 61 ›hängen gebliebenen‹ Leittons fis2 aufgefasst werden, Bsp. 2, oben) noch vorangehende Tuttischläge in der ersten Themengruppe (T. 20.2, 29, 38) vermögen den Bruch an dieser Stelle zu relativieren: Während erstere aufgrund des abrupten Register- und radikalen Klangfarbenwechsels nahezu irrelevant wird, traten letztere durchweg an ›voraushörbaren‹ – nämlich kadenzierenden – Syntaxpositionen auf (Bsp. 2, unten) und waren zudem durch ›Präpulsinhibitionen‹ vorbereitet, d.h. durch Steigerungselemente, die den folgenden Tuttischlag in schwächerer Form vorwegnahmen (vgl. z.B. T. 18.2).
Beispiel 2: Franz Schubert, Sinfonie h-Moll D 759, 1. Satz; oben: harmonischer Schritt T. 61–63; unten: harmonischer Extrakt der Exposition mit markierten cues/Tuttischlägen T. 1–110
Eine Montage, in der die Takte 73, 79 oder 94 direkt (d.h. ohne Generalpause) auf Takt 61 folgen, oder aber ein Ersetzen des c-Moll-Tuttiklangs durch den analogen e-Moll-Klang aus der Reprise (T. 281) könnten an dieser Stelle einer Diskussion über alternative Fortsetzungsmöglichkeiten dienen, die zum einen bewusst macht, auf welchen kompositorischen Ebenen bzw. Parametern Erwartungssituationen hier auskomponiert sind, und zum anderen den an dieser Stelle besonders signifikanten Kontingenzcharakter des Verlaufs hervorhebt (Bsp. 3).[64]
Beispiel 3: Franz Schubert, Sinfonie h-Moll D 759, 1. Satz; ›rekomponierte‹ alternative Fortsetzungen von T. 61
Das Komponieren mit Erwartungssituationen soll nun aber freilich nicht auf Überraschungseffekte[65] reduziert werden. Dies wird insbesondere dann notwendig, wenn nicht nur lokale Verläufe, sondern auch großformale Zusammenhänge berücksichtigt werden: Nach dem Tutti-Schlag bei Ziffer A (T. 38), der die Entwicklung der ersten Themengruppe in der Grundtonart h-Moll deutlich kadenzierend (und ohne zu modulieren) beendet, folgt ein nach G-Dur ›modulierender‹ Auftakt von vier Takten (wobei die ›Modulation‹ de facto auf einen Akkord in T. 41.3 reduziert ist) und eine das neue G-Dur befestigende Begleitfigur von zwei Takten. Peter Gülke spricht über eine analoge Stelle im zweiten Satz derselben Sinfonie mit einem Vokabular, das unserer analytischen Perspektive sehr nahe ist:
Hier, an strukturell scheinbar dürftigen Überbrückungen, erweist sich die Musik […] als am Abgrund des Verstummens angesiedelt; ob und wie es weitergehe ›wissen‹ die Überleitungen […] nicht, die Eintritte […] werden uns wider alle Erwartung geschenkt.[66]
In der Tat sind spannungsvoll gedehnte Einzeltöne und Unisonopassagen, welche die harmonische Situation gezielt im Unklaren lassen, ein in beiden Sätzen der Sinfonie stetig wiederkehrendes Gestaltungsprinzip[67], das eng mit der ›übergangslosen‹, strophenartigen Gesamtkonzeption der Form zusammenhängt.
Unter einem solchen Blickwinkel auf großformale Konsequenzen lokaler Erwartungssituationen stellt sich der ›Schockeffekt‹ in Takt 63 nun etwas differenzierter dar: Das vorangehende ländlerartige Seitenthema wird zweimal in identischer Harmonisierung mit Phrasen zu je 4+5 Takten exponiert (T. 44–61), die, wie bereits das Hauptthema, in charakteristischer Weise mit der metrischen Ambiguität zwischen 3/4- und 6/8-Takt spielen[68], wobei die zweite Phrase über eine Zwischendominante sequenzartig nach a-Moll ausweicht. Die so nach 18 (2x9) Takten entstandene Erwartungssituation kann man in Anlehnung an Leonard B. Meyer als ›saturiert‹ bezeichnen:[69] Dem ›impliziten‹ Hörer ist hier zweifellos bewusst, dass eine Veränderung bevorsteht – und nicht eine erneute Wiederholung der Ländler-Phrase. Durch die überraschende Generalpause wird die Erwartung einer solchen Veränderung verstärkt, zugleich aber auch die Ungewissheit über das Kommende, also das Gefühl von Kontingenz, gesteigert.
Der auf den c-Moll-Klang folgende neuntaktige dramatische Ausbruch verlängert die Ungewissheit nicht nur durch seine parametrisch in jeder Hinsicht zum Seitenthema kontrastierende Gestalt, sondern auch durch die extrem unstabile harmonische Situation, die der (als solchen bereits kaum ›begreifbaren‹) Mollsubdominante von G-Dur folgt. Zunächst scheint sich im Stile eines Accompagnato-Rezitativs eine ausgeweitete Kadenz in der Mollvariante g-Moll abzuzeichnen mit Quartsextakkord (T. 65) und übermäßigem Quintsextakkord (T. 68–70). Letzterer wird aber dann nicht – wie erwartet – doppeldominantisch in g-Moll gedeutet, sondern chromatisch (es-e) in einen ›vagierenden‹ verminderten Septakkord weitergeführt (T. 71), der zunächst – ganz analog zu den von Gülke beschriebenen »dürftigen Überleitungen« zwischen den Sinfoniethemen – in der Luft hängen bleibt (T. 71–72), bevor er über eine tonal offene Sequenz (T. 73–80), einen erneuten ›Vagierenden‹ (T. 81/83) und die Doppeldominante (T. 82/84) schließlich, wenn auch fast etwas ›gewaltsam‹, in eine G-Dur-Kadenz (T. 85–93) mündet.
So irritierend und exterritorial diese Passage auch sein mag, so klar wird sie doch durch den weiteren Verlauf des Satzes ›reterritorialisiert‹. Bereits bei der Wiederholung der Exposition muss sie vieles von ihrer Schockwirkung verloren haben; der nun – als ›veridical expectancy‹ – erwartbare c-Moll-Einbruch könnte von einem ›analytischen Ohr‹ wohl direkt auf die anderen fünf Tutti-Akzente der Exposition (T. 29, 38, [63], 71, 93, 104, Bsp. 2, unten) bezogen werden, die als ›cues‹ wesentliche Gliederungsfunktion einnehmen, sodass gegebenenfalls sogar eine übergeordnete Bewegung h-Moll (T. 38), c-Moll (T. 63), Unisono h (T. 104) deutlich werden mag (gleichsam als akkordisch ausgeweitete phrygische Sekundbewegung).
Der in der Exposition maximiert erscheinende Kontrast zwischen dem lieblich-idyllischen Charakter des Seitenthemas und dem dramatischen Ausbruch erfährt nach dieser leichten Abschwächung dann eine weitere ›Reterritorialisierung‹ in der Durchführung, wenn die Umkehrung des Fortissimo-Ausbruchs und die ruhig im Piano schwingende Begleitfigur des Seitenthemas dreimal in Folge in harmonisch aufsteigenden Sequenzen ohne Vermittlung aufeinander folgen (T. 146–169). Aufschlussreich ist schließlich auch die ›Einrichtung‹ dieses Abschnitts in der Reprise, wo das Seitenthema in der Durparallele der Haupttonart erscheint (D-Dur, T. 258), während zuvor die erste Themengruppe in die Molldominante der Haupttonart (fis-Moll) moduliert hatte, sodass die viertaktigen ›Modulationstakte‹ (T. 252–256) exakt der Exposition entsprechen. Der zunächst analog zur Exposition verlaufenden Entwicklung des Seitenthemas (2 x 4+5 Takte) wird ein Viertakter angehängt (T. 276–279), der die sequenzierte Rückleitung von e-Moll nach D-Dur zuerst bis C-Dur weiterführt und abschließend eine Wendung zurück in die Dominante der Haupttonart h-Moll (Fis7) macht (Bsp. 4). Die nun folgende Generalpause (T. 280) lässt zwar als ›veridical expectancy‹ bewusst werden, dass ein weiteres Mal der mittlerweile bereits vertraute Tutti-Klang folgen dürfte – aber auf welcher harmonischen Stufe? Erwarten wir die Auflösung der Dominante, d.h. einen h-Moll-Klang oder aber erinnern wir uns an die ›unerwartete‹ Rückung der Exposition von D7 (Dominante von G-Dur) nach c-Moll? ›Veridical‹ und ›schematic expectancy‹ stehen hier in einem produktiven Spannungsverhältnis. Wie sich zeigt, liegen wir mit der zweiten Vermutung richtig, tatsächlich folgt auch hier die Subdominante auf die Dominante (T. 281), allerdings ist der Bruch tonartlich weniger stark als in der Exposition, wo die Mollsubdominante vollkommen unvorbereitet in einen Dur-Kontext hineingeschnitten ist. Der eingeschobene Viertakter vor der Generalpause erweist sich also zunächst als spannungs- und kontingenzsteigernd, rückwirkend aber zugleich als harmonisch glättend, zumal nun auch der dramatische Ausbruch gänzlich analog zur Exposition verläuft, bevor er schließlich ab Takt 304 das h-Moll zu H-Dur werden lässt – einem grundlegenden tonalen ›Telos‹ in Moll-Sonatenformen folgend.[70] Eine Einbeziehung des zweiten Satzes, dessen Seitenthema in ähnlicher Weise ›brutal‹ von einer Tutti-Textur unterbrochen wird (T. 96–111) könnte darüber hinaus das werkintegrale Ineinandergreifen von ›imprévu‹ und Erinnerung deutlich machen, das durch seine zyklische Wiederkehr sich als zentrales psychologisches Prinzip des Begreifens der Gesamtform erweist.
Beispiel 4: Franz Schubert, Sinfonie h-Moll D 759, 1. Satz, T. 53–63 und 267–281; Abbruch des Seitengedankens in Exposition (oben) und Reprise (unten)
Die Beschreibungen lassen deutlich werden, dass Erwartungs- und Erinnerungssituationen in verschiedenen Dimensionen der musikalischen Syntax und Großform eine Rolle spielen können und keineswegs ausschließlich auf lokale Kontrastwirkungen beschränkt sein müssen. Und hierin scheint letztlich auch eine besondere Relevanz des Expektanzkonzepts für die musikalische Analyse zu liegen: Der Bedeutungs- und Funktionswandel, dem der dramatische Tutti-Ausbruch in Schuberts Sinfoniesatz zwischen Exposition, wiederholter Exposition, Durchführung und Reprise unterworfen ist, ist durch eine Art des Hörens kritisch zu überprüfen, das sich so gut wie möglich dem imaginären ›impliziten Hörer‹ nähert, den Schubert in seine Formstruktur eingeschrieben hat. Es geht hierbei weniger darum, jede ›überraschende‹ harmonische Wendung im Sinne eines ›Achterbahn‹-Hörens immer neu als ›Schock‹ zu erleben, sondern aktiv hörend nachzuvollziehen, wie die Spannung zwischen Kontingenz und Kontextualisierung in die Essenz des Komponierten einfließt und dabei die Grenzen des Voraushörbaren und Erinnerten ständig verschoben werden.
Die hierzu oben unternommene vorsichtige und tendenziell technisch gehaltene Beschreibung des Schubert-Satzes hat metaphorische und hermeneutische Dimensionen des Expektanz-Diskussion eher in den Hintergrund gerückt. Tatsächlich scheint es angebracht, vor allem mit der Übertragung psychologischer Affektforschung auf musikalische Strukturen und daraus abgeleiteten narratologischen Deutungsmodellen behutsam umzugehen, die freilich speziell bei Schubert und ganz besonders bei dieser Sinfonie einige Tradition haben. Schon Dahlhaus sprach mit Blick auf die gängige Polarisierung Beethoven versus Schubert von einer »lyrischen Emphase«, die in eine »bedrückende tragische Dialektik hineingezogen« werde.[71] Expliziter wurde dann Susan McClarys Deutung des ersten Satzes als »victim narrative in which a sinister affective realm sets the stage for the vulnerable lyrical subject, which is doomed to be quashed«.[72]
Die Tendenz zu immer romanhafteren inhaltsästhetischen Interpretationen gipfelt in Michael Spitzers breit angelegter emotionspsychologischer Darstellung, die ein physiologisch-narratives Gerüst um den zentralen Affekt der Furcht aufbaut. Spitzers methodisch beeindruckender Text versucht, der Willkürlichkeit etablierter Hermeneutik durch einen Querbezug auf philosophische (Adorno, Paddison) und vor allem kognitions- und emotionspsychologische Forschungen (Wundt, Huron, Russell, Öhman/Wiens) entgegenzuwirken. Spitzers Analyse des 1. Satzes in enger Analogie zu Öhmans »threat-imminence trajectory«[73] mit den drei Stadien ›orientation‹, ›freeze‹, ›fight-or-flight‹ tendiert allerdings zu einer schematischen Zuordnung von musikalischen Strukturen und Texturen zu Emotions- und Affekttypen (hier insbesondere ›Furcht‹ und ›Ärger‹), deren Hang zur Normativität gleich zu Beginn in Bezug auf die beiden letzten Streichquartette Schuberts explizit gemacht wird:
For the present, it suffices to reject the possibility that the relationship between expression and arousal is utterly unpredictable and free, subject to hermeneutic openness. It might be claimed, for instance, that listeners can respond in any way they like to the emotions they identify as expressed in the music, and that this openness is to be treasured as a guarantee of the aesthetic freedom quintessential to artworks. And yet, on closer inspection, both Schubert Quartets reveal a surprising level of normativity in their affective trajectories.[74]
Desavouierend in dieser normativen Neo-Affektenlehre ist der mehrfache Verweis auf Filmmusik und Spitzers simplifizierende Gleichsetzung von Musikhörer und Kinobesucher.[75] Eine scheinobjektive Begründung der Koppelung von Strukturen und Emotionen durch Messungen der galvanischen Hautreaktion des Analytikers[76] schließlich scheint – mit dürftigen Resultaten –, einerseits jeglichen Versuch einer intersubjektiven Diskussion von Hörmodellen ad acta zu legen und andererseits die biologistische Grundthese einer »emotional ›behaviour‹ enshrined within musical structure«[77] untermauern zu wollen. So sehr die Hinwendung zu physio-psychologischen Ebenen einer allgemeinen kulturgeschichtlichen Tendenz entspricht, die in der neuen Musik bereits seit den 1960er Jahren wesentliche Tendenzen prägte (s.u.), so scheint Spitzers Unternehmen am Ende vor allem deshalb fragwürdig, weil es wenig mehr hervorbringt als die auf Schuberts Sinfonie bereits so häufig angewandte Hermeneutik des ›pochenden Herzens‹, wie sie sich etwa auch historisch-biografisch auf das wichtigste Modell des ersten Satzes, Schuberts Vertonung von Marianne von Willemers Gedicht Suleika aus Goethes Westöstlichem Divan beziehen lässt.[78]
Wie könnte nun eine behutsamer vorgehende Theoriebildung von Erwartungs- und Erinnerungssituationen im Kontext dur-moll-tonaler Syntax auf Grundlage der hier entworfenen analytischen Skizze aussehen? Ein vielversprechender Ansatz scheint mir, von ›Modulen‹ auszugehen, die zur kompositorischen Konstruktion von Erwartungssituationen zur Verfügung stehen, wobei der Begriff auf Kombinierbarkeit und transformatorisches Potenzial hinweisen soll. Hepokoski und Darcy bezeichnen in diesem Sinne die Komposition von Sonatenformen als »modular assembly«.[79] Musikgeschichtliche Entwicklungen sind mit diesen Modulen eng verknüpft. So wäre grundsätzlich zwischen Modulen zu unterscheiden, die mit dur-moll-tonaler Harmonik, Motivik und Syntax zusammenhängen und solchen, die auch unabhängig davon zur Anwendung kommen können. In unserer Besprechung von Schuberts Sinfoniesatz etwa finden sich zumindest vier unterschiedliche Module, von denen nur (3) und (4) untrennbar an die Dur-Moll-Tonalität geknüpft sind, während (1) und (2) auch in posttonalen Situationen anwendbar sein können:
(1) Der c-Moll-Klang stellt einen plötzlichen (lokalen) Kontrast, einen Umschlag von Dynamik, Charakter, Satztechnik, Instrumentation und Harmonik dar (T. 63 versus 61).
(2) Zusammen mit der vorangehenden wiederholten Periode schafft die Generalpause (T. 62) wiederum eine Erwartungssituation, in der eine Veränderung erwartet werden kann, aber kein extremer Kontrast erwartet werden muss. In weiterer Folge dient die Generalpause dann aber im Gegenteil als Signatur, die gerade den (nun bekannten) extremen Kontrast erwarten lässt (über das Paradox des ›expecting the unexpected‹ hat u.a. Huron ausführlich reflektiert[80]).
(3) Harmonisch wird der Kontrast dadurch verschärft, dass mit der Folge D7-s eine hinsichtlich der Logik der Dur-Moll-Tonalität – und auch hinsichtlich der werkimmanenten harmonischen Logik – nicht erwartbare Folge auftritt.
(4) Die nur vier Takte umfassende ›auftaktige‹ Modulation von der Haupttonart in den Tonikagegenklang G-Dur (sowie die weiteren analog gestalteten Überleitungsmomente) widersprechen weitgehend gattungs- bzw. zeitstilspezifischen Normen einer transformatorischen, auf die ›Mittelzäsur‹ hin gerichtete Überleitung vom ersten zum zweiten Thema[81] – insbesondere wenn das Modell der Beethovenschen Sinfonie- und Sonatenform zugrunde gelegt wird, das für Schubert zur Zeit der Komposition als widerspruchsvolles Vorbild höchste Aktualität besaß.
Bereits diese Aufzählung zeigt, wie schwierig eine schlüssige Abgrenzung der Module ist. Die Schwierigkeiten haben damit zu tun, dass stärker lokal bestimmte Erwartungssituationen von formprozessualen schwer zu trennen sind und sich zudem werkimmanente, gattungsspezifische und systemimmanente Aspekte der Hörerwartung verschränken. Eine Systematik könnte zunächst von einzelnen Parametern (Melodik, Harmonik, Rhythmik etc.) ausgehen und sie im Spannungsfeld von lokalen und großformalen Wirkungen beschreiben. Techniken der harmonischen Modulation, die eine besondere Fülle von Möglichkeiten Erwartungssituationen zu gestalten bereithalten und zugleich am stärksten systemimmanenten Charakter haben, ließen sich etwa unterteilen in stärker lokale (z.B. Trugschluss, plötzliche Rückung) und stärker formprozessuale Module (z.B. ›schweifende‹ oder ›vagierende‹ Modulation, die es bis zum Schluss nicht erlaubt, die Zieltonart ›vorauszuhören‹, oder ›Scheinmodulation‹: Ein modulatorischer Prozess scheint stattzufinden, am Ende verbleibt die Musik aber in der Ausgangstonart[82]). Historisch entstehen die Module vor allem im Zusammenhang mit jener transparenten Gliederung der musikalischen Syntax in der »interpunctischen Form«[83] um 1800, sind aber keinesfalls auf den klassischen Stil begrenzt und ebenso wenig auf das System der Tonalität, wie der folgende Abschnitt zeigen soll.
Poetologie und Wahrnehmung musikalischer Erwartungssituationen nach 1945
Hermann Danuser vermutete, dass für die Musik des 20. Jahrhunderts aufgrund einer »Preisgabe inner- wie außermusikalischer Erwartungshorizonte« das Erwartungsprinzip »absolut und damit hinfällig wurde«.[84] In der freien Atonalität, in der Zwölftonmusik und erst recht im Serialismus schien die Kontingenz des musikalischen Details – in allen drei Fällen auf unterschiedliche Weise – tatsächlich an Extrempunkten angelangt. Unerwartbares schien auf der Ebene musikalischer Syntax und Form, wenn überhaupt, so nur noch durch die Eigenlogik einer einzelnen Komposition konstruierbar oder aber durch ein allgemeines Kontrastprinzip, das jedoch – bei allzu häufiger Verwendung – sich wiederum zum ›erwartbaren‹ Modell verfestigen konnte. Zum einen konnte es dadurch zu einer konsequenten Verschiebung vom strukturellen auf den viszeralen Erwartungstypus kommen (vgl. oben). Gewiss ist es kein Zufall, dass ein Werk, das paradigmatisch die musikalische Moderne repräsentiert, den Begriff im Titel trägt: Arnold Schönberg Monodram Erwartung (1909) war eine signalhaft gesetzte Ikone der körperlich ›erlittenen‹ Erwartung des Ungewissen. Strukturelle Erwartungsformen waren dagegen kaum aufrecht zu erhalten. Es ist wohl nicht verfehlt zu sagen, dass sich der ›implizite Hörer‹, der etwa imstande ist, schiefe Symmetrien oder Invarianzen von Reihensegmenten im Moment ihres Erklingens nachzuvollziehen, zur Mitte des 20. Jahrhundert vermehrt in die musikalische Struktur ›hineinbegibt‹. Eine Konsequenz daraus war es, ein kontemplatives Hören zu fordern, in dem das Erwartungsprinzip in gewisser Weise sistiert oder ganz aufgegeben wird: »Man hält sich in der Musik auf, man bedarf nicht des Vorausgegangenen oder Folgenden, um das einzelne Anwesende (den einzelnen Ton) wahrzunehmen«[85], schrieb Stockhausen 1952.
Auch wenn im kompositionsästhetischen Diskurs bereits seit den mittleren 1950er Jahren, wenn auch unter stark technizistisch geprägten Voraussetzungen, die Wiederentdeckung der hörenden Wahrnehmung eine Rolle gespielt hatte[86], so wurden doch erst in den 1970er Jahren – vor dem Hintergrund einer immer expliziteren Kritik an seriellen Methoden – systematische wahrnehmungspsychologische Erwägungen zur entscheidenden Grundlage kompositorischer Poetik. Insbesondere Gérard Grisey und Salvatore Sciarrino stellten vor dem Hintergrund dieses ›perceptual turn‹ den Aspekt der Hörerwartung ins Zentrum und verbanden ihn mit einem durch die poststrukturalistische Philosophie informierten Diskontinuitäts-Prinzip.[87] So erklärte Grisey 1978 den »Grad der […] Voraushörbarkeit […] zum wahren Grundstoff des Komponisten« und forderte das »Komponieren der […] wahrnehmbaren Zeit, nicht der chronometrischen Zeit«. Nicht unwesentlich ist, dass Grisey dabei die Unterschiede zwischen verschiedenen Arten des Zeiterlebens mit dem Beispiel des ›Schocks‹ veranschaulichte:
So lässt uns z.B. ein unerwarteter akustischer Schock über eine gewisse Zeitspanne schnell hinweggleiten. Die Klänge, die während der Zeit der Dämpfung wahrgenommen werden – der Zeit, die uns notwendig ist, um ein relatives Gleichgewicht wiederzufinden –, haben keineswegs mehr den gleichen emotionellen, noch den gleichen zeitlichen Wert. Dieser Schock, der den linearen Ablauf der Zeit durcheinander bringt, und der eine heftige Spur im Gedächtnis hinterlässt, verringert unsere Fähigkeit, die Folge des musikalischen Vortrags zu begreifen. Die Zeit hat sich zusammengezogen. Im Gegensatz dazu lässt uns eine Folge von extrem vorhersehbaren klanglichen Ereignissen einen großen Wahrnehmungsspielraum. Das geringste Ereignis gewinnt an Wichtigkeit. Dieses Mal hat die Zeit sich ausgedehnt.[88]
Das Ziel einer Wiedergewinnung musikalischer ›Vektorialität‹, ohne dabei konventionelle Formen prozessualer motivischer Arbeit lediglich zu restituieren, kann vor diesem Hintergrund als ein wichtiges Zentrum von Griseys Musik verstanden werden, wobei in seinen Werken Vorgänge der Entropie, gefasst durch die Metapher des ›Unkrauts‹, der Formprozessualität ein oft abruptes Ende setzen.[89] Salvatore Sciarrino, der in freundschaftlichem Kontakt zu Grisey stand, demonstriert in seiner ›Figuren-Poetik‹ die zentralen Aspekte der prozessualen »genetischen Transformationen« und der Modularität vor allem anhand von Griseys Viola-Solo Prologue (1976), dessen fortgesetzte Variantenbildung in einen narrativen Subtext eingebunden ist: »Die Modularität ›entkleidet‹ sich, vereinfacht sich, um gleichsam ihren Ursprung wiederzuerlangen: die Physiologie«.[90]
Sciarrino entwickelte seine eng mit einem Spannungsbegriff assoziierte Poetik des Unvoraushörbaren u.a. durch Analysen von Mahler, Webern und Nono.[91] Sie kristallisiert sich in den beiden Prinzipien des ›Little Bang‹ (einer impulsartigen Auslösung von Prozessen) und der ›Fensterform‹ (dem Erzeugen raum-zeitlicher Diskontinuität, u.a. durch schnitt- und montageähnliche Techniken).[92] Eine Modellfunktion nimmt dabei Introduzione all’oscuro (1981) für zwölf Instrumente ein. Die Musik erwächst hier aus immateriellen Klängen und viszeralen Lauten – Herzschlägen (Doppelimpulse erzeugt durch tiefe Zungenschläge der Holzbläser) und hechelnden Atemgeräuschen (Ein- und Ausatmen durch die Mundstücke der Blasinstrumente) – physiologische Topoi, die auch in Griseys Poetik eine Schlüsselrolle spielen.[93] Diese ›Module‹ werden nun in einen Prozess eingebunden, der auf einen permanenten Übergang zielt, auf eine
Form […], aus deren Verkettung von Spannung und Ruhe die Ruhe-Momente entfernt wurden, ohne dabei aber die Entwicklung und Folgerichtigkeit des musikalischen Gedankens zu unterbinden: ein Angstgefühl, bei dem die Brücken ins Unendliche geschlagen sind.[94]
Pulsierende Suspensionsfelder inszenieren die Erwartung des Ungewissen und schlagen wiederholt in Momente ›panischer‹ Klanggegenwart um.
Zur ›kybernetischen‹ und ›absurden‹ Form bei György Ligeti
Die Gefahr der Nivellierung, die in der Entwicklung der Musik nach 1950 neben dem Reichtum der so entstandenen musikalisch-konnotativen Vieldeutigkeit auch begründet lag, erkannten, wie erwähnt, viele Komponisten bereits seit der Mitte der 1950er Jahre und es waren nicht zuletzt Reflexionen über Möglichkeiten, Erwartungsräume für die Musik neu zu gewinnen und zu öffnen, die signifikante kompositionsgeschichtliche Entwicklungen auslösten. Ein vorrangiges Beispiel dafür lieferte etwa György Ligeti mit seinen Werken Apparitions (1958–59) und Aventures (1962) und den beiden korrespondierenden Formmodellen, die ich als ›kybernetische Form‹ und ›absurde Form‹ bezeichnen möchte. Für Apparitions war eine Poetik des plötzlichen Umschlags entscheidend, die Ligeti in seinem Schlüsseltext »Wandlungen der musikalischen Form« entwarf. Wie in einem kybernetischen Regelsystem wirken Störung und Ausgleich aufeinander ein und sorgen – trotz einer Grundsituation von extremer Nicht-Voraushörbarkeit – für einen homöostatischen Gesamtzustand. Ligeti suchte dabei eine
Form […], in der dem Komponisten in jedem Moment eine Entscheidung möglich wäre, die den gesamten weiteren Verlauf auf völlig andere Pfade leiten könnte. Der Überraschungsgrad solcher Strukturen wäre groß. Es könnte Unvorhersehbares eintreten, das die Form plötzlich umkippen ließe. Die Integrität der Form bliebe aber nur gewahrt, wenn ›Überraschungen‹ nicht unorganisch, bloß äußerliche Störungseffekte wären. Vielmehr sollten sich solche heterogenen Geschehnisse in gegenseitiger Einwirkung verändern, wobei graduelle Transformationen wie auch plötzliche Mutationen möglich wären.[95]
Die Plastizität, die für die Gestaltung dieser Erwartungssituationen notwendig ist, gewinnt Ligeti im ersten Satz der Apparitions durch eine klare Konturierung von Klanggruppen nach dem Vorbild von Stockhausens Gruppen.[96] Zusammen mit den Registern, den Dichtegraden und den Zeitblöcken sind sie in ein ›postserielles‹ Organisationsnetz eingebunden. Die Klanggruppen folgen jedoch keiner Automatik, sondern werden durch gezielte ›irrationale‹ Eingriffe und die freie Anwendung mathematischer Proportionen (Fibonacci-Reihe, Goldener Schnitt) in einen konsistenten Prozess gebracht.[97] Die anfänglich konsequent sukzessiv gereihte Folge unterschiedlicher Klangsituationen (T. 1–21) überlappt sich zunehmend (T. 22–30) und wird dann dort, wo die Dichte stark ansteigt, von einem plötzlichen sfffz-Pizzikato (T. 30) und darauffolgender Generalpause unterbrochen (T. 31). Ein ähnlicher Prozess wiederholt sich im folgenden Abschnitt, wobei die Dynamik des Tutti-Akzents aus Takt 30 nun innerhalb der Klangfelder, gleichsam unter deren Oberfläche, ›weitergärt‹. Dies führt zu immer expliziteren ›Gesten‹, kulminierend in einem durch einen sffffffff-Schlag der Großen Trommel (»tutta la forza – wie eine Detonation [übertrieben laut!]«) heftig akzentuierten Streichercluster (T. 49). Daraufhin ›frieren‹ die Gesten wieder in einer sehr leisen und tiefen Klangfläche ›ein‹, bevor in Takt 73 eine »metallische Explosion«[98] von gemischten Secco-Klängen in höchster Lage den bislang extremsten Kontrast bewirkt, der sich in der ›wilden‹ Gestik von Takt 75 fortsetzt und vor Takt 78 (mit einer für Ligeti charakteristischen Gestaltungsweise) plötzlich abreißt. Darauf lässt die Aktivität allmählich nach, die Musik klingt schließlich im Echo der drei Geigen in höchster Lage aus. Die Amplituden- und Spektraldarstellung des Satzes (Abb. 1) zeigt plastisch die formdynamische Bedeutung der zäsurierenden Ereignisse (T. 30, 49, 73) für die wiedergewonnene formdynamische ›Vektoralität‹.
Abbildung 1: György Ligeti, Apparitions, 1. Satz; Amplituden- und Spektraldarstellung (Einspielung: Berliner Philharmoniker, Jonathan Nott, Aufnahme 2001, Teldec Classics 8573-88261-2, 2002)
Ligeti gelingt so ein Formprozess, der die Erwartungssituation im Spannungsbereich von Zustand und Prozess ständig neu deutet: »Die Zustände werden dabei von plötzlich eintretenden Ereignissen unterbrochen und verändern sich unter deren Einfluß, und umgekehrt.«[99] Die Extreme scheinen spätestens in den Takten 30/31 durch die unmittelbare Folge von Tutti-Akzent und Generalpause klar definiert und werden doch noch durch die Zäsur in Takt 73 übertroffen. Die sekundäre Logik, die durch diese konsequente und permanente Umdeutung der ›Erscheinungen‹ entsteht, gewährleistet jenen Ausgleich von Kohärenz und Spontaneität, den Ligeti in seinem theoretischen Text nahezu zeitgleich entwarf – Resultat ist eine ›Traumlogik‹, die auch auf den komplizierten Entstehungsprozess des Werkes zurückverweist.[100] Gianmario Borio erkannte in Ligetis Werk »[e]ine Art ›Pseudokausalität‹ […], die weder der zielgerichteten Entwicklungsform der traditionellen Musik noch den seriellen Formvorstellungen entspricht«. In dieser »sich vom Einzelnen her entfaltende[n] dramatische[n] Form« sah Borio das Formideal der informellen Musik verwirklicht.[101]
Suchte Ligeti in Apparitions auf Grundlage eines homöostatischen Prinzips dennoch letztlich nach einem fast ›klassischen‹ Formmodell, so strebte er in den drei Jahre später entstandenen Aventures (1962) für drei Sänger und sieben Instrumentalisten nach einer »völlig unausgewogene[n] Form«[102], einer »Form ohne irgendwelches Gleichgewicht«.[103] Dabei zieht Ligeti den Vergleich mit einem Menschen, »der inmitten der verschiedensten Gefühle zerrissen wird«.[104] Die Unberechenbarkeit dieser ›Gefühlsschübe‹ führt zu einem Formprozess, den Harald Kaufmann als »absurde Musik« detailliert beschrieben hat.[105] Für unser Thema, das Komponieren mit Erwartungssituationen, ist die Frage, ob ›absurde Musik‹ oder ›absurde Form‹ grundsätzlich möglich ist, entscheidend. Denn Absurdität ließe sich nur dann als Eindruck vermitteln, wenn einerseits eine allgemeine Logik von Erwartbarem vorhanden ist, von der in absurder Weise abgewichen werden kann, zugleich aber Elemente dieser Logik erhalten bleiben und dabei neu, gleichsam ›sinnlos‹ miteinander verknüpft werden können:
Die Wirkung des Absurden beruht darauf, dass auf eine gängige und banal gewordene Semantik sowie vor allem auf ihren Verknüpfungszusammenhang offen verzichtet wird, hingegen aber durchaus nicht ein Abbau aller semantischer Reizmöglichkeiten vor sich geht, sondern diese in Fragmenten neu gruppiert werden. Dabei entsteht nun, als Analogie zur Erbschaft der Ausdruckskunst, abermals ein ästhetischer Widerspruch: Denn hat man einmal einen absurden Rebus entschlüsselt, ist man hinter die neuen Wirkungsverknüpfungen gekommen und kann man diese mitvollziehen, dann ist ja der absurde Text nicht mehr absurd, sondern seinerseits eine Sprache mit Deduktionen und Ausstrahlungen, wenn auch sehr viel komplexer als die des Alltags.[106]
Die extremen Kontraste, welche die acht Abschnitte bzw. 21 Episoden des Werkes[107] zueinander erzeugen, würden allein noch keine Absurdität verbürgen. Diese ergibt sich vielmehr aus der Überlagerung von fünf Schichten in der Substruktur der Komposition, die in den Skizzen u.a. mit ›Der Kultus‹, ›opera seria‹, ›Die Natur‹, ›opera buffa‹ und ›Der Alltag‹ assoziiert werden.[108] Sie verlaufen parallel, werden zu unterschiedlichen, teils durch statistische Verteilungsmethoden errechneten, teils wohl bewusst kalkulierten Zeitpunkten hörbar, oft gleichzeitig, mitunter abrupt ineinander umschlagend.[109]
Das permanente Eröffnen und Brechen von Erwartungssituationen gehört zur Essenz der resultierenden ›absurden Form‹, die konsequenterweise auch keine Logik des Schließens oder Öffnens mehr hat, sondern vielmehr als Ausschnitt eines fortlaufenden Kontinuums erscheint:
Was wie eine blitzhafte Erkenntnis den Gang der musikalischen Handlung zu beschließen schien, hat sich wiederum wie eine Schale geöffnet. Möglicherweise ist dies der zentrale Sinn der Abenteuer: Sobald ein Sinn sichtbar wird, kehrt er sich in einen Gegensinn um, was als geschlossene Form fassbar scheint, tendiert wiederum ins Offene. Aventures sind entweder unaufhörlich, oder sie bescheren nur falsch glorifizierte Helden, die sich zur Ruhe setzen. Deshalb ist die Komposition auch fortsetzbar.[110]
Fazit
Die Kontingenz musikalischer Prozesse ist und war für alle Komponisten ein ›Problem‹, die sich nicht mit der Mechanik von Formeln oder der konventionellen Montage stilistischer Versatzstücke begnügen woll(t)en. Das Konstruieren von Erwartungssituationen mit Hilfe eines ›impliziten Hörers‹ und deren Rekonstruktion in der ›performativen Analyse‹ erst ermöglichen es, in der Musik Gehörtes, zu Erwartendes und Erinnertes mit Verwunderung oder Erfüllung, Staunen oder Begreifen zu verbinden. Die Frage, wie viel davon sich einem ›historischen‹ oder ›empirischen Hörer‹ tatsächlich mitteilt, kann vielleicht durch die Interpretation von Quellen zu historischen Hörmodellen, empirische Studien und Wahrnehmungsmodelle eingegrenzt werden, es scheint aber selbst bei scheinbar ›leicht verständlicher‹ (Kunst-)Musik unwahrscheinlich, dass tatsächlich all das, was ein ›impliziter Hörer‹ in sich aufgenommen hat, von einem empirischen Hörer ›vollständig‹ dekodiert werden kann. Gerade die Beobachtung, dass der Reichtum an komponierten ›Implikationen‹ beim Hören nicht vollständig ›realisiert‹ werden kann bzw. umgekehrt das Hören Realisationen findet, die vom Komponisten gar nicht ›impliziert‹ sind, erscheint als eine grundlegende Voraussetzung der Unbegrenztheit des Hörens sowie des musikalischen Denkens und Erfindens. So betrachtet kann man von musikalischen Analysemethoden einfordern, sich stets ein ›zweifelndes Ohr‹ zu bewahren und normative Hörmodelle ›performativ‹ in Frage zu stellen.
Anmerkungen
Weber 1830–32. | |
Ebd., 205. | |
Ebd., 210. | |
Ebd., 211. | |
Ebd., 204–219. | |
Ebd., 224. | |
Ebd. | |
Hepokoski/Darcy 2006. | |
Ebd., 9f. und 616. | |
Vgl. ebd., 606f. | |
Ebd., 606. | |
Vgl. ebd., 605. | |
Jauss 1970. | |
Iser 1972 und 1984. Vgl. Hepokoski/Darcy 2006, 606 und 612. Hepokoski/Darcy beziehen sich hier explizit auf Wolfgang Isers literaturtheoretisches Konzept des ›impliziten Lesers‹. Von besonderer Bedeutung für Hepokoski/Darcy ist dabei Isers Hervorhebung des Perspektivenwechsels, den der Leser durch den Text erfährt (vgl. Iser 1984, 37–67). In den frühen 1990er Jahren erfuhren rezeptionsästhetische Theorien erstmals Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Musikwissenschaft, vgl. dazu Cadenbach 1991 und Mauser 1993. | |
»[Der implizite Leser] besitzt […] keine reale Existenz; denn er verkörpert die Gesamtheit der Vororientierungen, die ein fiktionaler Text seinen möglichen Lesern als Rezeptionsbedingungen anbietet. Folglich ist der implizite Leser […] in der Struktur der Texte selbst fundiert. […] Daher bezeichnet das Konzept des impliziten Lesers eine Textstruktur […].« (Iser 1984, 60f.) »Der implizite Leser meint den im Text vorgezeichneten Aktcharakter des Lesens und nicht eine Typologie möglicher Leser.« (Iser 1972, 8f.) | |
»The notion of ›formal wit,‹ in particular, implies that the norms with which a certain composer is playing have already been firmly established beforehand. However, it can be argued that this is not invariably the case with all the strategies put forth in the Elements: there are some supposedly ›witty‹ ambiguities H. & D. identify in conjunction with Haydn that only come about through application of an anachronistic and (in some respects) ahistorical framework of theory.« (Neuwirth 2011, 202f.) | |
»Wo immer die ›großen‹ Komponisten mit ihren Kompositionen nicht den ›Normen‹ entsprechen […] wird dies als kunstvolle Abweichung ausgelegt, als Meta-Diskurs über die Normen gewissermaßen, nicht jedoch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass diese Normen an sich nicht substanziell sein könnten. Gleichzeitig wird so auch eine Falsifizierbarkeit der postulierten Normen unmöglich gemacht.« (Diergarten 2012, 26) | |
Ebd., 26f. Zitate im Zitat: Schmidt 2006, 253, 255. Vgl. auch Riley 2008. | |
Dömling 1974; vgl. Besseler 1978. | |
Hanslick 1854, 59. | |
Ebd. | |
Riemanns späte Theorie konzentrierte sich auf »die in der Tonphantasie des schaffenden Künstlers vor der Aufzeichnung in Noten lebende und wieder in der Tonphantasie des Hörers neu erstehende Vorstellung der Tonverhältnisse« (1916, 2). | |
Ebd. | |
»›roller-coaster‹ listening« (Butt 2010, 9). | |
»Halbwach in ihren Fauteuil geschmiegt, lassen jene Enthusiasten von den Schwingungen der Töne sich tragen und schaukeln, statt sie scharfen Blickes zu betrachten. Wie das stark und stärker anschwillt, nachläßt, aufjauchzt oder auszittert, das versetzt sie in einen unbestimmten Empfindungszustand, den sie für rein geistig zu halten so unschuldig sind.« (Hanslick 1854, 71). | |
Adorno 1975, 171f. | |
Ebd., 174. | |
Ebd., 177. | |
Richard Kleins Kritik etwa hat dargestellt, dass Adorno spätestens in seiner Berg-Interpretationen »die [in Adornos Beethoven-Fragmenten entwickelten] Begriffe der intensiven und der extensiven Zeit, von Entwicklung und grundloser Präsenz, faktisch so nahe aneinander[rückt], dass seine Rede von der ›Pseudomorphose an den Raum‹ so hinfällig wird, wie sie es immer schon war.« (2011, 73) | |
Vgl. Danuser 1986, 74. | |
Husserl 1928, 391. | |
Vgl. dazu u.a. zusammenfassend Danuser 1998 und Utz 2010. | |
Vgl. etwa Holtmeier 2002, 363f. | |
In der Folge von Kurth 1923, 46. | |
Narmour 1999. Narmour baut vor allem auf dem Stilbegriff in Leonard B. Meyers späten Schriften auf, wo Meyer zwischen »dialect« (bestimmte, oft lokal-spezifische Ausprägungen eines Stils, bedingt durch die Präferenz für bestimmte Regeln und Strategien durch eine Gruppe von Komponisten), »idiom« (die spezifischen Präferenzen und Einschränkungen, die ein Komponist für einen Großteil seiner Werke wählt) und »intraopus style« (die Wiederholung und Varianz von Mustern innerhalb einer spezifischen Komposition) unterscheidet (vgl. 1989, 23–30). | |
Vgl. Meyer 1956 sowie Marsden 1989. | |
Bharucha 1987, 4. | |
Huron 2006, 224–226. | |
Ebd., 227–231. | |
Ebd., 235–237. | |
Ebd., 3, 8, 60–62. | |
Meyer 1956, 6–32 und passim. Vgl. dazu auch Helga de la Motte-Habers Beitrag im vorliegenden Band. | |
Freilich ist Meyers Diskussion dieses Problemfeldes (1967, 266–293) ungleich differenzierter und erhellender als die Hurons (2006, 346–353), die in ihrer eindimensionalen Begrenzung auf eine »contrarian psychological basis underlying modernism« (ebd., 350) die komplexen historischen Vermittlungsstufen zwischen tonaler und posttonaler Musik nicht zu erfassen vermag. | |
Mosch fasst konzis die Argumente mehrerer Autoren (darunter Robert Francès, Nicolas Ruwet, Claude Lévi-Strauss, Leonard B. Meyer, Fred Lerdahl) zusammen, die serielle Musik auf wahrnehmungstheoretischer Grundlage kritisierten (2004, 89–122; 336–346), und zeigt, dass sie weitgehend auf der irreführenden Annahme beruhen, (prä-)kompositorische Strukturen müssten zwangsläufig auch als Modelle der Wahrnehmung gelten. | |
Margulis 2007, 205f.; vgl. auch den Beitrag von Elizabeth H. Margulis in dieser Ausgabe. | |
Huron 2006, 62. | |
Vgl. dazu u.a. Cook 1999, 252 und Cook 2002, 94 sowie die Weiterentwicklung dieses Ansatzes in Utz 2013c. | |
Vgl. dazu vor allem Neuwirth 2008. Als Vorläufer eines solchen Modells könnte etwa Theodor W. Adornos Skizze einer »materialen Formenlehre« angesehen werden, die eine »Deduktion der Formkategorien aus ihrem Sinn« anstrebte. Adornos anhand der Sinfonik Gustav Mahlers entwickelte formanalytische Kategorien sind metaphorisch-psychologisierend zugespitzte Beschreibungen musikalischer Prozesse, die eng mit dem Aspekt der Hörerwartung zusammenhängen, was bereits an der Auswahl der zentralen Termini »Erfüllung«, »Durchbruch«/»Ausbruch« und »Suspension« klar erkennbar ist (1971, 193f.; vgl. dazu auch Zehentreiter 1997). | |
Diesen Aspekt thematisiert insbesondere Temperley mit seiner Methode der »Rekomposition« (2001, 349–354). Vgl. auch die produktive Anwendung dieses Prinzips in William E. Caplin Analyse von Beethovens Klaviersonate op. 31,2 (2009) sowie zuletzt in Stefan Rohringers Analyse von Johannes Brahms’ Intermezzo op. 119/1 (2013). | |
»Es ist nicht zu leugnen, daß eines Theils die Form [der Arie] etwas Zufälliges ist, welches eigentlich wenig oder gar keinen Einfluß auf den inneren Charakter des Tonstücks hat, und andern Theils hat man auch eben keinen Grund wider die Form unserer Sätze […] viel einzuwenden.« (Koch 1787, 117) Vgl. auch Diergarten 2012, 27f. | |
Neuwirth, Druck in Vorbereitung. | |
Vgl. Schwab-Felisch 2004. | |
»Absolute Determination […] konvergiert […] mit absoluter Zufälligkeit. Retrospektiv nagt das an ästhetischer Gesetzmäßigkeit schlechthin. Immer haftet ihr ein Moment von Gesetztheit, Spielregel, Kontingenz an. Hat seit dem Beginn des neueren Zeitalters […] Kunst kontingente Momente von Landschaft und Schicksal als solche des aus der Idee nicht zu konstruierenden, von keinem ordo überwölbten Lebens in sich hineingenommen, um jenen Momenten innerhalb des ästhetischen Kontinuums aus Freiheit Sinn einzuflößen, so hat die zunächst und in der langen Periode des bürgerlichen Aufstiegs verborgene Unmöglichkeit der Objektivität von Sinn kraft des Subjekts schließlich auch den Sinnzusammenhang selbst der Kontingenz überführt, die zu benennen Gestaltung einmal sich vermaß. Die Entwicklung zur Negation des Sinns zahlt diesem das Seine heim.« (Adorno 1970, 234f.) | |
Vgl. Mosch 2004, 80–88. Moschs Modell einer »integrierenden Wahrnehmung« serieller Werke geht davon aus, dass beim Hören auch äußerst Heterogenes – nach dem Modell der Collage – aufeinander bezogen werden kann. Mosch unterschätzt dabei allerdings möglicherweise das grundlegende Weiterwirken kognitiv gestützter formaler Funktionen wie Kontrast, Salienz, ›cues‹, Transformationen etc. auch im Hören serieller Strukturen. | |
Vgl. dazu vor allem Burnham 1995, 147–168. | |
Vgl. dazu ausführlich Utz 2013a. »[W]e cannot deny that we hear music through the same ears that provide us with the sounds of everyday life. I do not mean to assert that there is nothing more to music. Music builds elaborate structures of sound, but its esthetic tools are not merely the raw properties of the individual sounds.« (Bregman 1990, 455) | |
Vgl. dazu u.a. die Studien in Tillmann/Bigand 2004: »Global structures seem to have only weak influences on perception, and local structures seem to be much more important. Independently of level of musical expertise, listeners have difficulties considering relations between events that are far apart in time. And yet, understanding such distant relations would be necessary to integrate events into an overall structural organization.« (218) | |
Scruton 1997, 3–30, Scruton 2009. | |
Hamilton argumentiert in seiner »twofold thesis«, dass »hearing-in« ein musikalisches Hören beschreibt, in dem eine nicht-metaphorische »atomistic experience of […] individual sounds« und eine »holistic experience of musical structure«, die auf einer metaphorischen Kausalität basiert, interagieren (2009, 171; vgl. auch 2007, 95–111). Butt 2010 entwickelt, ohne sich auf Hamilton zu beziehen, einen vergleichbaren Ansatz. | |
Insbesondere gilt dies für Huron 2006 und Spitzer 2010. | |
»›sublime‹ in its ›unforeseeability‹« (Kurth 1999, 30). | |
Spitzer 2010, 172f. Spitzer bezieht sich in diesem auf den Affekt der ›Furcht‹ konzentrierten Aufsatz insbesondere auf die Theorien von Russell 1980 und Öhman/Wiens 2003 (s.u.). Unter ›Präpulsinhibition‹ (›prepulse inhibition‹) versteht man die Abschwächung einer Schreckreaktion (›startle response‹) durch einen vorangehenden Schreckreiz (›pulse‹; ›prepulse‹) von geringerer Intensität. | |
Danuser 1986. | |
Diese kleinen Experimente, die ich in verschiedenen Vorträgen und Seminaren herangezogen habe, sind inspiriert durch empirische musikpsychologische Forschungen, die zum Ergebnis kommen, dass die Umstellung von mikro- oder makroformalen Abschnitten in Musikwerken weitgehend ohne jegliche Folgen für die Beurteilung der Gesamtform bleibt, selbst bei ›Expertenhörern‹ (vgl. vor allem Karno/Konečni 1992). La Motte-Haber/Rötter 2005 ziehen aus solchen Erkenntnissen den Schluss, dass beim Musikhören möglicherweise »eine Art ›inattentional Blindness‹ für formale Strukturen« (267) vorliege. Vgl. auch Anm. 57. | |
Vgl. auch oben Anm. 30. Bekanntlich schätzte Adorno die Technik des ›imprévu‹ gering, sie schien ihm, so wie er sie in der Musik von Berlioz (der den Begriff prägte) und Richard Strauss eingesetzt fand, ein allzu rational kalkulierter Schockeffekt: »Das imprévu suspendiert die gleichförmige Mechanik des bürgerlichen Lebens und ist doch selber mechanisch hervorzubringen: durch Tricks.« (1977, 198) In der dialektischen Analyse schien ihm gerade die kalkulierte Abweichung von der Norm diese nachhaltig zu befestigen. Diese Diagnose stellte Adorno insbesondere im Falle Strawinskis, dessen neoklassizistische Strategie er darin begründet sah, »daß an Stellen, wo die herkömmliche Musiksprache, insbesondere das vorklassische Sequenzenwesen, gewisse Fortsetzungen als selbstverständlich, automatisch zu verlangen scheint, diese vermieden [werden], statt dessen ein Überraschendes, ein imprévu geboten wird, das den Zuhörer amüsiert, indem es ihn um das betrügt, worauf er spannt. Das Schema herrscht, aber die Kontinuität des Verlaufs, die es verspricht, wird nicht eingelöst: so praktiziert der Neoklassizismus Strawinskys alte Gewohnheit, brüchig getrennte Modelle aneinander zu montieren. Es ist traditionelle Musik, gegen den Strich gekämmt. Die Überraschungen aber verpuffen in rosa Wölkchen, nichts als flüchtige Störungen der Ordnung, in der sie verbleiben.« (1975, 188f.) Wenn Danuser auch in seinem wichtigen Aufsatz das ›imprévu‹ als neutralen kompositionsgeschichtlichen Terminus etabliert hat (1986), so erlaubt Adornos Kritik doch noch einen anderen Blick auf das Schubert-Beispiel, denn auch hier verbleibt bei aller Unvoraushörbarkeit der Bruch im Rahmen einer übergeordneten formalen Stringenz (vgl. dazu insbesondere weiter unten die Ausführungen zur ›Reterritorialisierung‹ des Bruchs aus den Takten 62/63 in Expositions-Wiederholung und Reprise). | |
Gülke 1991, 198. | |
1. Satz: T. 6-8, 38–40/252–254, 104–108/322–324, 118–121; 2. Satz: T. 60–63/201–204, 280–285/290–295. | |
Vgl. dazu ausführlich Kurth 1999. | |
Meyer führt das Konzept ›saturation‹ im Zusammenhang mit seinen Basiskonzepten ›completion‹ und ›closure‹ ein: »A figure which is repeated over and over again arouses a strong expectation of change both because continuation is inhibited and because the figure is not allowed to reach completion.« (1956, 135) | |
»[…] the desire to be emancipated from minor into major constitutes the basic narrative paradigm […] of minor-mode sonata form« (Hepokoski/Darcy 2006, 311). | |
Dahlhaus 1980, 126. | |
McClary 1994, 225 | |
Spitzer 2010, 164–186; vgl. Öhman/Wiens 2003. | |
Spitzer 2010, 157. | |
Ebd., 156, 168, 177. | |
Ebd., 177–179. | |
Ebd., 149. | |
Vgl. dazu insbesondere Gülke 1991, 124–129, 198. | |
Vgl. Hepokoski/Darcy 2006, 15. Eine wenig bekannte, aber mit dem vorliegenden Ansatz in mancher Hinsicht vergleichbare modulare Theorie musikalischer Syntax wurde von Salvatore Sciarrino skizziert; vgl. dazu vor allem Sciarrino 1998, 85–94 und Utz 2013b (vgl. auch unten). | |
Vgl. Huron 2006, 294–304. Huron begrenzt diesen Typus hier allerdings vor allem auf das Phänomen der (fortgesetzten) Synkopierung. | |
Hepokoski/Darcy 2006, 93–116; Fuß 2009, 116. | |
Hepokoski/Darcy 2006, 487–490 beschreiben solche »modulatory feints« insbesondere anhand des ersten Ritornells eines Sonatenrondos (›Type 5 Sonata‹). Die Autoren heben hervor, dass sie das Modul der Überleitung grundsätzlich nicht an modulierende Aktivität binden (ebd., 112); vgl. dazu das insbesondere bei Haydn und Mozart zu findende Phänomen der ›nicht-modulierenden‹ Überleitung (ebd., 116; Fuß 2009, 121f., 127–131). | |
Koch 1787, 384–424. | |
Danuser 1986, 77. | |
Stockhausen 1963a, 21. | |
Vgl. dazu vor allem Stockhausens Texte der mittleren 1950er Jahre, die sich unter dem Paradigma der Informationstheorie immer wieder auch intensiv mit Fragen der Hörerwartung befassten (1963b und 1963c). | |
In vieler Hinsicht kann man darin eine Einlösung von Adornos Modell der ›informellen Musik‹ sehen; vgl. dazu Adorno 1978, Borio 1993, Haselböck 2009, 137–150 und Haselböck 2010. | |
Vgl. Grisey 2010, 321. | |
Vgl. dazu u.a. Haselböck 2009, 161–181, 235–250. | |
»In Grisey […] la modularità si spoglia, si semplifica quasi a recuperare la sua origine primaria, la fisiologia.« (Sciarrino 1998, 92) | |
Ebd., 55f. | |
Ebd., 59–76; 97–148. | |
Vgl. Grisey 2010, 322. | |
Salvatore Sciarrino, Introduzione all’oscuro, in: Programmheft Wittener Tage für neue Kammermusik 1998, 96, zit. nach Drees 2006, 11. | |
Ligeti 2007a, 95. | |
Vgl. dazu im Detail die Analyse in Borio 1993, 33–57. | |
Vgl. ebd., 43f. | |
Ligeti 2007b, 177. | |
Ebd. | |
Vgl. Borio 1993, 33–57. | |
Ebd., 56. | |
Brief an Bo Wallner, 11.8.1962, zit. nach Kakavelakis 2001, 113. | |
Salmenhaara 1969, 115. | |
Ebd., vgl. dazu auch Ligeti 2007c und 2007d. | |
Kaufmann 1969. | |
Ebd., 136. | |
Die Analysen zu Ligetis Aventures bieten unterschiedliche Gliederungsmodelle. Ich unterscheide sieben (bzw. acht inkl. der abschließenden Stille) Abschnitte (Takte 1–19; 20–37; 38–46; 47–48; 49–98; 99–107; 108–113; 114–115), die 5-2-1-1-9-1-1-1 (gesamt also 21) untergeordnete Episoden enthalten. Ligetis Librettoentwurf ist in sechs Bilder (Takte 1–9; 10–37; 38–89; 90–98; 99–107; 108–115) zu 21 Szenen gegliedert (3-1-10-3-2-2; vgl. 2007c). | |
Vgl. dazu Salmenhaara 1969, 106–108 und Siegele 2002. | |
Ligetis Nouvelles Aventures (1962/65), auch der II. Satz, der ebenfalls 1962 komponiert wurde, sind durch ritornellartig wiederkehrende Elemente weitaus konventioneller und übersichtlicher strukturiert und würden die Bezeichnung ›absurde Form‹ wohl kaum rechtfertigen. | |
Kaufmann 1969, 145. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1970), Ästhetische Theorie (= Gesammelte Schriften 7), Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
––– (1971), Mahler. Eine musikalische Physiognomik, in: Die musikalischen Monographien (= Gesammelte Schriften 13), Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 149–319.
––– (1975), Philosophie der neuen Musik (= Gesammelte Schriften 12), Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
––– (1977), »George und Hofmannsthal. Zum Briefwechsel: 1891–1906«, in: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft (= Gesammelte Schriften 10), Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 195–237.
––– (1978), »Vers une musique informelle«, in: Quasi una fantasia – Musikalische Schriften II (= Gesammelte Schriften 16), Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 493–540.
Besseler, Heinrich (1978), »Das musikalische Hören der Neuzeit«, in: Aufsätze zur Musikästhetik und Musikgeschichte, Leipzig: Reclam, 104–173.
Bharucha, Jamshed J. (1987), »Music Cognition and Perceptual Facilitation: A Connectionist Framework«, Music Perception 5/1, 1–30.
Borio, Gianmario (1993), Musikalische Avantgarde um 1960. Entwurf einer Theorie der informellen Musik (= Freiburger Beiträge zur Musikwissenschaft 1), Laaber: Laaber.
Bregman, Albert S. (1990), Auditory Scene Analysis. The Perceptual Organization of Sound, Cambridge MA: MIT Press.
Burnham, Scott (1995), Beethoven Hero, Princeton: Princeton Univ. Press.
Butt, John (2010), »Do Musical Works Contain an Implied Listener? Towards a Theory of Musical Listening«, Journal of the Royal Musical Association 135, Supplement, 5–18.
Cadenbach, Rainer (1991), »Der implizite Hörer? Zum Begriff einer ›Rezeptionsästhetik‹ als musikwissenschaftlicher Disziplin«, in: Rezeptionsästhetik und Rezeptionsgeschichte in der Musikwissenschaft (= Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover 3), hg. von Hermann Danuser und Friedhelm Krummacher, Laaber: Laaber, 133–163.
Caplin, William E. (2009), »Beethoven’s Tempest Exposition. A Springboard for Form-Functional Considerations«, in: Beethoven’s Tempest Sonata. Perspectives of Analysis and Performance, hg. von Pieter Bergé, Leuven: Peeters, 87–125.
Cook, Nicholas (1999), »Analyzing Performance and Performing Analysis«, in: Rethinking Music, hg. von Nicholas Cook und Mark Everist, Oxford, 239–261.
––– (2002), »Epistemologies of Music Theory«, in: The Cambridge History of Western Music Theory, hg. von Thomas Christensen, New York: Cambridge University Press, 78–105.
Dahlhaus, Carl (1980), Die Musik des 19. Jahrhunderts (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6), Laaber: Laaber.
Danuser, Hermann (1986), »Das imprévu in der Symphonik. Aspekte einer musikalischen Formkategorie in der Zeit von Carl Philipp Emanuel Bach bis Hector Berlioz«, Musiktheorie 1/1, 61–81. (= Gesammelte Vorträge und Aufsätze, hg. von Hans-Joachim Hinrichsen, Christian Schaper und Laure Spaltenstein, Bd. 1, Schliengen: Argus 2014, 239–260).
––– (1998), Art. »Tristanakkord«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl., hg. von Ludwig Finscher, Kassel u.a.: Bärenreiter u.a., Sachteil Bd. 9, 832–844.
Diergarten, Felix (2012), »Jedem Ohre klingend«. Formprinzipien in Haydns Sinfonieexpositionen, Laaber: Laaber.
Dömling, Wolfgang (1974), »›Die kranken Ohren Beethovens‹ oder Gibt es eine Geschichte des musikalischen Hörens?«, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 1, 181–194.
Drees, Stefan (2006), Salvatore Sciarrino, in: Komponisten der Gegenwart, 19. Nlfg. 4/00, München: edition text + kritik.
Fuß, Hans-Ulrich (2009), »Die ›Überleitung‹ im klassischen Stil: Hauptwege und Seitenwege in der Sonatenexposition bei Haydn, Mozart und Beethoven«, in: Passagen. Theorien des Übergangs in Musik und anderen Kunstformen (= musik.theorien der gegenwart 3), hg. von Christian Utz und Martin Zenck, Pfau: Saarbrücken, 113–149.
Grisey, Gérard (2010), »Zur Entstehung des Klangs…«, in: Mit Nachdruck. Texte der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, hg. von Rainer Nonnenmann, Mainz: Schott, 317–322.
Gülke, Peter (1991), Franz Schubert und seine Zeit, Laaber: Laaber.
Hamilton, Andy (2007), Aesthetics and Music, London: Continuum.
––– (2009), »The Sound of Music«, in: Sounds and Perception. New Philosophical Essays, hg. von Matthew Nudds und Casey O’Callaghan, Oxford: Oxford University Press, 146–182.
Hanslick, Eduard (1854), Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Haselböck, Lukas (2009), Gérard Grisey: Unhörbares hörbar machen, Freiburg: Rombach.
––– (2010), »Zur Aktualität der Musiktheorie Ernst Kurths«, in: Musiktheorie als interdisziplinäres Fach. 8. Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie Graz 2008 (= musik.theorien der gegenwart 4), hg. von Christian Utz, Saarbrücken: Pfau, 161–172.
Hepokoski, James / Warren Darcy (2006), Elements of Sonata Theory: Norm, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, New York: Oxford University Press.
Holtmeier, Ludwig (2002), »Der Tristanakkord und die Neue Funktionstheorie«, Musiktheorie 17/4, 361–365.
Huron, David (2006), Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation, Cambridge, MA: MIT Press.
Husserl, Edmund (1928), Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, hg. von Martin Heidegger, Halle: Niemeyer.
Iser, Wolfgang (1972), Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett, München: Fink.
––– (1984), Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, zweite, durchgesehene und verbesserte Aufl., München: Fink.
Jauss, Hans Robert (1970), »Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft«, in: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 144–207.
Kakavelakis, Konstantinos (2001), György Ligetis »Aventures & Nouvelles Aventures«. Studien zur Sprachkomposition und Ästhetik der Avantgarde (= Europäische Hochschulschriften 36), Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Karno, Mitchell / Vladimir J. Konečni (1992), »The Effects of Structural Interventions in the First Movement of Mozart’s Symphony in G-Minor K. 550 on Aesthetic Preference«, Music Perception 10/1, 63–72.
Kaufmann, Harald (1969), Ein Fall absurder Musik. Ligetis »Aventures & Nouvelles Aventures«, in: Spurlinien. Analytische Aufsätze über Sprache und Musik, Wien: Lafite, 130–158.
Klein, Richard (2011), »Die Frage nach der musikalischen Zeit«, in: Adorno Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. von Richard Klein, Johann Kreuzer und Stefan Müller-Doohm, Stuttgart: Metzler, 59–74.
Koch, Heinrich Christoph (1782/1787/1793), Versuch einer Anleitung zur Composition, 3 Bde., Rudolstadt und Leipzig: Adam Friedrich Böhme, Reprint Hildesheim: Olms 1969.
Kurth, Ernst (1923), Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners »Tristan«, Berlin: Max Hesse.
Kurth, Richard (1999), »On the Subject of Schubert’s ›Unfinished‹ Symphony: ›Was bedeutet die Bewegung?‹«, 19th-Century Music 23/1, 3–32.
La Motte-Haber, Helga de / Günther Rötter (2005), »Formwahrnehmung«, in: Musikpsychologie (= Handbuch der systematischen Musikwissenschaft 3), hg. von dens., Laaber: Laaber, 263–267.
Ligeti, György (2007a), Wandlungen der musikalischen Form, in: Gesammelte Schriften Bd. 1 (= Publikationen der Paul Sacher Stiftung Basel 10, 1), hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz: Schott, 85–104.
––– (2007b), »Zustände, Ereignisse, Wandlungen. Bemerkungen zu Apparitions«, in: Gesammelte Schriften Bd. 2 (= Publikationen der Paul Sacher Stiftung Basel 10, 2), hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz: Schott, 170–173.
––– (2007c), »Libretto zu Aventures und Nouvelles Aventures«, in: Gesammelte Schriften Bd. 2 (= Publikationen der Paul Sacher Stiftung Basel 10, 2), hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz: Schott, 201–225.
––– (2007d), »Über szenische Möglichkeiten von Aventures«, in: Gesammelte Schriften Bd. 2 (= Publikationen der Paul Sacher Stiftung Basel 10, 2), hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz: Schott, Bd. 2, 198–201.
Margulis, Elizabeth H. (2007), »Surprise and Listening Ahead: Analytic Engagements with Musical Tendencies«, Music Theory Spectrum 29/2, 197–217.
Marsden, Alan A. (1989), »Listening as Discovery Learning«, Contemporary Music Review 4/1, 327–340.
Mauser, Siegfried (1993), »Rezeptionsästhetik als Paradigma postmoderner Theoriebildung«, in: Wiederaneignung und Neubestimmung. Der Fall »Postmoderne« in der Musik (= Studien zur Wertungsforschung 26), hg. von Otto Kolleritsch, Wien: Universal Edition, 14–21.
McClary, Susan (1994), »Constructions of Subjectivity in Schubert’s Music«, in: Queering the Pitch. The New Gay and Lesbian Musicology, hg. von Philip Brett, Elizabeth Wood und Gary Thomas, New York: Routledge, 205–233.
Meyer, Leonard B. (1956), Emotion and Meaning in Music, Chicago: University of Chicago Press.
––– (1967), Music, the Arts and Ideas. Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, Chicago: University of Chicago Press.
––– (1989), Style and Music. Theory, History, and Ideology, Chicago: University of Chicago Press.
Mosch, Ulrich (2004), Musikalisches Hören serieller Musik. Untersuchungen am Beispiel von Pierre Boulez’ »Le Marteau sans maître«, Saarbrücken: Pfau.
Narmour, Eugene (1999), Hierarchical Expectation and Musical Style, in: Psychology of Music, hg. von Diana Deutsch, 2. Aufl., San Diego: Academic Press, 441–472.
Neuwirth, Markus (2008), »Das Konzept der Expektanz in der musikalischen Analyse. Möglichkeiten und Probleme einer kognitiv orientierten Musikanalyse«, in: Musiktheorie im Kontext. 5. Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie Hamburg 2005, hg. von Jan Philipp Sprick, Reinhard Bahr und Michael von Troschke, Berlin: Weidler, 557–573.
––– (2011), »Joseph Haydn’s ›Witty‹ Play on Hepokoski and Darcy’s Elements of Sonata Theory. James Hepokoski / Warren Darcy, Elements of Sonata Theory: Norm, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata, New York: Oxford University Press 2006«, in: ZGMTH 8/1, 199–220. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/586.aspx
––– (Druck in Vorbereitung), “New Twists of the Old”: Recomposed Recapitulations in the Works of Joseph Haydn and His Contemporaries, Leuven: Leuven
University Press.
Öhman, Arne / Stefan Wiens (2003), »On the Automaticity of Autonomic Responses in Emotion. An Evolutionary Perspective«, in: Handbook of Affective Sciences, hg. von Richard J. Davidson, Klaus R. Scherer und H. Hill Goldsmith, Oxford: Oxford University Press, 256–275.
Riemann, Hugo (1916), »Ideen zu einer ›Lehre von den Tonvorstellungen‹«, in: Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 21/22, Leipzig: Peters, 1–26.
Riley, Matthew (2008), »Sonata Principles«, Music & Letters 89/4, 590–598.
Rohringer, Stefan (2013), »Zu Johannes Brahms’ Intermezzo h-Moll op. 119/1«, ZGMTH 10/1, 79–145, http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/707.aspx
Russell, James A. (1980), »A Circumplex Model of Affect«, Journal of Personality and Social Psychology 39/6, 1161–1178.
Salmenhaara, Erkki (1969), Das musikalische Material und seine Behandlung in den Werken »Apparitions«, »Atmosphères«, »Aventures« und »Requiem« von György Ligeti (= Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft 19; Acta musicologica Fennica 2), Regensburg: Bosse.
Schmidt, Matthias (2006), »Sinfonik zwischen Kanon und Öffentlichkeit«, in: Die Sinfonie der Wiener Klassik (= Handbuch der musikalischen Gattungen 2), hg. von Gernot Gruber und Matthias Schmidt, Laaber: Laaber, 239–260.
Schwab-Felisch, Oliver (2004), »Die Abreißbarkeit der Gerüste. Zum Verhältnis von Analyse und Theorie«, Musiktheorie 19/4, 349–353.
Sciarrino, Salvatore (1998), Le figure della musica. Da Beethoven a oggi, Mailand: Ricordi.
Scruton, Roger (1997), The Aesthetics of Music, Oxford: Oxford University Press.
––– (2009), »Sounds as Secondary Objects and Pure Events«, in: Sounds and Perception. New Philosophical Essays, hg. von Matthew Nudds und Casey O’Callaghan, Oxford: Oxford University Press, 50–68.
Siegele, Ulrich (2002), »Planungsverfahren in György Ligetis Aventures & Nouvelles Aventures«, Musik & Ästhetik 22, 40–51.
Spitzer, Michael (2010), »Mapping the Human Heart. A Holistic Analysis of Fear in Schubert«, Music Analysis 29/1–3, 149–213.
Stockhausen, Karlheinz (1963a), »Situation des Handwerkes (Kriterien der ›punktuellen Musik‹)«, in: Texte zur Musik, Bd. 1: Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hg. von Dieter Schnebel, Köln: Du Mont 1963, 17–23.
––– (1963b), »Gruppenkomposition: Klavierstück I«, in: Texte zur Musik, Bd. 1: Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hg. von Dieter Schnebel, Köln: Du Mont, 63–74.
––– (1963c), »Struktur und Erlebniszeit«, in: Texte zur Musik, Bd. 1: Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens, hg. von Dieter Schnebel, Köln: Du Mont, 86–98.
Temperley, David (2001), The Cognition of Basic Musical Structures, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Tillmann, Barbara / Bigand, Emmanuel (2004), »The Relative Importance of Local and Global Structures in Music Perception«, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 62/2, 211–222.
Utz, Christian (2010), Art. »Tristanakkord«, in: Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 6), hg. von Helga de la Motte-Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter und Christian Utz, Laaber: Laaber, 496–498.
––– (2013a), »Entwürfe zu einer Theorie musikalischer Syntax. Morphosyntaktische Beziehungen zwischen Alltagswahrnehmung und dem Hören tonaler und posttonaler Musik«, in: Musik-Sprachen. Beiträge zur Sprachnähe und Sprachferne von Musik im Dialog mit Albrecht Wellmer (= musik.theorien der gegenwart 5), hg. von Christian Utz, Dieter Kleinrath und Clemens Gadenstätter, Saarbrücken: Pfau 2013, 61–101.
––– (2013b), »Die Inszenierung von Stille am Rande ohrenbetäubenden Lärms. Morphologie und Präsenz in Salvatore Sciarrinos Kammermusik der 1980er Jahre«, Die Tonkunst H. 3, 325–339.
––– (2013c), »Erinnerte Gestalt und gebannter Augenblick. Zur Analyse und Interpretation post-tonaler Musik als Wahrnehmungspraxis – Klangorganisation und Zeiterfahrung bei Morton Feldman, Helmut Lachenmann und Brian Ferneyhough«, in: Ans Licht gebracht. Zur Interpretation Neuer Musik (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 53), hg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz: Schott, 40–66.
Weber, Gottfried (1830–32), »Ueber eine besonders merkwuerdige Stelle in einem Mozart’schen Violinquartett aus C«, in: Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, Bd. III, 3. Aufl., Mainz: Schott, 196–226.
Zehentreiter, Ferdinand (1997), »Adornos materiale Formenlehre im Kontext der Methodologie der strukturalen Hermeneutik – am Beispiel einer Fallskizze zur Entwicklung des frühen Schönberg«, in: Biographische Konstellation und künstlerisches Handeln, hg. von Giselher Schubert, Mainz: Schott, 26–60.
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz [University of Music and Performing Arts Graz]
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.