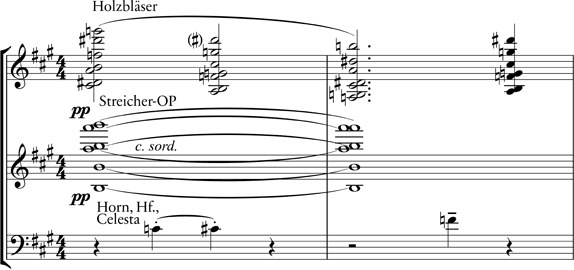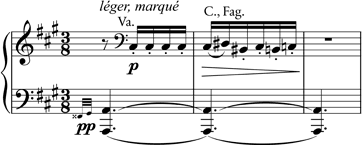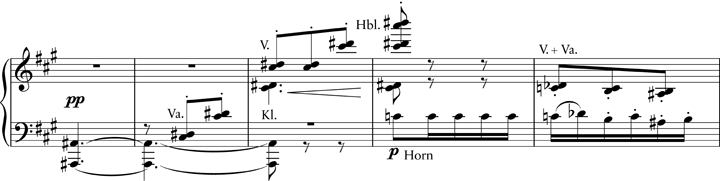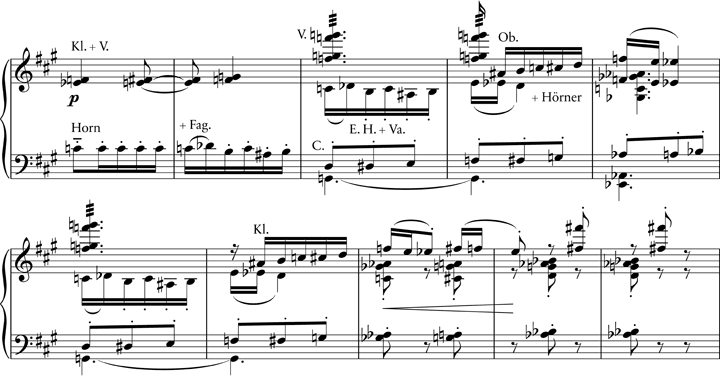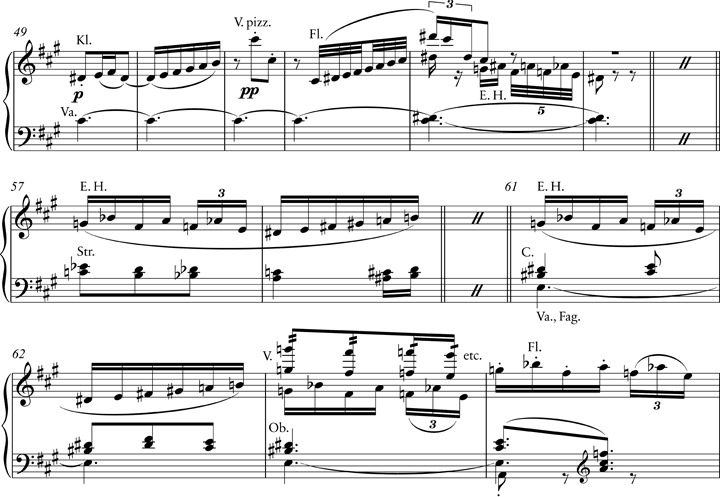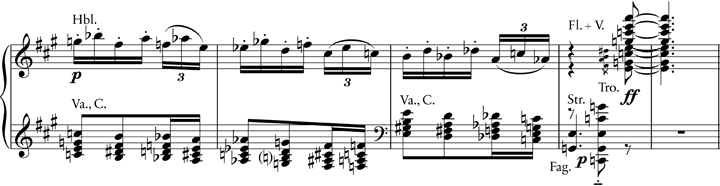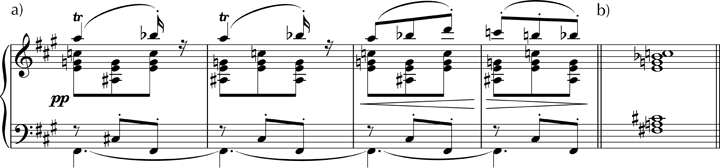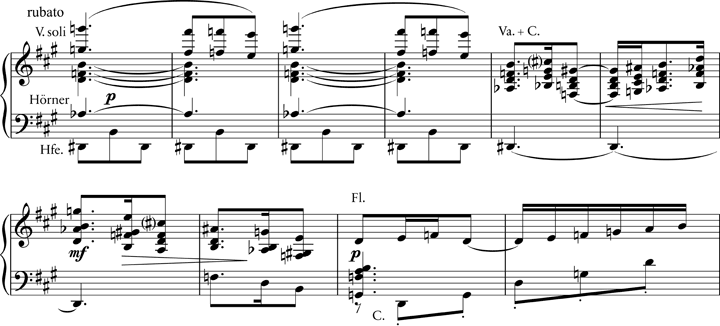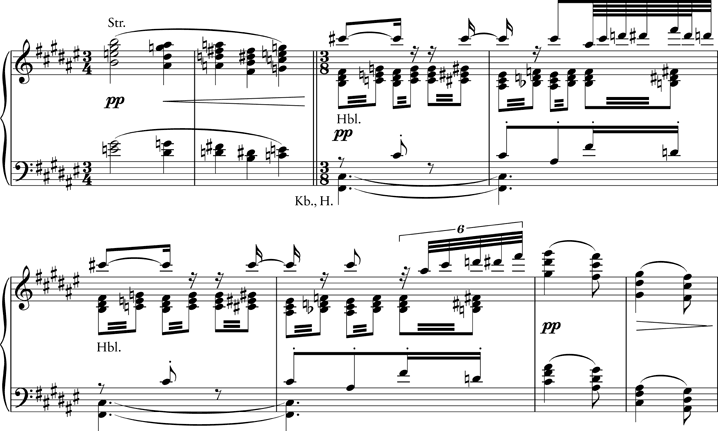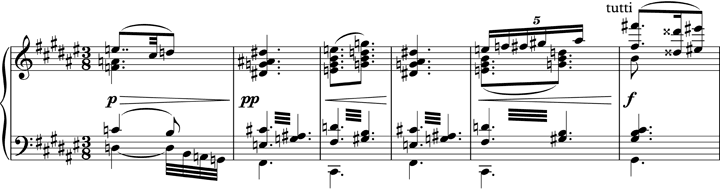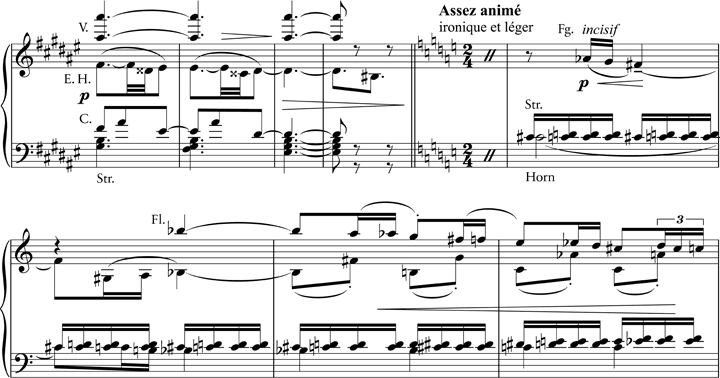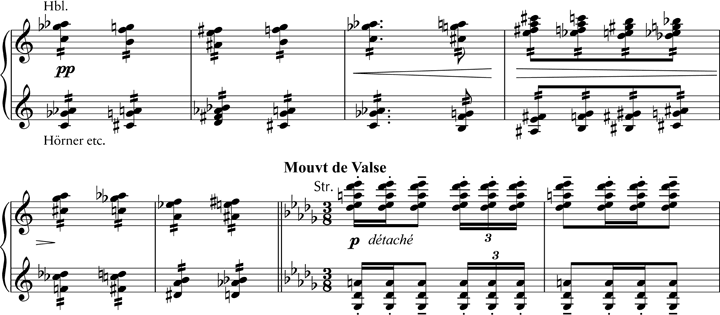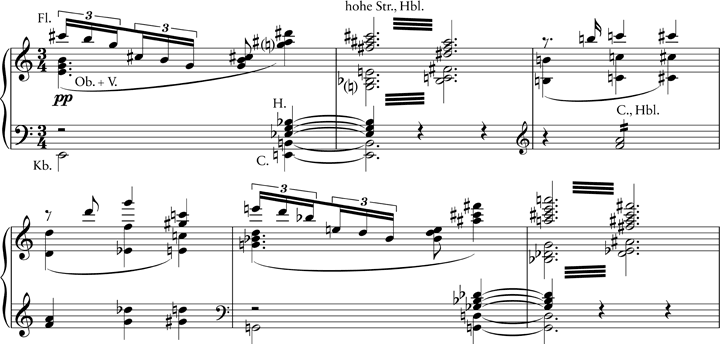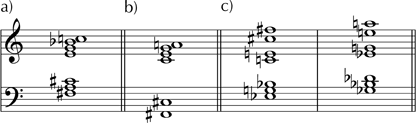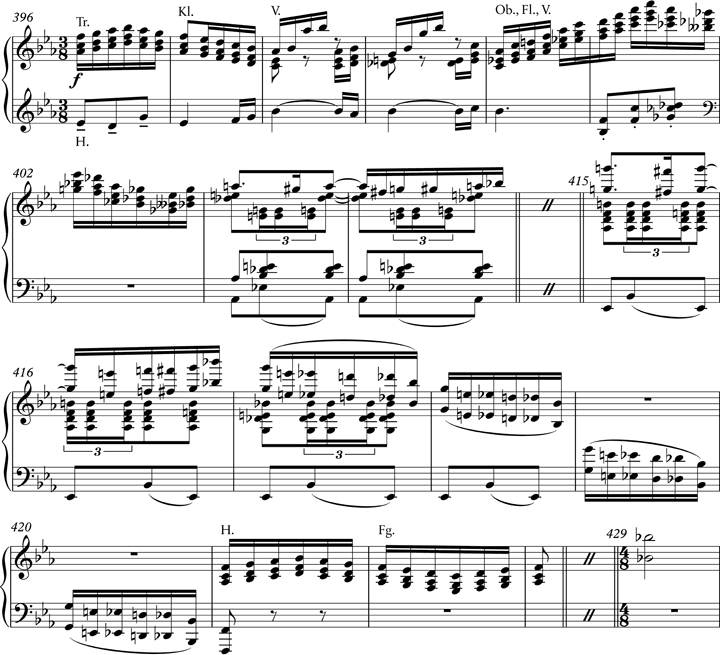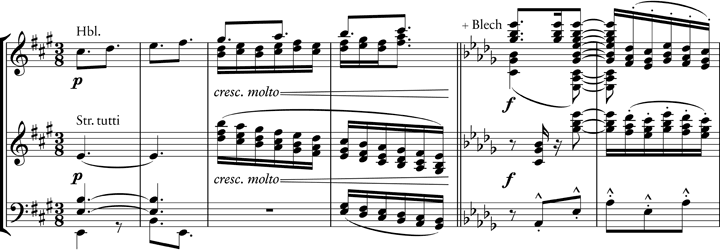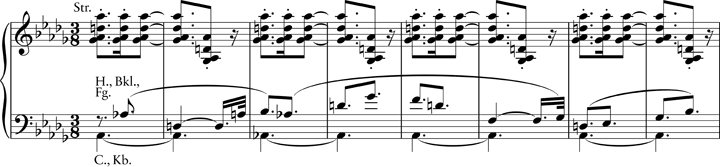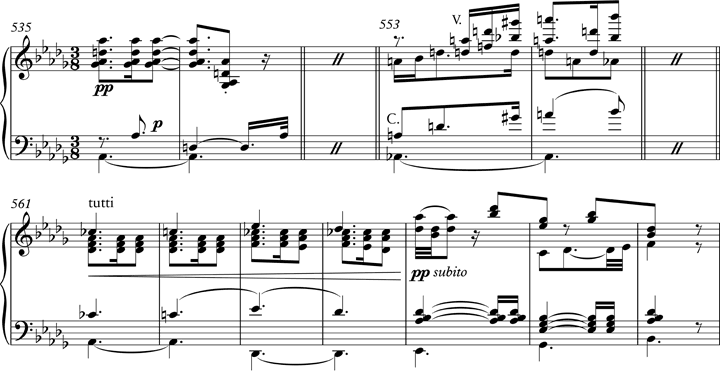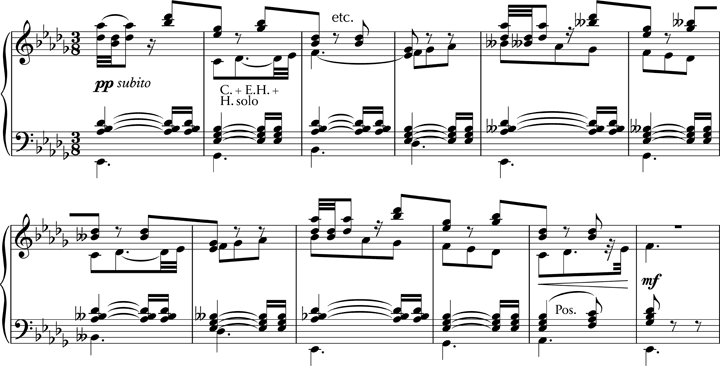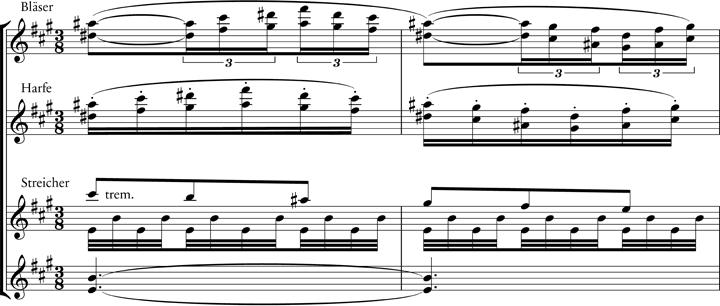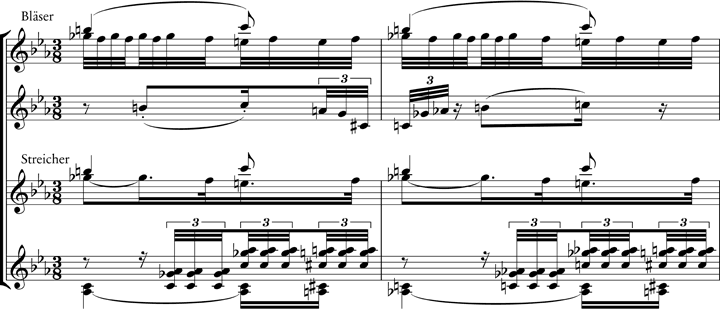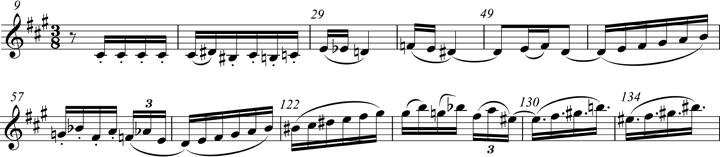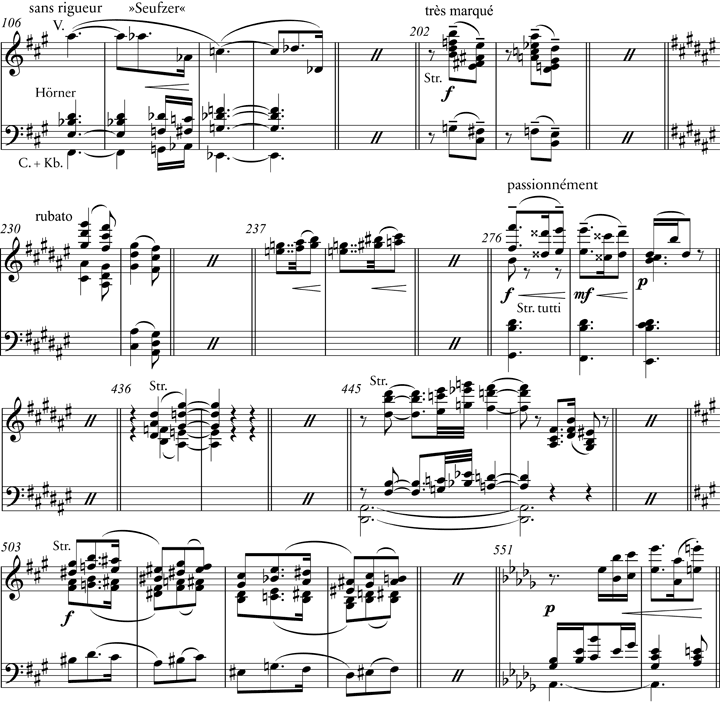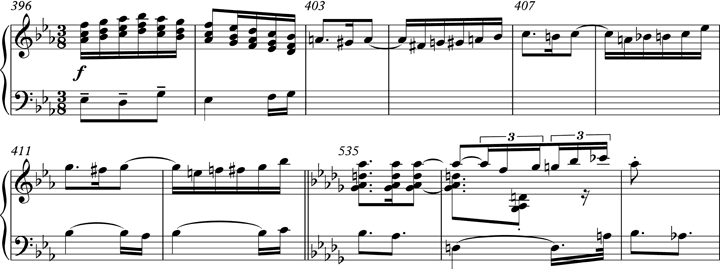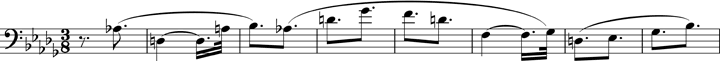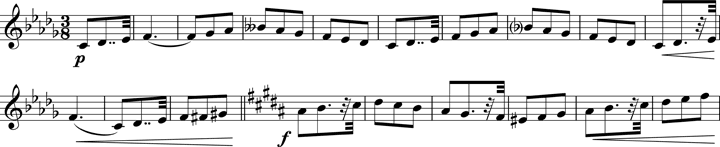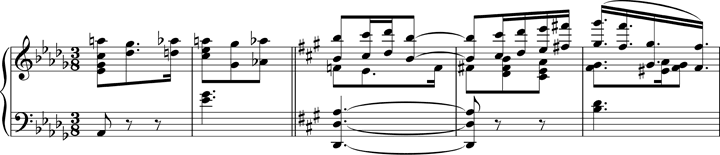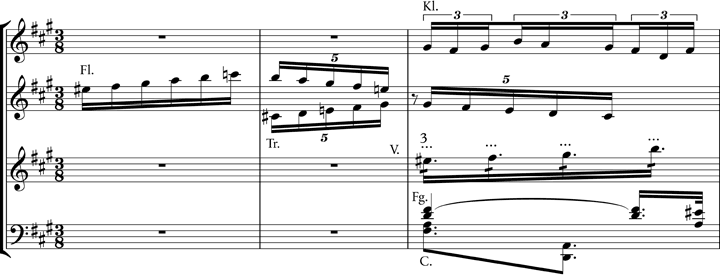Jeux – eine Werkanalyse
Andreas Winkler
Die Jeux sind Claude Debussys letztes großes Orchesterwerk und von diesen vielleicht sein am wenigsten bekanntes, ein poème dansé, das den Eingang weder ins Orchester- noch ins Ballett-Standardrepertoire gefunden hat. Vorliegender Aufsatz hat sich zum Ziel gesetzt, an Hand dieser Partitur und mit Hilfe von Albert Simons Theorie der Tonfelder einen Beitrag zur Debussy-Forschung zu leisten; es soll gezeigt werden, wie Funktionalität in den Jeux Form und Zusammenhänge stiftet, wie dieses Stück sich aus einem Intervall (der großen Sekunde nämlich) entwickelt, und wie sich Motive von nahezu unbegrenzter Gestaltvariabilität transformieren und permutieren lassen. Es soll außerdem eine Verortung der Jeux im Schaffen Debussys und in der Musik der frühen Moderne versucht werden.
I. Zur Rezeptionsgeschichte von Jeux
»Das Ballett Jeux von Debussy wurde lange Zeit ›mit Vorsicht‹ behandelt«, notiert Pierre Boulez 1956[1], genau in jener Zeit, als man sich in Kreisen der Neuen Musik mit Debussy intensiver zu beschäftigen beginnt. Debussy habe auf die gewohnte ›Architektonik‹ in den Jeux verzichtet, ein Ringen um neue Formen setze in diesem Stück ein (und sich in seinem gesamten Spätwerk fort[2]), weswegen es immer noch aktuell sei:
Jeux est contemporain de Pierrot lunaire et du Sacre de printemps, maintenant que l’on a assimilé et l’écriture du choc et le chromatisme intérieur, la lumière qui émane de Jeux nous apparaît encore comme mystérieuse.[3]
Debussy, so der Komponist und Debussy-Biograph Jean Barraqué, habe die offene Form geschaffen, die in Jeux zur Vollendung gelangt sei[4]; in seinen letzten Stücken manifestiere sich eine »gewisse Ähnlichkeit mit den neuesten Arbeiten serieller Komponisten«.[5]
Die eigenwillige Anlage des Stückes und seine Besonderheiten haben in der Vergangenheit die Jeux als die ›modernste‹ Partitur, die Debussy je geschrieben hat (mit »epochaler Bedeutung«[6]), erscheinen und mehrfach zu einem Analysegegenstand für Komponisten Neuer Musik werden lassen. So erkannte Stockhausen 1954 in ihnen die erste »statistische[…] Form«, an welche er kompositorisch anzuknüpfen gedachte.[7] Womöglich sind die Jeux der Grund dafür, dass man von Seiten der Neuen Musik in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre – im Anschluss an die allgegenwärtige Webern-Rezeption – auf Debussy zu sprechen kam, warum er plötzlich ›etwas galt‹.
Bei Debussy-Biographen und der Mehrheit der Musikwissenschaftler hingegen herrscht oft ungläubiges Staunen und schüchterne Verständnislosigkeit vor, sofern sie überhaupt von diesem Stück Notiz nehmen. Debussy folge den Anforderungen des Balletts und habe das federnde Hin und Her des Tennis (des Sujets) in Musik übertragen und dabei die »gewohnten Kompositionsregeln über den Haufen geworfen«[8], liest man bei Léon Vallas, während Heinrich Strobel von einem freien Rondo spricht[9] und Hans Rutz von einem Stück Musik, das »mehr einer symphonische[n] Dichtung als einem ausgesprochenen Ballett«[10] gleiche. Zumeist legen diese Annäherungsversuche – wie auch die Analyse Albert Jakobiks[11] – den Schluss nahe, es handele sich im Grunde um ein ›unanalysierbares‹ Stück Musik[12], dem man nur mit unscharfen oder außermusikalischen Kriterien beikommen könne.
Substanzielle Analysen des Stückes verfassten Herbert Eimert, Jann Pasler und Claudia Maurer Zenck, auf die ich im Verlauf meiner eigenen Arbeit auch des Öfteren Bezug nehmen werde.
Eimert geht in seiner scharfsichtigen Analyse besonders auf die Motivarbeit ein. Die Verwandtschaft der in den Jeux verwendeten Motive – die er Arabesken nennt – untereinander und ihre »unendliche« Variabilität bezeichnet er als »organisch«, die Erkennbarkeit des Ähnlichen (also der variierten Motive oder Arabesken) führt er wohl zurecht auf die Technik der Motivassoziation zurück.[13]
Pasler konzentriert sich ebenfalls auf die motivischen und rhythmischen Elemente. Sie bemerkte als Erste, dass man die Motivelemente auch als Teil eines melodischen Ganzen sehen kann und nicht nur als Variationsspiele einer ›Arabeske‹. Ihre Untersuchung des werkimmanenten Gegensatzes zwischen Kontinuität und Diskontinuität[14] entspringt jedoch einer mehr philosophischen denn spezifisch musikanalytischen Perspektive.
Maurer Zenck wiederum richtet ihr Hauptaugenmerk auf Struktur und Instrumentation. Ihr Haupteinwand hinsichtlich der Analysen des Stückes durch Komponisten Neuer Musik richtet sich gegen deren durch Eigeninteresse geleitete Perspektive:
Eimerts Aussage über die Flexibilität der Anlage ist sicher richtig, sollte aber nicht auf den Gedanken von der ornamentalen Wellenform […] beschränkt werden. Tatsächlich ergibt sich bei der Lektüre von Eimerts Aufsatz der Eindruck, die Musik bewege sich unaufhörlich auf und ab, sei in ständiger Veränderung begriffen – aber ohne jedwede Entwicklung.[15]
In Anbetracht der Tatsache, dass Debussy lange Zeit vor allem als harmonischer Neuerer galt, ist es jedoch erstaunlich, dass auch die besten dieser Analysen sich wenig oder gar nicht um die Harmonik der Jeux gekümmert haben. Woran mag das liegen? Zum einen vielleicht daran, dass für die einen die Debussy’sche Harmonik als ›noch tonal‹ nicht interessant genug war[16] und für die übrigen die z.T. komplexen Tongebilde ein analytisch unüberwindliches Hindernis darstellten. Zum anderen mag die Vernachlässigung der Harmonik in Jeux vielleicht auch mit der Vermutung zusammenhängen, Debussy habe die Handlung dieses Balletts genau nachkomponiert – ›am Text entlang‹. Ob dies so stehen gelassen werden kann, wird weiter unten diskutiert; sicher aber führt die Konzentration auf das Sujet und seine musikalischen Entsprechungen zur Fokussierung auf motivische, strukturelle oder klangliche Aspekte – letztere im Sinne von Instrumentation und Orchesterbehandlung – und nicht zu einer Analyse des harmonischen Bauplans.
II. Das Sujetproblem
»Die Folgen einer verunglückten Premiere belasteten Jeux bis in unsere Zeit«[17], vermutet Pommer im Vorwort zu seiner Edition der Jeux, und tatsächlich ist das letzte größere Werk Debussys ein »unterschätztes Stück Musik«[18], ein Stück für Fachleute, das dem breiten Konzertpublikum nur wenig vertraut ist.[19]
Es scheint jedoch weder an der lauen oder gar kalten Resonanz des Pariser Publikums am Premierentag[20] noch an der Konkurrenz des Sacre de printemps (dessen Premiere sollte zwei Wochen später in demselben Theater einen beispiellosen Skandal hervorrufen) allein gelegen zu haben, dass Debussys letztes Orchesterstück lange Zeit wenig gespielt wurde und selbst in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich ins Standardrepertoire hineingefunden hat.[21] Alle diese Erklärungsansätze schieben die ›Schuld‹ auf äußere Einflüsse; eher jedoch steht zu vermuten, dass ein ›inneres‹ Problem, nämlich die Wahl des Stoffes, hauptverantwortlich für den relativen Misserfolg der Jeux ist.
Den Anstoß zu diesem Handlungsballett gab Vaclav Nijinsky, der vielleicht bedeutendste Tänzer seiner Zeit. Nijinsky war die Hauptattraktion der Ballets Russes, einer gefeierten russische Tanztruppe, die seit 1909 jeden Sommer in Paris gastierte und im Théatre des Champs-Elysées z.T. aufsehenerregende Inszenierungen darbot. Die russischen Tänzer hatten sich 1911 bereits an der schwierigen Aufführung von Le Martyre de Saint-Sébastien beteiligt[22]; im Sommer 1912 stellte Nijinsky seine erste Choreographie vor, einen Solo-Tanz zu Debussys Komposition Après-midi d’un faune – eine Darbietung mit deutlich autoerotischen Zügen. Vor allem Stravinsky komponierte für seine Landsleute, neben dem Sacre sind u.a. Der Feuervogel und Petruschka explizit für die Ballets Russes entstanden.
Chef und Mentor, bis zu einem gewissen Grade sogar Eigner der Truppe war Sergej Diaghilev, ein Impresario und sehr eigentümlicher Kunstförderer.[23] Nachdem er 1908 bereits eine Pariser Opernproduktion (Mussorgskys Boris Godunow) in die Wege geleitet hatte, hatten sich die Ballets Russes 1909 unter seiner Leitung formiert. Neben den bedeutendsten Pariser Komponisten der Zeit wirkten auch die bedeutendsten bildenden Künstler an diesen Aufführungen mit: Bühnenbilder stammten von Picasso, Matisse, Cocteau, Bakst; neben Debussy und Stravinsky gab es Musik von Ravel, Satie, Prokofjev und sogar Richard Strauss (Till Eulenspiegel, choreographiert von Nijinsky).[24] Die Liste der Freunde und Geförderten von Diaghilev liest sich wie ein Who is Who der Zeit um den Ersten Weltkrieg.[25] Ging die Tanztruppe zunächst noch vom klassischen russischen Ballett aus, so wurde sie doch bald zum gefeierten und umstrittenen Avantgarde-Ensemble, das dem klassischen Tanz die Wege in die Moderne eröffnen sollte. So kam es, dass ein Mann, der nicht besonders musikalisch war und weder tanzen noch choreographieren konnte, zu einer Schlüsselfigur des moderneren Balletts wurde.[26]
Diaghilev vermittelte Debussy als dem damals bedeutendsten in Paris lebenden Komponisten die Grundidee dieses Stoffes, der die Saison am 15. Mai 1913 eröffnen sollte.[27] Es war jedoch Nijinsky, der die Geschichte ausformulierte.[28] Sie besteht im Vergleich zu Stravinskys Sacre aus einer eher trivialen Handlung: eine »banale«[29] Dreiecksgeschichte, in der zwei junge Frauen und ein junger Mann sich bei beginnender Dämmerung in einem Park verlaufen und Sympathien füreinander entdecken. Es kommt zwischenzeitlich zu Reaktionen der Eifersucht und am Ende zur Versöhnung – deren delikate Konsequenzen lediglich angedeutet bleiben.
Abgesehen von angeblich autobiographischen Anspielungen[30] sollte diese Geschichte vor allem eine Hommage an den Sport bzw. eine Huldigung an die Moderne darstellen: »die plastische Apologie des Menschen von 1913«.[31] Das Thema des ›modernen, sportlichen Menschen‹ versprach im Mittelpunkt eines Balletts zwar interessant zu werden, aber die wenig anspruchsvolle Handlung war wohl kaum geeignet, die Möglichkeiten der Allegorie auszuschöpfen, denn der Plot dieser kleinen Geschichte könnte genauso im Rokoko und auf dem flachen Land statt in einem Pariser Park spielen und ist überhaupt nicht zwingend mit Sport, Modernität oder Urbanität verbunden.
Die Sportart der Jeux, die von Nijinsky vielleicht als besonders zeitgemäß erachtet wurde, ist Tennis. Alle drei Akteure des Balletts sollten in Tennisdress gekleidet sein. Die Gesichter – wie auch schon im Faune – sollten keine Regung zeigen, aller Ausdruck sollte nur über die schlichten mechanischen Bewegungen vermittelt werden, man tanzte ›demi-pointe‹ (also auf dem Ballen anstatt auf den Zehen), und erstmals in einem Diaghilev-Ballett sollte alles, Handlung, Kostüme, Bühnenbild, Choreographie und Sujet, ›aktuell‹ sein.[32]
Nijinskys Tanzstil war vermutlich von Tanz- und Bewegungsschulen wie der des Schweizers Émile Jaques-Dalcroze[33] beeinflusst, welcher ein weitgehend mechanistisches Menschenbild verkündete und in dieser Richtung erzieherisch tätig wurde.[34] Die Betonung des sportlich-motorischen Moments und die Kostümierung nach modernem, sachlichem Geschmack (›Gebrauchskleidung‹ auf der Bühne) sprechen jedenfalls dafür. Eine andere Verbindung, die diskutiert wurde, ist diejenige Nijinskys zu den modernen Malern der Zeit: Gauguin, Cézanne, Modigliani, Matisse.[35] Inwieweit es sich bei dieser Verbindung um eine aktive künstlerische Auseinandersetzung oder doch nur um einen oberflächlichen Kontakt gehandelt hat, soll hier nicht erörtert werden; fest steht nur, dass die ästhetische Strömung, der Nijinsky anhing, von den Ansichten und dem Geschmack Debussys weit entfernt gewesen ist. Der Debussy-Biograph Strobel stellt lapidar fest: »Es ist zu bezweifeln, ob Nijinsky in der Lage war, eine so feinästige Partitur wie Jeux tänzerisch zu deuten.«[36] Bereits in Nijinskys erster Choreographie (zum Faune 1912) fanden – in denkbar größtem Gegensatz zur Tradition des klassischen Balletts[37] – alle Bewegungen langsam und gerade parallel zur Bühnenfront statt, die Gesichter blieben im Profil.[38] Die eigentümliche »Eckigkeit«[39] seines Tanzes (jedenfalls in seinen eigenen Choreographien) wurde von den Zeitgenossen je nach Geschmack bewundert oder abgelehnt.
Debussy war von Nijinskys »mathematisch-intellektueller Manier«[40] nicht angetan[41] (was ihn aber nicht daran hinderte, den Auftrag anzunehmen). Darüber hinaus werden sich Sujet und Tänzer-Choreograph und die Persönlichkeit und Überzeugungen des Komponisten nicht besonders gut ergänzt haben; denn Debussy war als Komponist mit der symbolistischen Oper Pelléas et Melisande und (ein Jahr zuvor) mit dem »Mysterienspiel« Le Martyre de Saint-Sébastien nach Gabriele d’Annunzio in die Öffentlichkeit getreten. Letzteres führte zu einem handfesten Skandal, der in Exkommunikationsdrohungen von Seiten des Pariser Erzbischofs gipfelte. Zwar äußerte Debussy im Zusammenhang mit der umstrittenen Aufführung dieses ›Schauspiels‹ (in dem, »nach Debussy, der Adoniskult sich mit dem von Jesus verbindet«[42]) ein religiöses Bekenntnis. Doch könnte dieses durch den erzbischöflichen Zensurversuch motiviert gewesen sein und ist daher nicht geeignet, Debussy als ›tief religiös‹ einzustufen. Es darf aber auch bezweifelt werden, dass Debussy es für nötig hielt, seinen Glauben mit dem Erzbischof von Paris zu diskutieren, wie es aus einem an diesen adressierten Brief von 1912 indirekt hervorgeht:
Ist der Glaube, den meine Musik zum Ausdruck, bringt, orthodox oder nicht? [… Ich muss] Ihnen sagen, dass ich in zwei Monaten eine Partitur schrieb, für die ich normalerweise ein Jahr gebraucht hätte.[43]
Debussy bekannte sich zu einer nicht immer klaren Form des Pantheismus[44]; er liebte die Natur und die Stille.[45] Von einer besonderen Affinität zum modernen Großstadtleben (obgleich er den größten Anteil seines Lebens in Paris lebte) kann nicht die Rede sein – auch eine Vorliebe für den ›weißen Sport‹ ist nicht überliefert. Und dieser Komponist sollte nun ein Stück über einen kurzweiligen Flirt in einem metropolitanen Naherholungsgebiet schreiben![46]
Es mag aber auch die Frustration über das Scheitern des Saint-Sébastien eine Rolle gespielt haben. Debussy hatte sich für dieses Stück und für seinen Autor d’Annunzio sehr begeistert; die kühle Aufnahme des Werkes durch das Pariser Publikum – vielleicht auch auf eine qualitativ nicht hinreichende Aufführung zurückzuführen – dürfte für ihn ein schwerer Schlag gewesen sein und vielleicht der Ansporn, sich demnächst auch bei geringerer emotionaler Verbundenheit mit einem Stoff in die Arbeit zu stürzen.[47]
Die von Diaghilev zum Choreographieren und Einstudieren benötigte Klavierfassung von Jeux wurde am 12.9.1912 zeitig fertiggestellt.[48] Strukturell hat Debussy das Stück später nur wenig verändert, lediglich das Ende ist auf Wunsch Diaghilevs um einige Takte länger geworden. Während der darauffolgenden Monate scheint der Komponist sich jedoch kaum damit beschäftigt zu haben, offensichtlich war ihm die Vollendung der Préludes für Klavier wichtiger. Die Orchestrierung schrieb er erst im April 1913.
Die Premiere der Jeux fand am 15. Mai 1913[49] unter der Leitung von Pierre Monteux im Théatre des Champs-Elysées in Paris statt. Das Ballett wurde insgesamt nur fünfmal gegeben.[50] Nijinsky tanzte den jungen Mann, Tamara Karsavina und Ludmilla Schollar tanzten die beiden Mädchen.[51] Auch Debussy und Diaghilev waren von der Aufführung nicht begeistert, offensichtlich aufgrund des Tanzes: »[…] auch äußerte er seine Unzufriedenheit mit Diaghilevs Tänzern. Besonders Nijinskys stilisierte Darstellung des Tennisspielers behagte ihm nicht«.[52] Selbst Nijinsky war mit sich unzufrieden, schob aber die Schuld für das Scheitern der Choreographie auf Diaghilev, der »kein Gefühl«[53] für das Szenario gehabt und nicht genug Zeit darein investiert habe. Die konzertante Uraufführung am 1. März 1914 im Rahmen der Konzertreihe Concerts Colonne unter Gabriel Pierné[54] fand nicht wesentlich mehr Beachtung[55], war aber immerhin der Auftakt zur Rezeption der Jeux als Konzertstück, gewissermaßen als symphonische Dichtung.
Vereinzelt hat das Werk den Weg in die Spielpläne der Ballette gefunden.[56] Jeder Choreograph hat eine Neufassung entworfen, keiner die ›originale‹ Fassung Nijinskys übernommen.[57] Der Eingang in den Kanon des klassischen Ballettrepertoires blieb den Jeux jedoch verwehrt.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Debussy tatsächlich eine Handlung in Musik gesetzt hat, so wie es überraschend einhellig in der Literatur behauptet wird.[58] Manche der heutigen Partituren geben vor, die ›komplette‹ Handlung des Balletts wiederzugeben. Es ist aber keineswegs klar, ob die dortigen Text-Musik-Korrespondenzen auf Debussy zurückgehen. Weder das Klavierparticell von 1912 noch die (Hand-)Reinschrift, nach welcher Monteux das Stück vermutlich dirigierte, noch eine von handschriftlichen Korrekturen Debussys übersäte Druckfassung (zweite Überarbeitung, Durand 1914) enthalten dahingehende Anweisungen.
Es existiert allerdings ein handschriftliches Particell mit sämtlichen Handlungsdetails, offenbar das Arbeitsparticell Nijinskys, das Anmerkungen von Debussy, Diaghilev und Nijinsky selbst enthält. Vermutlich beziehen sich die Herausgeber und Autoren, die ein detailliertes Handlungsballett unterstellen, auf dieses Dokument.
Die Zuordnung von Handlungsabläufen und Bewegungseinheiten auf bestimmte Stellen der Komposition dürfte allerdings fachkundiger von einem Choreographen als vom Komponisten selbst vorgenommen worden sein, noch dazu einem Musiker, der keineswegs auf Ballettmusik spezialisiert war.
Debussy selbst gab hinsichtlich des Auftrages am Tag der Uraufführung zu Protokoll:
[Diaghilev] sprach mit mir über ein Szenarium von Nijinsky, geformt aus diesem subtilen Nichts, aus dem, wie ich glaube, eine Tanzdichtung bestehen muss. Es gab darin einen Park, einen Tennisplatz […]; es gab eine geheimnisvolle nächtliche Landschaft mit, ich möchte fast sagen, ein wenig Mutwillen, zu dem diese Dunkelheit verführt […].[59]
Vermutlich hat Debussy also nur der rudimentäre Plot vorgelegen, zu welcher er die Klavierfassung (die strukturell weitgehend mit dem Endprodukt übereinstimmt) verfasste, nicht aber eine ausgearbeitete Handlung, die wahrscheinlich Nijinsky erst anschließend anhand jener Klavierfassung kreiert hat.[60]
III. Analyse
»Es wäre lächerlich, die Form eines Werkes bestimmen zu wollen, das sich prinzipiell jeder dialektischen Kontinuität widersetzt«[61], schrieb Barraqué über Jeux in seiner Debussy-Biographie. Gleichwohl soll es hier zunächst um Aufbau und Form dieses ›widersetzlichen‹ Werkes gehen. Im Anschluss werden mit Blick auf den Beginn der Jeux einige Besonderheiten motivisch-thematischer sowie harmonischer Art erörtert, bevor dies für Harmonik, Motivik und Orchestration in jeweils gesonderten Kapiteln geschieht.
Für die spezielle Betrachtung der Harmonik wiederum scheint zunächst eine Analyse des Gesamtverlaufs angemessen; außerdem werden Schlüsselstellen zu Anfang und Ende des ›Hauptteils‹ näher betrachtet, ebenso die Überleitung zum ›Scherzo‹ und einige andere herausragende Passagen. Weitere Stellen sollen es ermöglichen, auf Besonderheiten der Motivik und der Instrumentation einzugehen.
Jeux – poème dansé ist eine Komposition für großes Orchester. Die Besetzung ist mit Streichern, vierfach Holz, vierfach Blech und moderatem Schlagzeug aber relativ konventionell. Im Vergleich zu anderen Kompositionen der späten Romantik und der frühen Moderne steht sie dem eher ›klassischen‹ Orchester César Francks[62] näher als demjenigen Gustav Mahlers oder Richard Strauss’. Wie sich zeigen wird, trifft dies bis zu einem gewissen Grade auch für die Instrumentation selbst zu.
Formale Gliederung
Mit Ausnahme der sehr deutlich abgegrenzten ›Einleitung‹ (respektive deren langsamen Teil) und der ›Coda‹ reiht das Stück »ständig neue Themen, Motive und Arabesken aneinander.«[63] Bisherige Analysen neigten infolgedessen dazu, der Herausforderung, die dies für die Formanalyse bedeutet, dadurch auszuweichen, indem sie allzu selbstverständlich von einer ›Vertonung der Handlung‹ ausgingen und deren Gliederung adaptierten, auch wenn – wie oben dargelegt – von einer schlichten Text-Musik-Korrespondenz ohnehin nicht zweifelsfrei ausgegangen werden kann: so beispielsweise Jakobik, der eine Vierteiligkeit »entlang des Textes«[64] postuliert, ohne musikalische Belege beizubringen, die seine These überprüfbar machen könnten.[65]
Sucht man nach musikimmanenten Aspekten, die eine formale Gliederung erlauben, erscheint es sinnvoll, da die motivische Arbeit außerordentlich filigran ist und ›thematische Gruppen‹ nur an seltenen Stellen zu finden sind, sich zunächst an metrische und rhythmische Gegebenheiten sowie an das Tempo[66] zu halten – drei Aspekte, die für den musikalischen Zusammenhang der Jeux überaus bedeutsam sind, besonders angesichts der Tatsache, dass es sich um Ballettmusik handelt. Pasler schreibt:
What gives Jeux its formal coherence is its rhythmic organization; recurrence of motives and timbres support this form rather than create it. […] In this way, the rhythm of motives grows to be the rhythm of form.[67]
Jeux steht überwiegend im 3/8-Takt.[68] Einleitung und Coda sind durch einen 4/4-Takt und ein langsameres Tempo charakterisiert.[69] Ein 3/4-Takt steht an mehreren herausgehobenen Stellen.[70] Der 2/4-Takt ist das Metrum des ›Scherzos‹.[71] Ein 4/8-Takt erscheint nur für 6 Takte an gesonderter Stelle.
Von vielen Rubati im Mittelteil abgesehen, bleibt das Tempo relativ konstant. Den Achteln im 3/8-Takt entsprechen die im 3/4-Takt, was eine Halbierung des Grundschlags bedeutet. Selbst das Verhältnis zwischen 3/8-Takt und 4/4-Takt ist ein rationaler Bruch.[72] Die meist sanften Dehnungen und Zerrungen des Tempos (bei überwiegend gleichem Metrum) veranlassten Eimert, von einer »fluktuierenden Zeit«[73] zu sprechen.
Nach Paslers Ansicht symbolisieren die verschiedenen Taktarten (außer 4/4 und den marginalen 4/8) die drei Individuen: »three metric areas – 3/4, 3/8, 2/4 – carefully delineate the three individuals while two types of timbre […] differentiate the young man and the girls.«[74] Allerdings stimmt diese Einschätzung nicht mit dem oben diskutierten ›Libretto‹ überein. Überdies ist es unlogisch, dass die sehr seltenen, herausgehobenen 3/4-Takt-Stellen eine Hauptperson repräsentieren sollen. Hilfreich ist hingegen Paslers Großeinteilung; sie postuliert eine fünfteilige Form (nach Probeziffern):[75]
Anfang–5 (T. 1–46)
6–26 (T. 47–223)
27–50 (T. 224–454)
51–77 bzw. 79 (T. 455–688)
80–Ende (T. 689–709)
Hinsichtlich der beiden ersten und des abschließenden Formteils möchte ich mich Pasler anschließen, hinsichtlich der mittleren Formabschnitte scheint mir ihre Zuordnung jedoch zu undifferenziert. Ich schlage daher folgende Modifikation mit insgesamt sieben statt fünf Teilen vor:
Nummer des Formteils | Bezeichnung des Formteils | Takte |
I | Ouvertüre | 1–46 |
II | Exposition | 4–223 |
III | Lyrischer Mittelsatz, erster Großteil | 224–308 |
IV | Scherzo und Erster Walzer | 309–429 |
V | Lyrischer Mittelsatz, zweiter Großteil | 430–514 |
VI | Finale (Zweiter Walzer) | 515–688 |
VII | Coda | 689–709 |
Tabelle 1: großformale Gliederung
Die Siebenteiligkeit lässt sich als Ausdifferenzierung einer wiederum dreiteiligen Anlage verstehen, bei der I und II sowie VI und VII als Rahmenteile den aus III, IV und V gebildeten Mittelteil umfassen. Diese Bogenform hilft die ›kinetische Energie‹ der Komposition stärker zu verdeutlichen.[76]
Während II und VI ›flüssig‹ klingen und nur wenig Rubato-Stellen haben, ist die ›Mitte‹ III–V sehr kleingliedrig organisiert. Hier, insbesondere in den IV umschließenden Teilen III und V, herrschen Takt- und Tempowechsel vor.[77] Genau in der Mitte von IV und damit im Zentrum des ganzen Stückes gibt es zudem einen bemerkenswerten fermatenartigen ›Einschub‹ (T. 377–86) mit einem sehr seltsamen Akkord, auf den noch genauer eingegangen werden wird. Um diesen spannt sich der Erste Walzer und um den Ersten Walzer wiederum die beiden Teile des Lyrischen Mittelsatzes mit je 85 Takten. Das Finale nimmt Bezug auf die Exposition (leicht gedehnt), die Coda wiederum auf die Ouvertüre (stark gekürzt).[78]
Wie bei Debussy häufig, wird auch in den Jeux die äußere Form verschleiert oder durch häufiges Ineinandergreifen von Kleinteilen ›weicher‹ gemacht, z.B. nach dem Muster: A-B-Awdh.-Bwdh.+Fortentwicklung, oftmals einhergehend mit einer ›Beschleunigung‹. Diese Verquickung von Teilen begegnet uns bereits in der Ouvertüre.
Die Orientierung an Terminologie und Kategorien der ›klassischen Formenlehre‹ geschieht hier keineswegs unreflektiert. Insbesondere die Bezeichnung ›Exposition‹ orientiert sich am entsprechenden Charakter des Formteils mit der Möglichkeit Haupt- und Seitensatz zu unterscheiden und einer auffälligen Gemeinsamkeit mit der ›klassischen‹ Sonatenhauptsatzform: derjenigen der Modulation in die Dominanttonart, die bei Takt 138 durch Quintfall erreicht wird.[79]
Gliederungsebene 1 | Gliederungsebene 2 | Gliederungsebene 3 | Besonderheiten | Takte |
I. Ouvertüre |
| Prélude |
| 1–8 |
|
| Scherzando |
| 9–38 |
|
| Prélude |
| 39–46 |
II. Exposition | Hauptsatz | Ein- und überleitender Teil |
| 47–82 |
|
| Abschnitt I | exponierend | 83–117 |
|
| Abschnitt II | modulierend | 118–137 |
| Seitensatz | Abschnitt I |
| 138–71 |
|
| Abschnitt II |
| 172–223 |
III. Lyrischer Mittelsatz |
| Abschnitt I |
| 224–62 |
|
| Abschnitt II |
| 263–83 |
IV. Scherzo und Erster Walzer |
| Verquickung mit Scherzo | mit Taktwechseln | 284–308 |
|
| Scherzo |
| 309–30 |
|
| Erster Walzer | darin der zentrale ›Einschub‹ (T. 377–86) | 331–429 |
V. Lyrischer Mittelsatz (Fortsetzung) |
| Heterogene Überlagerung | mit Taktwechseln | 430–454 |
|
| Celestateil |
| 455–473 |
|
| Abschnitt III mit Überleitung ins Finale |
| 474–512/14 |
VI. Finale |
| Hauptabschnitt I |
| 515–604 |
|
| Hauptabschnitt II | Stretta und ›violent‹ | 605–676 |
|
| Höhepunkt und Abklingen |
| 677–688 |
VII. Coda |
| Überlagerung |
| 689–701 |
|
| Reprise des Prélude und Schluss |
| 702–709 |
Tabelle 2: kleinformale Gliederung
Harmonik
Debussy komponiert sehr langsame harmonische Tempi, so langsam, dass den meisten Wissenschaftlern bisher entgangen ist, dass eine harmonische Funktionalität überhaupt existiert. So wird in der Literatur gerne von ›Flächen‹ gesprochen, womit sowohl Feldstrukturen als auch »Großregionen«[80] gemeint sein können. Das Wort ›Fläche‹ suggeriert jedoch Statik, Strukturlosigkeit und fehlende Entwicklung. Es scheint fraglich, ob so die kontrastreiche Harmonik Debussy’scher Sätze angemessen beschrieben wird.
Exkurs: Das harmonische System bei Debussy – Modusfamilien und Farben
Jakobik hat sich mit der Frage der tonalen Disposition Debussy’scher Werke beschäftigt und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass Debussy relativ häufig einen klanglichen »Dreitakt« komponiere, womit das Neben- und Gegeneinandersetzen dreier Tonarten auf relativ engem Raum gemeint ist, von denen als »Hauptfarben« zunächst zwei unvermischt aufeinanderprallen.[81] Laut Jakobik beginnt Debussy mit einer »Grund«- oder »Setzungsfarbe«, auf die alsbald eine kontrastierende »Gegenfarbe« folgt.[82] Die dritte Tonart ergäbe sich dann entweder als »Mischfarbe«, als Synthese der beiden Haupttonarten, oder aber ggf. als eigenständige dritte Farbe im Verlauf des Stückes.[83]
Diese zweifellos richtigen Beobachtungen sind um einen entscheidenden Faktor zu ergänzen: Die Tonarten, die hier gegeneinander gesetzt werden, gehören unterschiedlichen Modusfamilien an, soll heißen: Einer Tonart wie z.B. D-Dur wird mit As-Dur (oder as-Moll) nicht einfach eine andere Dur- (oder Moll-)Tonart entgegengesetzt, sondern beide Tonarten müssen sich hinsichtlich ihres Farbwertes deutlich unterscheiden.
Das wäre beispielsweise der Fall, wenn auf die Setzungsfarbe D-Mixolydisch mit ihrem schlichten, diatonischen Charakters als Gegenfarbe As-Dur als erweiterte Diatonik mit ›Zwischendominanten‹ und sonstigen geschärften Klängen folgen würde. ›Modusfamilie‹ wird hier also im Sinne von Tonartcharakter verwendet. Die Modi einer Modusfamilie sind in ihrem Charakter verwandt.
Typisch für Debussy ist die Gegenüberstellung verschiedener Modi als Vertreter verschiedener Modusfamilien: Dies könnte man ›polymodal‹ nennen. Im Folgenden wird zwischen fünf Modusfamilien bei Debussy unterscheiden:
1. Diatonik I
Diatonik I beruht ausschließlich auf Ausschnitten unterschiedlicher Länge einer reinen Quintenreihe. Innerhalb dieser Familie kann wiederum unterschieden werden zwischen einer Heptatonik oder Oktatonik, unter welche die Kirchentöne einschließlich Dur und natürlich Moll fallen (bevorzugter Modus ist hier Dorisch noch vor Ionisch und Phrygisch) und kurzen Quintenreihen, unter denen das Pentaton mit einer Quintenbreite von vier Quinten als Grundlage der Pentatonik einen besonderen Stellenwert besitzt. Hexatone treten vermittelnd zwischen Pentatonik und Hepta- bzw. Oktatonik auf. Die enge Verwandtschaft dieser Modi zeigt sich z.B. bei einigen Klangbildungen, die für Debussy charakteristisch sind. Hierfür zwei Beispiele:
Zu Beginn des 2. Satzes der Images pour orchestre findet sich der Vierklang g-h-d-a. Der Klang scheint als Tonika gesetzt, was durch die Vorzeichnung mit einem # und zwei kleine plagale Kadenzen in den Folgetakten bestätigt wird. Der Klang ist Ausschnitt des Pentatons g-d-a-e-h (ohne e), das hier im Dienste der Auskomponierung der Tonika steht.
Am Ende der Etüde Pour les Sixtes wird der tonikale Des-Dur-Dreiklang um die ajoutierte Sexte b ergänzt. Auch hier handelt es sich um einen Ausschnitt aus einem Pentaton, durch den die Tonika auskomponiert ist (des-as-[es]-b-f). Im Unterschied zum ›Nonenklang‹ aus den Images wird hier die ›vierte‹ und nicht die ›fünfte‹ Quinte (vom Sockelton aus) als Optionston verwendet. Dass es sich hier nicht um einen herkömmlichen Akkord handelt, zeigt sich daran, dass die Töne der Quintenreihe in der Akkordstellung problemlos permutiert werden können: So findet sich am Ende der Etüde Pour les sonorités opposées der Schlussklang cis-e-gis-h. Auch dieser Klang stellt nach herkömmlichem Verständnis eine Dissonanz dar, wird hier aber offensichtlich als schlussfähige Konsonanz verstanden. Die Töne entstammen wieder einem unvollständigen Pentaton, hier: e-h-[fis]-cis-gis. Wieder fehlt die ›dritte‹ Quinte; gleichwohl ist durch die Akkordstellung nunmehr die kleine Septime Optionston.
2. Diatonik II
Hier handelt sich um eine von Chromatismen durchwirkte diatonische Tonalität des Dur/Moll-Systems. Diese Familie ist das Erbe der vorangegangenen zwei Jahrhunderte europäischer Kunstmusik. ›Übrig geblieben‹ sind bei Debussy insbesondere Dominantwirkungen, die in diverse Arten von Trugschlüssen münden. Die Vorliebe für lange Orgelpunkte und aufeinander folgende dominantisierte Klänge (durch Quint- oder Terzfall oder parallele Verschiebungen) indiziert ein zumeist reduziertes harmonische Tempo, in welchem Funktionswechsel nur noch selten passieren.
3. Absolute Chromatik
Von der Chromatik als Erweiterung der Diatonik ist die absolute Chromatik zu unterscheiden, die nicht mehr als Einfärbung verstanden werden kann, weil der diatonische Bezug weggebrochen ist. Diese Chromatik beruht unter Einschluss der Enharmonik zumeist auf einer harmonischen Äquidistanz, durch welche die Oktave gleichmäßig in kleine oder große Terzen geteilt erscheint, was die auf ihr beruhenden Fortschreitungen für Zirkelbildungen prädestiniert. Die Teilung führt zu achttönigen (bei kleinen Terzen) und sechstönigen (bei großen Terzen) Feldern, die in der Musiktheorie bekanntlich unterschiedlich beschrieben werden. Im Folgenden wird auf den Ansatz des ungarischen Dirigenten und Musiktheoretikers Albert Simon in der Darstellung durch Bernhard Haas zurückgegriffen.[84]
4. Akustische Tonalität
Die akustische Tonalität ist strenggenommen keine eigene Modusfamilie, da hier nur eine einzige Tonreihe zur Verfügung steht, die als (genäherter) Ausschnitt aus der Obertonreihe begreifbar ist. Dass sie als Verbindung von Mixolydisch und Lydisch verstanden werden kann, zeigt ihre Nähe zur Modusfamilie Diatonik I. Die akustische Skala von a mit den weiteren Tönen h, cis, dis, e, fis und g lässt sich als ein doppelt-tritonisches Heptaton begreifen:[85] Die reine Quintenreihe d-a-e-h-fis-cis-gis ist an beiden Enden zum Tritonus gestaucht worden (aus d-a ist dis-a, aus cis-gis ist cis-g geworden). Die beiden Tritoni umfassen vier Töne einer Ganztonleiter. Entsprechend findet die akustische Skala häufig als Vermittlungsfarbe zwischen den diatonischen Modusfamilien und dem Ganztonmodus Verwendung.
5. Ganztönigkeit
Ganztönigkeit lässt sich häufig in funktionaler Verwendung hören – nämlich als (zumeist bloß lokale) Dominante, z.B. im Prélude Voiles. Sie kommt bei Debussy allerdings oft auch als Mischfarbe vor. In der ›Theorie der Tonfelder‹ nach Albert Simon findet dies seinen Ausdruck darin, dass Ganztönigkeit nur durch die Überlagerung von primären Feldern erzeugt werden kann.
Die Ouvertüre
Die Ouvertüre wird beherrscht vom Gegensatz zwischen dem langsamen, ganztönigen Prélude und dem Scherzando im 3/8-Takt:
Beispiel 1: Claude Debussy, Jeux, Prélude, Beginn, T. 1–4
Das Prélude hebt mit vier Takten Vorlauf an: Zu einem Orgelpunkt auf h in den hohen Streichern treten zunächst in Harfe und Horn Einzeltöne in Art von Tupfern hinzu. Ab Takt 5 wird der Orgelpunkt durch den Ton a verstärkt. Die Folge der Tupfer verändert sich durch Substitution des letzten Tons von his/c-cis-d zu his/c-cis-f/eis, klanglich verstärkt durch die Celesta. Die Stelle ist außerordentlich raffiniert: Das Horn verschmilzt mit den Harfentönen (z.T. im Flageolett) und wird erst im Ausklang derselben als Echoton deutlicher hörbar (wie es auch in der Partitur steht: ›sons d’écho‹[86]). Darüber erscheint nun jener charakteristische Ganzton-Akkord in Mixtur:
Beispiel 2: Claude Debussy, Jeux, Prélude, T. 5–6
Den Bass der Holzbläsersektion übernimmt die Bassklarinette; die Mittelstimmen spielen die Klarinetten und großen Flöten; die Oberstimme wird von den kleinen Flöten übernommen und den Oboen im Inneren des Satzes verdoppelt. Der Gesamtklang ist außerordentlich ausbalanciert, keine Stimme tritt hervor.[87]
Der Anfang ist statisch und trist, die Überleitung ins Scherzando erfolgt dann recht prompt, wobei der tonale Hauptschritt von h, dem beherrschenden Ton des Prélude, nach a plagal genannt werden kann. Es erklingt ein Motiv, das ich als Scherzando-Motiv bezeichnen möchte. Es umfasst knappe zwei Takte. Das Motiv erscheint zunächst isoliert und wird erst nach einiger Zeit ein weiteres Mal gebracht. Interessanterweise verteilt sich selbst dieses kurze Motiv auf verschiedene Instrumente: Der erste Teil in Takt 9 wird von den Bratschen, der zweite ab der Takteins in Takt 10 von Celli und Fagotten gespielt:
Beispiel 3: Claude Debussy, Jeux, Scherzando-Motiv über tiefen Streichern, T. 9–10
Ein Charakteristikum dieses Motivs ist die Verbindung von Ganzton und Halbton. Die Haupttöne sind zweifelsohne cis und h, die jedoch mit diatonischen und chromatischen Halb- und Ganztonschritten spielerisch verziert werden (der ebenfalls enthaltene große Sekundschritt cis-dis wird noch eine gewisse Bedeutung erlangen). Mit diesem Motiv geht eine Chromatisierung des Ganztonmodus einher, denn c/his ist modusfremd. Nun wird klarer, warum Debussy die reine Ganzton-Wirkung der eröffnenden Takte mit den chromatischen Halbtönen trübt: Sie dienen zur Vorbereitung der Chromatik des Scherzando und liegen bereits im Orchester, bevor die Holzbläser die Ganzton-Akkorde spielen.[88]
Das mehrfache Ansetzen des Scherzando-Motivs, bevor es zu größerer Bewegung aufläuft, generiert dabei einen weiteren unauffälligen, aber interessanten tonalen Wechsel, nämlich den vom anfänglichen Ganztonfeld (noch aus dem Prélude übriggeblieben) zu einem zweiten Feld. Die Hörner bringen dazu das bereits bekannte Motiv einen Halbton tiefer (von c ausgehend). Dem geht Takt 15 eine ›falsche Note‹ in den tiefen Streichern voraus, die mit ais den nächsten modusfremden Ton ins Geschehen werfen. Darüber werden cis und dis nun als simultane Sekunde in aufsteigenden Achteln durch die verschiedenen »Stockwerke«[89] des Orchesters (Bratschen, Violinen, Holzbläser) gejagt.
Der Unterschied eines Halbtons zwischen erster und zweiter Präsentation des Scherzando-Motivs manifestiert sich sogleich in der in kleinen Sekunden parallel abwärts laufenden Begleitung in II. Violine und Bratsche. Gleichzeitig ist diese zweite Variante gegenüber der ersten ›verbeult‹: Der Ganztonschritt cis-dis wurde zum Halbtonschritt c-des verengt. Das ›Thema‹ der Ouvertüre liegt offenbar in einer simultanen und sukzessiven Gegenüberstellung von Halb- und Ganztönen.
Beispiel 4: Claude Debussy, Jeux, Scherzando-Motiv variiert, T. 15–19
Die beiden Varianten des Scherzando-Motivs liegen gewissermaßen im Streit und folgen einander immer dichter: in Takt 23f. erklingt die erste Version (auf Bratschen und Klarinette/Fagott verteilt), in Takt 25 bereits die zweite (abermals im Horn, wobei der zweite Motivteil abgespalten in Oboe und Fagott auftaucht).
Der kaum vernehmbare zwölftönige ›Rutsch‹[90] der Violinen in Takt 18 bereitet die Auffüllung zum Zwölftonfeld vor: Die noch fehlenden Einzeltöne d, e, fis und gis erscheinen ab Takt 24: zunächst e, dann d (T. 26) und schließlich fis (T. 27) – allerdings jeweils auf so schwachen Positionen, dass weniger der Einzelton als vielmehr die allgegenwärtige Halbtönigkeit wahrgenommen wird.
Beispiel 5: Claude Debussy, Jeux, Motivische und harmonische Weiterentwicklung ab T. 27–36
Das fis spielt bald jedoch eine bedeutende enharmonische Doppelrolle, als Septime ges des As7 (T. 31) und als Spitzenton in Takt 35ff. über einem sehr exponierten Akkord, der strukturell und tonlich in scharfem Gegensatz zu dem Ganztonfeld des Prélude steht und zugleich den Ton as einführt, der die zwölf Töne mit Abschluss dieses Kleinformteils komplett macht.
Ursprüngliches und komplementär hinzugetretenes Ganztonfeld sind derart ineinander verschoben, dass der Ganztonmodus nicht mehr wahrnehmbar ist. Zusammen bringen sie eine chromatische Farbe hervor, vertreten durch die Akkordfolge G7-As7-A7-B7 (ab As7 als Sekundakkorde), welche auf das neuerliche h im folgenden Rückgriff auf das Prélude hinsteuert.
Das Scherzando-Motiv treibt während dessen die Dramaturgie des Abschnittes durch Abspaltung und Fortspinnung (u.a. im Englisch Horn) voran. Man erkennt einen typischen Debussy-Kontrapunkt: Dem Hauptmotiv wird eine chromatische Linie im Cello sowie ein ›mehrstöckiger‹ Sekund-Orgelpunkt, später die parallel gerückten Sekundakkorde beigemischt – ähnlich wie im Klavier-Prélude La terrasse des audiences au clair de lune – und abermals bemerkt man die immense Bedeutung der großen Sekunde. Die hemiolische Abspaltung scheint das Geschehen schließlich aufzulösen (T. 35ff.).
Die Überleitung in die Exposition
Nach der kurzen Wiederaufnahme des Prélude, in dem mehrfach oktavierte Streicher eine melodische Auffüllung des charakteristischen Ganzton-Akkords vornehmen, führt ein authentischer Sekundschritt von h nach cis[91] zum Scherzando-Charakter zurück. Es kommt ein Motiv hinzu, das man aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit mit dem ersten Scherzando-Motiv als Scherzando-Motiv 2 bezeichnen könnte. Da es aber im Verlauf des Stückes eine gewisse Vorrangstellung gegenüber dem anderen hat, möchte ich es, darin Eimert folgend[92], als Jeux-Motiv bezeichnen. Die allgegenwärtige große Sekunde prägt auch dieses Motiv, allerdings vorwiegend harmonisch: Es liegt nämlich, mit dis beginnend, genau im Sekundabstand auf dem cis-Orgelpunkt der Bratschen. Aus diesem eintönigen Orgelpunkt wird alsbald durch die Hinzunahme von dis durch Violinen und Horn ein zweitöniger – abermals durch die charakteristische Sekunde geprägt. Selbst in den Nebenstimmen dominiert der Ganzton.
Dieser beginnt sich jetzt jedoch zu ›öffnen‹: Das neue Motiv startet auf dem Ganzton liegend und thematisiert jetzt neben einer diatonischen Skala auch die kleine Terz, die von nun an ihren Platz im Stück erobert – zunächst vor allem in den Hauptstimmen (vgl. auch T. 53), dann auch in den harmonischen Nebenstimmen (T. 57ff.). Interessant ist die enharmonische Verwechslung der Terz c-es in his-dis innerhalb weniger Takte.
Beispiel 6: Claude Debussy, Jeux, Jeux-Motiv, T. 49–64, geraffte Übersicht
Die harmonische Disposition ist zunächst diatonisch, eine vollständige cis-Moll-Tonleiter – zu der sich die chromatischen Erweiterungen im Englisch Horn gesellen. Etwas von akustischer Tonalität (über A) liegt Takt 61ff. in der Luft, wo neben deutlichen A-Dur-Klängen auch das g und das dis (sowie his) hörbar sind. Die Geigenstimme in Takt 63 bringt ›neue Fahrt‹ ins Geschehen: eine hohe tremolierte chromatische Figur, die eine fallende Kleinterz beschreibt und die sich ab Takt 67 selbständig macht und fortgesponnen wird. Schließlich wird das gesamte Geschehen chromatisch abwärts verschoben.
Beispiel 7: Claude Debussy, Jeux, Moduswechsel in T. 67–71
Die Vervollständigung des chromatischen Totals mit zwölftöniger Skala und parallelen Dur-Grundstellungsdreiklängen signalisiert ähnlich wie in Takt 31ff. einen sich ankündigenden Wandel: den abrupten Farb- bzw. Moduswechsel in Takt 70, wo die erweiterte Diatonik dieses zweiten Scherzando zunächst durch einen C-Klang abgelöst wird, der unter Hinzufügung des a als lokale T65 gehört wird. In Takt 73 zeigt sich, dass er Teil der Quintenreihe c-g-d-a-e ist.[93]
Zur harmonischen Gesamtdisposition
Die Darstellung der ›Theorie der Tonfelder‹ nach Albert Simon bei Bernhard Haas schließt eine Schichtung des Tonsatzes mit ein, wie sie insbesondere aus der Schenkeranalytik bekannt ist. Entsprechend ist im Folgenden von vorder- und hintergründigen harmonischen Regionen die Rede.
In den Jeux sind die ›Funktionen‹ die dominierenden Tonfelder. Die Vorzeichnung der drei # bei Beginn und Schluss lässt annehmen, die hintergründige Tonika des Stückes sei A-Dur, der auch Abschnitte in Fis und C angehören. Diverse Abschnitte in Es müssen ebenfalls der Tonika zugeordnet werden. Die von Debussy gewählten Generalvorzeichnungen verraten insgesamt denn auch eine Orientierung an der Tonikaachse. So stehen von 709 Takten 262 in A-Dur (das erste Drittel und noch kleinere Teile im weiteren Verlauf). C-Dur (101 Takte), Fis-Dur (76 Takte) und Es-Dur (58 Takte) bzw. deren Mollparallelen (Molltonarten spielen in den Jeux allerdings eine untergeordnete Rolle) nehmen abermals vergleichbaren Raum ein. Dass aber sowohl Dominant- als auch Subdominant-Ebene nur mit einer einzigen Tonart vertreten sind (was die Vorzeichnung angeht; letztere scheint auch rein quantitativ nur schwach präsent), ist ein Indiz für die Dominanz der Tonikafunktion.[94]
Auf der Dominant-Ebene liegend fällt Des-Dur ins Auge: in Jeux eine recht herausgehobene Tonart (mit 102 Takten), auf der Ebene der Subdominante H-Dur (34 Takte). Ob die Vorzeichnungen immer die herrschende Funktion anzeigen, wird sich im Laufe der Analyse erweisen. Der Seitensatz der Exposition beispielsweise spielt sich insgesamt auf der Dominant-Ebene ab, obwohl die Vorzeichnung – wie es auch im Falle einer klassischen Sonate der Fall wäre – weiterhin die Haupttonart A-Dur indiziert.
Gemäß des Orgelpunktes auf h liegen das Prélude und die analoge Coda auf der Achse der Subdominante. Der Eindruck des Fremden ist freilich auch durch den Ganztonmodus bestimmt, der hier funktional indifferent ist und – wie überhaupt die Ganztonfamilie – sonst im Stück kaum eine Rolle spielt. Das fundierende tonikale a in Takt 9 ist noch ›schwach auf der Brust‹. Das cis in Takt 47 und das bald darauffolgende a sind zwar als D und T anzusprechen, aber selbst an dieser Stelle ist die Tonikafunktion noch schwach entwickelt. Das liegt zum einen an den vielen Chromatismen im Scherzando, zum anderen an der Unmöglichkeit, sich das Ganztonfeld der Takte 1–9 und 43ff. dominantisch ›zurecht zu hören‹. In Ermangelung scharfer Dominanten sind auch keine robusten Toniken zu finden. Dass sich das im Verlauf ändert, hat mit dem plötzlichen Einbruch der Pentatonik Takt 70 zu tun. Mit Blick auf das gesamte Stück komponieren die pentatonischen Felder, obwohl auch sie gänzlich fremd wirkend und mit einer gewissen Rohheit in das Stück eingestreut, die Tonikafunktion aus: Die jeweiligen Grundtöne der Quintenreihen liegen mit a bzw. c und fis (T. 230ff.) auf der Tonikaachse.
Ganztonmodus und Pentatonik, sonst für Debussys Komponieren essentiell, nehmen in Jeux also eine Randstellung ein[95], allerdings eine betonte und herausgehobene. Der weitaus größte Teil dieser Musik steht in Modi der beiden Modusfamilien erweiterte Diatonik und Chromatik.[96]
Es fällt die Vielzahl der Dominantorgelpunkte ins Auge, welche Quintfälle erwarten lassen und dementsprechend beurteilt werden müssen. Das heißt, dass wenn über eine gewisse Strecke beispielsweise ein As-Dur- D7 oder D9/7 gehalten wird, diese Strecke eindeutig in Des (Dur oder ggf. Moll) steht. Der irrigen Ansicht vieler Autoren, eine solche Denkweise mache keinen Sinn, da die funktionale Harmonik bei Debussy in Auflösung begriffen sei[97], wird hier nicht gefolgt: Schon in der romantischen Musik müssen Toniken nicht mehr explizit erscheinen, um das Verständnis einer Tonart zu gewährleisten, da auch D und S zur deren Bestimmung völlig ausreichen. Man könnte gar behaupten, dass gerade bei solchen Stellen die herrschende Tonart ganz besonders klar ersichtlich ist. Eine knappe Gesamtübersicht über die Disposition des Stückes könnte wie folgt aussehen:
Takte | Funktionen |
T. 1–69 | Undeutliche Funktionen: S in T. 1–8 u. T. 39–46 mit Grundton h; D in T. 47–57 mit Grundton cis; ansonsten eine schwache Tonika-Ebene. Die Funktionen sind erst im Entstehen begriffen. |
T. 70–137 | T auf a und c |
T. 138–181 | D mit Grundton e (E-Dur bis T. 167) als lokale Tonika |
T. 182–216/23 | Dominantisierung von E bzw. G, um die Rückführung zur T vorzubereiten |
T. 226–330 | T (Fis, auch C) |
T. 331–356 | D (Des mit Rückmodulation zur T) |
T. 357–514 | T (Es dominiert) |
T. 515–604 | Zunächst D (inklusive eines gut hörbaren Pendels zur S für vierzehn Takte T. 605–676), danach T (dominiert von C und A) |
T. 677–701/09 | Übergeordnet T (verschleiert durch die Wiederaufnahme des Ganztonfeldes aus dem Prélude) |
Tabelle 3: Formteile und Funktionen
Überblick über die Exposition
Wie aus der Analyse des Beginns hervorgeht, bringt Debussy die verschiedenen Modi derart ins Spiel, dass sich ein Wechsel stets ankündigt. Anders als in früheren Stücken vermeidet Debussy zumeist schroffe Übergänge. Die wenigen abrupten Wechsel scheinen ein dramatisches Element zum Klang zu bringen.
Nach der Ganztönigkeit des Prélude, der erweiterten Diatonik in der Überleitung zur Exposition (T. 47–69) und der plötzlich einbrechenden Pentatonik (T. 70) wird in Takt 84 der vierte Modus des Stückes erreicht. Nach der ›sekundären‹ Chromatik, die im Prélude dem Auffüllen zum Zwölftonfeld diente, handelt es sich nun um eine ›primäre‹ Chromatik in Form einer Funktion.
Auch dieser Wechsel ist vorbereitet, Debussy baut die kurz aufklingende C-Pentatonik zum tonikalen Feld (c-g, es-b, fis-cis, a-e) aus: Er eliminiert d und bringt b, fis und cis ins Spiel (T. 74ff.). Es folgt mit Takt 84ff., was man als Hauptmotiv des Hauptsatzes bezeichnen könnte:
Beispiel 8: a) Claude Debussy, Jeux, Hauptsatzmotiv T. 84–87; b) akkordischer Auszug als Siebenklang
Das Motiv ist nicht entwicklungsfähig, sondern eine in sich kreisende Dissonanz, ein ›Twister‹, dessen harmonische Spannung nicht lösbar ist. Der in Beispiel 8b) angezeigte Tonvorrat von sieben Tönen (wobei ais und b orthographisch unterschieden werden) umfasst mit Ausnahme des es sämtliche Töne der Tonika (nicht zugehörig sind das wieder aufgenommene d und das neu hinzutretende h, das das Pentaton c–e zum Hexaton c–h erweitert).
Es bietet sich ein Vergleich dieser Stelle mit dem Beginn des Lyrischen Mittelteils an. Dort liegt ebenfalls ein ›Twister‹ vor, der wie die Steigerung und Konsequenz des ›Hauptmotivs‹ wirkt. In der Literatur wird diese Stelle zumeist als polytonal bezeichnet.[98] C-Dur- und Fis-Dur-Dreiklang gehören jedoch beide der tonikalen Funktion an, was satztechnisch dadurch verdeutlicht wird, dass sie ineinander geschoben sind und keineswegs unabhängig voneinander agieren, wie man es bei echt polytonaler Musik erwarten dürfte: »Deshalb kann man bezweifeln«, schrieb schon Eimert, »ob die Polytonalität der Jeux überhaupt als solche anzusprechen ist.«[99]
Der bislang ausgesparte tonikale Grundton es ersetzt ab Takt 100 fis als Bassorgelpunkt. Damit ist die tonikale Funktion mit Blick auf die Grundtöne vollständig durchmessen worden: a (T. 9–24 und T. 64), c (T. 70ff.), fis (T. 84–98) und nun es (T. 100ff.). Dem stehen Regionen ohne oder mit unklarer Funktion gegenüber.
Die Modulation zum Seitensatz in der Dominanttonart verläuft mittels Quintfall vergleichsweise klassisch. Die erweiterte Diatonik scheint sich wieder gegen die Chromatik durchzusetzen. Jakobik nennt die harmonische Situation in Takt 138ff. »erweiterte Struktur«.[100] Es handelt sich aber um einen E-Maj7. Maj7-Akkorde werden im Jazz gerne tonikal verwendet; auch hier scheint es sich um eine durch die Modulation gefestigte lokale Tonika zu handeln.
Beispiel 9: Claude Debussy, Jeux, Modulation zum Seitensatz, T. 130–135
Der Seitensatz liegt insgesamt auf der Dominant-Ebene. Den komplexen Akkordstrukturen an seinem Ende, deren Tonmaterial mehrheitlich dem dominantischen Feld zugehörig ist, gesellt sich der Störton dis als Bassorgelpunkt hinzu.
Beispiel 10: Claude Debussy, Jeux, Ende des Seitensatzes, T. 174–183
Die vier Takte ab Takt 174 und diejenigen ab Takt 178 sind aus ein und demselben Stoff gemacht: Die parallel verschobenen verminderten Septakkorde in Violen und Celli Takt 178f. umschreiben mit einigen Durchgangsakkorden h-d-f-gis/as (die schweren Werte der Hemiole ›zählen‹). Es handelt sich um die Quinttonreihe der Dominante. Ab Takt 180ff. kommt die Grundtonreihe hinzu: Die Oberstimme phrasiert den weiteren verminderten Septakkord ais-cis-e-g (welcher auf den schwachen Werten der Hemiole [T. 178f.] schon gebracht wurde).
Die Stelle ist nicht leicht in den Gesamtkontext einzuordnen. Der Ton h scheint zweierlei Funktion wahrzunehmen: Im Oberstimmensatz ist er Quintton der lokalen Tonika (globalen Dominante); zusammen mit dem Störton dis bildet er im Bass jedoch eine lokale dominantische (global subdominantische) Schicht, zu der die darüber gelagerte vollständige Dominante in einer eigentümlichen Spannung steht. Mit dem Wegfall des Störtons dis in Takt 182 wird die lokale Tonika zugleich dominantisiert: Debussy scheint E-Dur, die Seitensatztonart, in Richtung der übergeordneten Tonika verlassen zu wollen: Takt 182 bringt einen D97 zu C-Dur. Zunächst aber wird die raffinierte Überlagerung zweier Funktionen ab Takt 186 wiederholt. Die globale Tonika wird als Fis-Dur erst mit dem Lyrischen Mittelteil wiedergewonnen.
Besonderheiten im Lyrischen Mittelteil
Der Lyrische Mittelteil beginnt Takt 224 mit einer zarten Streichermixtur – eine Passage, die auch durch den bislang nicht verwendeten 3/4-Takt herausgehoben wird. Der E-Dur-Dreiklang auf der Takteins scheint die Tonart des Seitensatzes aufgreifen zu wollen.
Beispiel 11: Claude Debussy, Jeux, T. 224–231
Die Mixtur stellt eine erweiterte Diatonik in verschobenen Dreiklängen dar. Sie wird alsbald konterkariert durch einen weiteren ›Twister‹, gebildet aus einer über drei Oktaven gelagerten, kaum noch melodischen ›Hauptlinie‹, einem bordunartigen Orgelpunkt im Bass und einer in zahllose Tremoli zerstobenen Klangmasse dazwischen. Die ›Hauptlinie‹ besteht aus einem gegen den Takt gelagerten dreimaligem cis und einem darauffolgenden raschen Ornament. Die tremolierende Klangmasse liegt in den Holzbläsern, zunächst jedoch nur in den Klarinetten, dann kommen der Reihe nach Flöten, Oboen und Fagotte hinzu. Die Taktgruppe wird wiederholt und anschließend in eine entspannende Fis-Pentatonik überführt.
Der Schritt von E, zu Beginn der Mixtur, nach Fis (T. 226) ist authentisch und könnte als Beginn einer Kadenz nach H-Dur von S nach D aufgefasst werden. Tatsächlich erklingt ein H-Dur-Dreiklang auch in den Tremoli der Holzbläser, er ist allerdings nicht vom Rest der Klangmasse zu unterscheiden. Fis wird ab Takt 230 ›entdominantisiert‹: Trotz einzelner Einflechtungen der lokalen Subdominante (T. 237ff. und T. 255ff.) bestätigt sich die Generalvorzeichnung Fis-Dur. Mit der Pentatonik bringt die Stelle eine wichtige Facette der globalen Tonika zum Vorschein, die auch den Hauptsatzbeginn auszeichnete.
Als Feld kommt die Tonika in einer weiteren, wenn auch weniger ›twisterartigen‹ Stelle noch einmal vor (T. 264ff. und T. 272). Es ist ein schwärmerischer Abschnitt des Lyrischen Mittelteils, inmitten stark gestischer Motive (T. 271 und T. 276) in zurückgenommenem Tempo (›retenu‹), ähnlich orchestriert wie Takt 226 und auch dadurch mit den übrigen in sich kreisenden Tonikastellen aufs engste verknüpft.
Beispiel 12: Claude Debussy, Jeux, T. 271–276
Es handelt sich um ein Pendel zwischen Tonika und Dominante (die Töne im T. 264 bzw. T. 272 gehören wie in T. 84 und T. 226/247 zur Tonika), das die Haupttonart des Lyrischen Mittelteils Fis-Dur bestätigt. Im Tritonus-Abstand hierzu folgt C-Dur, das das Scherzo beherrscht (T. 309–330); die Überleitung (T. 285–308) scheint zwischen den beiden Tonarten hin- und herzupendeln.
Scherzo und Erster Walzer
Beispiel 13: Claude Debussy, Jeux, Einstieg in die Überleitung zum Scherzo, T. 280–289, geraffte Darstellung
In der Überleitung vom Lyrischen Mittelteil zum Scherzo (T. 280ff.) folgt auf die zweite zweier unvollständiger Kadenzen (II-V) ein solitäres cis. In neuem Tempo (›assez animé‹) setzt eine rhythmische Figur ein, die aus der etwas schwülstigen Atmosphäre ausbricht. Nach und nach füllt sich der chromatische Raum, bis die Flöte das chromatische Total ausfüllt und dadurch einen Moduswechsel ankündigt.
Beispiel 14: Claude Debussy, Jeux, Überleitung zum Scherzo, T. 290–301
Schließlich rastet das Geschehen auf der Dominant-Ebene ein (mit Interjektionen in Fis-, A-, H-Dur; die letzte in B-Dur gehört wiederum der Dominante an). Dabei wird cis durch das tritonusentfernte g substituiert, womit C-Dur als Tonika des Scherzos vorbereitet wird.
Beispiel 15: Claude Debussy, Jeux, Scherzo, Beginn, T. 308–318
Das harmonische Gerüst des Scherzos besteht aus einer Mixtur von D7-Quintsextakkorden, die gegen den Orgelpunkt auf g verschoben werden. Somit bleibt das gesamte Scherzo auf der Dominante ›hängen‹.
Bei der nun folgenden tumultartigen Steigerung durch die Erhöhung des harmonischen Tempos fällt die Annäherung an die Ganztönigkeit in den letzten beiden Scherzotakten auf: Den Oberstimmen-Mixturen A-Dur, As-Dur, F-Dur, Fis-Dur werden in den Hörnern ähnliche Strukturen in Des-Dur, D-Dur, H-Dur und B-Dur entgegengesetzt, also genau im Großterz- und Tritonusabstand. Die Gegenläufigkeit der Stimmen und zerklüftete Instrumentierung führt schließlich dazu, dass das gesamte musikalische Geschehen umschlägt: von einem reinen Bläsersatz in ein Streicherfeld (plus Harfen und Bassklarinette, die zuvor geschwiegen hatte), von einem harmonisch extrem unruhigen chromatischen Total im 2/4 in einen diatonisch geprägten, tonal vergleichsweise stabilen Walzer.
Beispiel 16: Claude Debussy, Jeux, Ende des Scherzos, Beginn des Ersten Walzers, T. 325–332
Den Übergang gewährt Debussy, indem er – abermals durch ›Entdominantisierung‹ – den letzten Fis65 in eine Subdominante verwandelt, nämlich in einen Moll-s65 in Des-Dur (dabei die dreifache Leittönigkeit der entgegengesetzten Mixtur gewissermaßen als Kolorit ausnutzend: as+b/ais nach a/heses, d nach des und e nach es). Damit ist derjenige Abschnitt erreicht, der im Gesamtkontext von Jeux die Mitte einnimmt.
Die Mitte von Jeux
Mit Takt 357 wird Des-Dur zugunsten von Es-Dur verlassen, das einen längeren bis Takt 514 reichenden Abschnitt eröffnet, der im Wesentlichen die Tonika-Ebene repräsentiert. Das gilt mit Einschränkung auch für jenen zehntaktigen Einschub (T. 377–386), der auf die ersten, eindeutig in Es-Dur stehenden zwanzig Takte folgt – einen weiteren, besonders komplexen ›Twister‹:
Beispiel 17: Claude Debussy, Jeux, Einschub im Ersten Walzer, T. 377–382
Die komplexen Akkorde der Takte 378 und 382 erweisen sich als tonikale Funktion über einem dominantischen Bordun: Ein Es-Dur-Dreiklang findet sich in den gedämpften Hörnern, die hohen Violinen bringen einen Fis-Dur- und dis-Moll-Dreiklang, eine Mischung aus C-Dur- und c-Moll-Dreiklang mit kleiner Septime findet sich in Klarinetten, Flöten und mittleren Streichern. Die Klänge verschwimmen: Tremolo und Pianissimo lassen die Einzeltöne untergehen. Damit ist das aus Takt 84 und Takt 226 bekannte Kreiseln ohne jegliches melodische Element ›zu Ende gedacht‹. Die Quinten e-h und g-d unterlegen die ›flirrende‹ Tonika dominantisch.
Beispiel 18: Claude Debussy, Jeux, die komplexen Akkorde der Tonika-Ebene in T. 84 a), T. 226 b.) und T. 378–82 c)
Die exakte Transposition des Akkordes aus Takt 378 um eine kleine Terz nach oben in Takt 382 führt zur achttönigen Vollständigkeit der Tonika: Das bislang fehlende a ist nun Spitzenton in den Geigen.
Auf diesen Einschub folgt eine mehrschrittige Kadenz nach Es-Dur (T. 387–429/32), die halbschlüssig endet (vgl. Beispiel 19). Dabei sind wiederum die dissonanten Orgelpunkte auffällig, die zu Funktionsmischungen führen: Zunächst deuten die Takte 403–410 auf einen Schluss in der Tonika; eine klare Dominante (T. 387ff.) und die Tonika (T. 396) waren vorausgegangen. Die Quinte as-es unterlegt das Geschehen jedoch subdominantisch. Analog verhält sich die Taktgruppe Takt 411ff., in der die Dominante mit einem tonikalen Orgelpunkt unterlegt ist. Zu einer weiteren Verzögerung des kadenziellen Abschlusses kommt es, wenn ab Takt 421 erneut die Subdominant-Ebene durch einen Sp7 ins Spiel gebracht wird. Statt des kadenziellen Abschlusses erscheint daraufhin in Takt 429 ein Halbschluss (das hohe b in den Violinen).
Beispiel 19: Claude Debussy, Jeux, Zusammenfassung der großen Kadenz am Ende des Ersten Walzers, T. 396–429, geraffte Darstellung
Wieder folgen eine Verunklarung der Funktion (T. 433–440) und danach das Setzen einer neuen Tonart. Die Vorzeichnung zeigt H-Dur oder gis-Moll an, doch die Stabilität der Quinte dis-ais im Bass spricht für dis-Moll. Die globale Tonika ist also noch nicht verlassen. Die Tonika weicht erst in dem von der Celesta bestimmten Abschnitt der Dominante: zunächst mit Grundton g (ab T. 473), dann nach einem kleinen Schlenker zur Subdominante über h (T. 492ff.) mit Grundton e (T. 500–514). Das anvisierte A-Dur erhält jedoch keinen Entfaltungsraum: Das erwartete A-Dur wird in Takt 515 durch As-Dur substituiert, welches, wie so häufig in diesem Stück, direkt ›dominantisiert‹ wird. Ein Crescendo molto betont den Vorgang ebenso wie der Umschlag vom ›leichten‹ Fauxbourdon-Satz in eine der seltenen Tutti- Stellen.
Beispiel 20: Claude Debussy, Jeux, Überleitung ins Finale, T. 511–516
Das Finale
Das Finale ist der ›flüssigste‹ Teil des Stückes. Das ist sowohl Folge des treibend-tänzerischen Walzerrhythmus’ und der veränderten Motivik als auch der harmonischen Gesamtsituation, die authentische Fundamentschritte präferiert.
Die Takte 515–604 liegen auf der globalen Dominant-Ebene, inklusive eines vierzehn Takte andauernden Pendels zur globalen Subdominante (Des-H-Des, T. 579–592). Eine erste interessante harmonische Situation des Finales ist der Beginn des ›Pas de trois‹ auf der Dominanten von Des-Dur. Alle Stimmen verlaufen relativ unabhängig und bilden einen rhythmischen Kontrapunkt zueinander. Die Hauptstimme findet sich in der Mittellage; der Orgelpunkt im Bass und die Streicherakkorde sowie Holzbläser-Einwürfe bilden demgegenüber ein Ostinato. Die hartnäckige Wiederholung ein und desselben Klanges erinnert an die ›Twister‹ in Takt 84ff., Takt 226ff. und Takt 377ff.: Tatsächlich liegt die Stelle dort, wo gemäß der bisherigen Frequenz ein solcher ›Twister‹ erwartet werden dürfte.[101] Jedoch ist die Wirkung hier stark abgeschwächt und steht im Zeichen einer schwungvollen Vorwärtsbewegung.
Beispiel 21: Claude Debussy, Jeux, Pas de trois, T. 535–542[102]
Der auskomponierte Klang umfasst neben as-d-ges im Ostinato a, b und f in der Hauptstimme (a als Leitton zu b) und lässt sich als Zwischendominante nach es-Moll verstehen; es-Moll erscheint dann auch tatsächlich als II in einer großen II–V–I–Kadenz im Zweiten Walzer (T. 565), welche die globale Dominantebene Des prolongiert. Einen etwas kleinräumigeren Kadenzzusammenhang stellt der Quintfall in Takt 563 als Auflösung des über mehr als dreißig Takte gehaltenen lokalen Dominantorgelpunktes über as her. Mit der sofortigen Dominantisierung des Des-Dur wird der harmonische Zirkel vollendet und das übergeordnete harmonische Ziel, die globale Tonika, wieder aufgenommen.
Beispiel 22: Claude Debussy, Jeux, Makrokadenz im Vorfeld des zweiten Walzers, geraffte Darstellung, T. 535–567
Eine hochfahrend sehnsuchtsvolle Linie in den Violinen (T. 553ff.) verbindet den ›Pas de trois‹ mit dem Zweiten Walzer. Auch hier ist die Hauptstimme in der Mittellage zu finden.
Beispiel 23: Claude Debussy, Jeux, Thema des Zweiten Walzers, T. 565–576
Die Ausweichung nach H-Dur (T. 578–591) ist ein weiteres Mittel, die Kadenz hinauszuzögern. Bei der Auflösung des lokalen dominantischen As-Dur-Klangs (T. 601ff.) wird des zu d alteriert, das als Akkordgrundton eines Moll-Quintsextakkords in A-Dur sofort ›subdominantisiert‹ wird. Damit verschiebt sich das Geschehen von as nach d um einen Tritonus, verbleibt also innerhalb eines Feldes. Die erwartete Fortschreitung ist nun nicht mehr As-Des-Ges/Fis, sondern d-E-A. An die Stelle einer traditionellen dominantischen Struktur (über as) ist eine traditionell subdominantische getreten (über d); beide gehören der globalen Subdominante an.
Die Diatonik in den Takten 611–626 erscheint hier, anders als bisher üblich, nicht in Verbindung mit der Tonika, sondern der Subdominante: Diese wird durch zwei kleinterzversetzte Quintsextakkorde (T. 611ff. auf h und T. 619 und d) in den führenden tiefen Streichern auskomponiert. Beide Akkorde lassen sich jeweils auch als Ausschnitt eines Pentatons begreifen, was Debussy zu einer entsprechenden klanglichen Erweiterung nutzt: Die auffüllenden Akkorde und die Motivik in den hohen Streichern ergänzen das jeweilige Pentaton zunächst zum Hexaton (d-a-[e]-h-fis wird zu d-a-e-h-fis-cis; f-c-[g]-d-a wird zu f-c-g-d-a-e) und schließlich zum Heptaton (gis in T. 613 und h in T. 620; diese beiden Töne sind in Beispiel 24 nicht wiedergegeben).
Beispiel 24: Claude Debussy, Jeux, T. 611–613, T. 619–622, T. 627–28 und T. 635–638
Dass es sich hier um eine Erscheinung des Vordergrundes handelt, zeigt auch der Rest des Finales, der von der Chromatik der Funktionen beherrscht wird (ausgenommen die durch Tritonusverschiebungen Takt 627–648 und Takt 653–676 angedeutete Ganztönigkeit). Die Akkorde der Takte 635ff. sind mehr oder minder chromatisch ausgefüllte verminderte Septakkorde, die zunächst als Grundtöne der Subdominante aufgefasst werden können, dann aber durch den Quintfall in Takt 644 retrospektiv zu Quinttönen der Dominante erklärt werden.
Beispiel 25: Claude Debussy, Jeux, T. 644–648
Dieser Quintfall verweist auf eine Makrokadenz, zunächst mit den Stationen S (T. 605–635/38) – D (T. 636/39–644) – S (T. 645–664). Das fortlaufende Kreisen mündet schließlich in einen durch Ganztönigkeit verunklarten Abschnitt (T. 665–676): Die plagalen Schritte h-dis-g des realen Basses sind nicht Fundamentschritte, sondern ein Mittel, das im Vordergrund vielfach chromatisch ausgefüllte Ganztonfeld zu verdeutlichen. Schon einmal, am Ende des Scherzos (T. 325ff.), näherte sich das Stück der Ganztönigkeit vor Eintritt eines neuen Formabschnittes an. Der Wegfall aller tiefen Instrumente ab Takt 673 verstärkt den Eindruck allgemeiner Auflösung. Die Klimax in den Takten 665–677 scheint vor allem durch die sich steigernde Dynamik und eine bereits ab Takt 611 die Stretta begünstigende Phrasenbildung zu vier, meist sogar zu acht Takten herbeigeführt zu werden (strenggenommen dominiert bereits seit Takt 515 die Viertaktigkeit, unterbrochen nur durch wenige Ausnahmen wie die drei Zweitakter ab Takt 605).
Ausklang des Finales und Coda
Aus der Turbulenz der Takte 665–676 geht schließlich der letzte und massivste Höhepunkt des Stückes in Takt 677 hervor (auf der Bühne findet »der dreifache Kuss« statt). Die Bewegung kulminiert im Fortissimo in der großen Sekunde fis-gis. Beide Töne erscheinen in vier Registern von Fagott bis Piccolo oktaviert – es fehlt das Bassregister – und sollen offenbar stets als Sekunde und niemals als None oder als Septime gehört werden. Harmonisch wird damit zum Anfang des Stücks zurückgefunden: Die Töne fis und gis liegen auf derselben Achse wie a und h, die den Orgelpunkt der ersten Takte bildeten.
Beispiel 26: Claude Debussy, Jeux, Höhepunkt in T. 675–678
Im Zusammenhang mit der in Aussicht gestellten Rückkehr von der Dominant- zur Tonika-Ebene ist diese extrem prononcierte Sekunde eine auf Grundton und Septime reduzierte II. Stufe in Fis-Dur (bzw. fis-Moll).[103] Der vollständige Akkord wird bereits Takt 678 im Moment des Spannungsabfalls[104] nachgereicht (zunächst als halbverminderter Septakkord, dann als kleiner Durseptakkord). Dem in erweiterter Diatonik gehaltenen Abschwung (T. 679–688) folgt ein letzter pentatonischer Ruck.[105] Dabei wird nicht dem seit Takt 684 im Perdendosi liegenden D97 nach fis-Moll stattgegeben, sondern Takt 689 folgt ein T65 in C-Dur, als Teil des Pentatons c-g-d-e-a.
Zugleich findet in der Linie der Flöten das Tonmaterial aus Takt 70 wieder Verwendung, nunmehr allerdings abwärts statt aufwärts. Dann wird die Triller-Fläche um das tonikale a (T. 690–696) durch das Ganztonfeld gis-b-c-d-e (T. 696-700) eliminiert. Dies dient der Vorbereitung der Wiederkehr des Ganztonfeldes aus dem Prélude (T. 702-705): Beide Felder ergänzen sich zur Zwölftönigkeit. Nur ein Ton fehlt: Es ist fis, der tonikale Grundton von zuvor.
Damit werden alle wesentlichen Modi zum Schluss der Komposition auf kleinstem Raum (in nicht einmal dreißig Takten) wie in einem Brennspiegel nochmals präsentiert: die Ganztönigkeit, die durch Funktionen gestiftete Chromatik, und die verschiedenen Formen der Diatonik.
Zum Schluss-Unisono geht es dann chromatisch von dis zum a abwärts. Diese Linie scheint durch das Quintolen-Murmurando in einigen Stimmen der vielfach geteilten Streicher vorbereitet zu sein – allerdings weist Eimert zu Recht darauf hin, dieses Murmurando sei »akustisch als Geräuschspektrum mit Spektralkomponenten in drei Hörbereichen (Oktaven) zu werten«[106] und sei daher nicht tonal in die Umgebung einzupassen. Es fehlt der Leitton gis, der auch im Ganztonfeld nicht enthalten ist: Eine Nebenlinie in Gegenbewegung gelangt vom dis über e nur bis zum f.[107]
Motivik
Rhythmik und Melodik
Motive sind bei Debussy primär oft rhythmische Einheiten, die erst in einem zweiten Schritt melisch gefüllt werden. Das melische Tonmaterial wird aus dem jeweils gültigen Modus gewählt. Melodische Qualität mit Anspruch auf Vorrang gegenüber den anderen musikalischen Parametern gibt es bei Debussy offenbar selten.[108]
Auffällig in den Jeux ist die vorwiegend gestauchte Melodik, die uneingeschränkte Vorherrschaft von Schritten gegenüber Sprüngen und von rhythmischen Einheiten gegenüber melodischen Bögen; die Veränderungsfähigkeit einzelner – zumeist sehr kurzer – Elemente führt zum Eindruck geradezu unbegrenzter Gestaltvariabilität. Gleichwohl gibt es auch in den Jeux einen ›Kondensationskern‹ der Melodik; es handelt sich um die ›Sekund-Terz-Formel‹[109], die bereits in der ersten Motivgruppe erkannt werden kann. Die geringe Spezifik der ›Formel‹ führt allerdings dazu, dass die Prägnanz der aus ihr hervorgehenden melodischen Einheiten eher gering ist. Die ›Formel‹ ist nur subkutan wirksam; die Gestaltung an der Oberfläche ist ganz Rhythmus und Klang.
Rhythmen, die das Metrum betonen, anstatt, wie zumeist bei Debussy, es konterkarieren, mögen darauf hinweisen, dass ein Thema der Jeux der Tanz ist: So ist eine weitgehende Fixierung auf walzerartige, beschwingte, leichte Rhythmen festzustellen. Der 3/8-Takt beherrscht weite Teile des Stückes und drückt der Mehrzahl der Motive unmissverständlich seinen Stempel auf. Dabei werden alle Möglichkeiten zur rhythmischen Unterteilung des Taktes genutzt: groß und klein punktiert, hemiolisch, fließend-gerade.
Beispiel 27: Claude Debussy, Jeux, T. 150–151
Beispiel 28: Claude Debussy, Jeux, T. 373–374[110]
Es ist unerheblich, ob manche der 3/8-Strecken in diesem Stück nach herkömmlichem Verständnis falsch notiert sind. Die »schlagfreien, losen Taktstriche«[111], die Stravinsky an den Jeux bemerkte, dominieren jedenfalls nur manche lyrische Passagen des Mittelteils und insbesondere das Prélude, wo auch kein Tanz stattfindet.
Motivklassen
Eimerts Motivtafel, auf welcher praktisch das komplette melodische Material der Jeux unter- und nebeneinander aufgezählt ist, deutet das Problem der geringen Fasslichkeit der Motive an.[112] Schon die Frage, was überhaupt als Motiv gelten kann, ist schwierig zu beantworten, da auch kleinste Arabesken aus denselben Tongirlanden wie einige der Hauptmotive gemacht sind.[113] Dem entspricht, dass die melodischen Einheiten auch bei mehrmaligem Hören im Ohr nicht haften bleiben[114], was zu einer Konzentration auf die metrisch-rhythmische und harmonische Gestaltung des Stückes führt.
Soll die Kategorie des Motivischen dennoch nicht aufgegeben werden, kann eine Lösung des Problems darin bestehen, zwei oder drei voneinander gut unterscheidbare Motivklassen zu beschreiben. Es sind dies die zwei Motivklassen der ›rhythmisch pointierten Motive‹ und der ›gestischen Motive‹, zu denen sich die nicht immer auffälligen Kontrasubjekte als Nebenklasse gesellen. Interessanterweise drängen sich sich Motive gerade dieser dritten Klasse im Laufe des Stückes mehr und mehr in den Vordergrund und entwickeln sich zu Melodien, die thematische Gestalt annehmen. Gemeint sind die beiden Themen ›Pas de trois‹[115] und das Thema des Zweiten Walzers. Dem Zug hin zu längeren melodischen Einheiten entspricht auch die Hinwendung des Finales zu einer einzigen durchkomponierten Steigerung.[116]
Zur Klasse der ›rhythmisch pointierten Motive‹ gehören das Scherzando- und das Jeux-Motiv. Sie variieren stark und ›fressen‹ sich über den Verlauf des Stückes hinweg in dessen Textur ein. Eimert formuliert das so:
Das Haupt- und Rondothema […] ist das unscheinbarste der Jeux-Ornamente, aber nun wird klar, dass es auf andere Weise Hauptthema ist: als der bergende Grund, der die Einheit umso tiefer und zwingender herstellt, je weniger er als thematisches Machtgebot wirkt.[117]
Die Verteilung der Scherzando-Motiv(e) über die verschiedenen »Stockwerke des Orchesters«[118] und auf voneinander entfernte Takte zeigt, dass dieses Element willentlich ›zerpflückt‹ wird – natürlich aus guten musikalischen Gründen. Beispiel 29 zeigt den Versuch, die nicht nur klanglich, sondern auch zeitlich getrennten Elemente zusammenzuführen.[119]
Beispiel 29: Claude Debussy, Jeux, versuchsweise Zusammenführung der Scherzando- und Jeux-Motiv(e), T. 9–10, T. 29–30, T. 49–50, T. 57–58, T. 122–123 , T. 130 und T. 134
Das Scherzando–Motiv erklingt erstmals in Takt 9 – jedoch nur teilweise; ›komplett‹ erscheint es erst Takt 27ff. Das Jeux-Motiv wartet nach Ersterwähnung in Takt 47 sogar ganze siebzig Takte auf die ›Vervollständigung‹, die erst mit Takt 118ff. in der Oboe gebracht wird.
Es folgt nun die Klasse der ›gestischen Motive‹ (vgl. Beispiel 30). Offensichtlich sind auch rhythmische und melodische Gestalt der gestischen Motive variabel. Wesentlich von der Klasse der ›rhythmisch pointierten Motive‹ verschieden sind sie durch die Dominanz des Forte, das meist reduzierte Tempo (bzw. vergrößerte Notenwerte, wo das Tempo Scherzando beibehalten wird, z.B. T. 106) und die führende Rolle der Streichinstrumente, insbesondere der Violinen. Variabel hingegen ist der harmonische Zusammenhang: Chromatik im Seufzer (T. 106ff.) steht gegen Diatonik in der Passionnément-Stelle (T. 276); in Takt 230 (Rubato) schimmert hingegen Pentatonik durch.
Beispiel 30: Claude Debussy, Jeux, Klasse der ›gestischen Motive‹, T. 106–109, T. 202–203, T. 230–231, T. 237–238, T. 276–278, T. 436–437, T. 445–446, T. 503–506 und T. 551–552
Motivarbeit in den Walzerteilen
Der Erste Walzer moduliert um Takt 355 herum nach Es-Dur. In der neuen Tonart erscheint neues motivisches Material, und zwar gleich von Beginn an als Kontrapunkt. Es gibt das »Es-Dur-Thema«, wie es Eimert nennt[120], das in vorliegender Arbeit Joyeux-Motiv genannt werden soll[121], und ein Kontrasubjekt, dessen Bedeutung im weiteren Verlauf des Ersten Walzers zunehmen wird: Die kontrapunktische Arbeit führt aus den kleinräumigen Motiven der ersten Hälfte des Stückes hinaus zu den größeren Linien des Finales.
Die beiden Subjekte (Joyeux und dessen Kontrapunkt) treffen nach dem Einschub innerhalb des Ersten Walzers abermals in Takt 396 aufeinander: das Joyeux-Motiv in den Hörnern, durch die Angabe ›en dehors‹ (herausgehoben) als das wichtigere Subjekt gekennzeichnet; und das Kontrasubjekt zunächst in den Trompeten, dann den Klarinetten. Lässt man einige ornamentale Streicherfiguren weg, ergibt sich dort folgendes Bild:
Beispiel 31: Claude Debussy, Jeux, Joyeux-Motiv und Kontrasubjekt, T. 396–400
Das Kontrasubjekt taucht zum ersten mal bereits in Takt 341 auf, also noch im Des-Dur-Teil des Ersten Walzers. Es schält sich aus einem kurzen Solo der Klarinette heraus, wird aber noch nicht als eigene Gestalt wahrgenommen. Es führt auch direkt nach dem zentralen Einschub (T. 387ff.), dort in Umkehrung, ein Eigenleben. Das Kontrasubjekt kommt offensichtlich aus dem ›Hintergrunde‹ des Stückes. Seine Qualität ändert sich, wenn es Takt 421 in den Vordergrund drängt, indem es ohne ›Hauptsubjekt‹, quasi als thematische Gestalt auftritt. Man könnte sagen, es setzt sich gegen das Joyeux-Motiv (und die anderen Motiveinheiten des Ersten Walzers) durch.
In Takt 403 gesellt sich das Thema des Ersten Walzers hinzu. Maurer Zenck nennt es das »Sequenzthema«[122], weil es steigernd sequenziert wird (je einmal auf a, c und g beginnend) Dieses »eingeschobene Sequenzthema« sei materialiter aus dem »insistierenden Zwischenspiel« gewonnen (gemeint ist der Einschub T. 377ff.): dort es-d-es (T. 385), hier a-gis-a (T. 403).[123] Diese Auffassung scheint zwar mehr vom Notenbild als vom Gehör geleitet, da die Folge es-d-es am Ende des Einschubs in außerordentlich großen Notenwerten erscheint. Die Materialähnlichkeit zwischen den einzelnen Motiven ist aber in den Jeux so groß, dass man auch an dieser Verwandtschaft nicht zu zweifeln braucht: Nur soll sie offensichtlich nicht gehört werden.
Beispiel 32: Claude Debussy, Jeux, wesentliche Motive der Walzerteile, T. 396–397, T. 403–404, T. 407–408, T. 411–412 und T. 535–537
Versuchsweise sind in Beispiel 32 die wesentlichen Stationen der ›Entwicklung‹ beider Walzer zusammengefasst, dabei aber anders als im Stück angeordnet (die Taktzahlen beziehen sich auf die Einsätze der Oberstimme). Die Sequenz auf a, c und g des ersten Walzerthemas ist hier angedeutet. Das Joyeux-Motiv wurde in zwei Hälften geteilt, um deutlich zu machen, dass das Thema ›Pas de trois‹ (T. 535, Unterstimme ab Taktmitte) daran anschließen könnte. Das Beispiel soll die diastematische ›Reihe‹ veranschaulichen, auf der alle Motive beruhen: Die zweite Hälfte des Joyeux-Motivs ist ersichtlich aus demselben Holz geschnitzt wie die Punktierungen bei Takt 403 und Takt 535. Ob man besser von der Ähnlichkeit der vielen oder der Wandelbarkeit der wenigen Motive spricht, ist eine Frage der bevorzugten Perspektive.
Das Finale baut in gewisser Hinsicht auf den bisherigen Elementen auf[124]; so werden die Gedanken des Ersten Walzers im Zweiten Walzer fortgesetzt. Das motivische Material der Exposition findet jedoch ebenfalls Verwendung, ebenso wie der punktierte Gedanke des »Sequenzthemas« in den Punktierungen des ›Pas de trois‹ wieder auftaucht.
Dennoch handelt es sich nicht um ein Aufsummieren bisheriger Elemente, denn sowohl ›Pas de trois‹ als auch das Thema des Zweiten Walzers werden durchaus als neue thematische Gedanken wahrgenommen. Von ihnen ist das recht symmetrische ›Pas de trois‹-Thema am Beginn des Finales im Kontext von Jeux ziemlich ungewöhnlich. Es ist dies die einzige Melodiebildung in den Jeux, die überwiegend aus Sprüngen besteht. Einzelne Terzen und, – ganz selten, – Quarten waren bisher die maximale Distanz zwischen zwei ›Melodietönen‹.
Beispiel 33: Claude Debussy, Jeux, Thema ›Pas de trois‹, T. 535–542
Beispiel 34: Claude Debussy, Jeux, Thema des Zweiten Walzers, T. 566–584
Das Thema des Zweiten Walzers lässt sich gut an das Thema ›Pas de trois‹ anschließen, da das abschließende b des einen direkt ins c des anderen übergehen kann. Beide Themen sind in bester Tenorlage komponiert.
Das Thema des Zweiten Walzers ist aus dem Jeux-Motiv gemacht: Der Rhythmus der ersten Figur wurde verändert, die aufsteigende Linie gedehnt und fortgesponnen. Diese Herkunft scheint einen doppelten Zweck zu erfüllen: Zum einen erfolgt die ›Vollendung‹ des bruchstückhaften Kurzmotivs zu einer ausgewachsenen melodischen Linie, zum andern wird der Höhepunkt in Takt 677 angekündigt, der rhythmisch der Walzerthema-Variante entspricht. Man sieht an diesem Beispiel sehr schön, wie in den Jeux weit entfernte Teile aufeinander Bezug nehmen und integriert werden.
Beispiel 35: Claude Debussy, Jeux, T. 603–607
Beim Eintritt des tonikalen A-Dur in Takt 603ff. liegen drei Ebenen dicht beieinander, die motivisch von großem Interesse sind. Es sind dies: in der Mittelstimme das Thema des Zweiten Walzers, das hier direkt ins Jeux-Motiv überleitet, und anschließend das variierte ›gestische Motiv‹ aus Takt 230f. (hier ›sans presser‹ zu spielen und als lokaler Höhepunkt zu verstehen, auf dem abgebrochen wird). Auf engstem Raum werden hier die zwei Motivklassen der ›rhythmisch pointierten Motive‹ und der ›gestischen Motive‹ mit dem Walzer kombiniert.
Zur Orchestrierung der Jeux
›Rhythmischer‹ und ›klanglich-farblicher‹ Kontrapunkt
Unter ›rhythmischem‹ Kontrapunkt kann das ›Durcheinander‹ von Bewegungsfiguren verstanden werden: die Gleichzeitigkeit von asynchronen Quintolen, Triolen, punktierten Achteln und Sechzehnteln und anderen Figuren. An solchen Stellen bewegt sich keine Stimme in Achteln (der metrisch angezeigten Einheit).
Beispiel 36: Claude Debussy, Jeux, T. 128–130
Von einem ›klanglich-farblichen‹ Kontrapunkt kann gesprochen werden, wenn innerhalb akkordischer Felder Stimmverläufe auf verschiedene Instrumentengruppen verteilt werden (etwa in T. 397ff. auf Violinen und Violen; vgl. Beispiel 19). Die Einzelstimmen solcher Passagen machen für sich genommen keinen Sinn, ergeben aber zusammen ein polyphon wirkendes ›akustisches Fachwerk‹. Es scheint hier um größtmögliche Diversifizierung von Stimmen in Register, Farbe und Raum zu gehen, um ein klanglich dichtes, manchmal oszillierendes, manchmal wolkenhaftes Netz entstehen zu lassen. Die Orchestrierung sei »selber Polyphonie«, kommentierte Barraqué.[125] Eine entferntere Verwandtschaft mit (oder Vorgängerschaft für) Ligétis Mikropolyphonie schiene diskutabel.
Behandlung des Orchesterapparates
Raffinement in der Orchesterbehandlung war in den Jahren um 1900 bis 1914 en vogue, ebenso die Bevorzugung immer größerer Apparate. Man vergleiche die großen Symphonischen Dichtungen Liszts, dann Rimski-Korsakows und Richard Strauss’, die Entwicklung des Wagner-Orchesters, Mahlers Symphonien, Ravels Daphnis et Chloé und die Frühwerke Stravinskys[126], und man wird eine immer weiter führende Vergrößerung des Orchesterapparates des 19. Jahrhunderts feststellen. Damit verbunden ist die Instrumentation als eigenständige Kunst, als Fertigkeit, die neuen verfügbaren Instrumentalklänge immer wieder überraschend und ungewohnt in Szene zu setzen und die vielen Farben des modernen Orchesters leuchten zu lassen.
Man könnte meinen, Debussy habe in La Mer diesem Zeitgeist gehuldigt. Allerdings ist die Besetzung vergleichsweise klassisch und die real ›klingende Masse‹ erscheint vergleichsweise zurückgenommen, weil Debussy nicht alle Mittel des zur Verfügung stehenden Orchesters ausschöpft. »Wir haben die Aufblähung des Orchesters erduldet, die malträtierten Formen, den großen Aufwand und die schreienden Farben […]«, sagt er später einmal mit Blick auf die enorme Erweiterung des Orchesterapparates (und -klanges) bei Wagner.[127]
In Jeux wird die Abkehr vom Zeitgeist noch deutlicher. Debussy »verfährt wählerisch«[128] mit dem großen Orchesterapparat, er verwendet ihn weniger wegen der möglichen Klangmasse, sondern mehr »wegen der unzähligen Kombinations- und Differenzierungsmöglichkeiten«.[129] Und so gibt es im ganzen Stück nicht eine einzige Tutti-Stelle, bei der alle verfügbaren Instrumente zugleich spielen würden. Zwar hat man im Finale spätestens ab ›violent‹ (T. 645ff.) durchaus den Eindruck eines vollständigen Orchesterapparates, aber die Steigerung wird nicht bis zum äußersten getrieben: Ein Tutti-Einsatz in allen Registern bleibt aus.
Der Höhepunkt in Takt 677 schließlich – die ›lauteste Stelle‹ – verzichtet auf die Bassinstrumente; die Celli spielen hohe Lagen, der tiefste klingende Ton ist ein fis’ – von Fagott, Trompete, Horn und Violen in bequemster Altlage gespielt. Posaunen und Kontrabässe schweigen, die entscheidende große Sekunde erklingt aber in allen beteiligten Instrumenten.[130]
Debussys orchestrales Klangideal involviert
violins commonly in eight, ten or even twelve parts, generous use of harps, woodwind unmixed and seldom used to reinforce other parts, brass veiled and often muted, with very restrained use of trumpets and trombones.[131]
Damit wird Einspruch gegen die Bemerkung Eimerts vom »metallisch hellen Blech«[132] in den Jeux erhoben. Dessen zurückhaltende Verwendung betrifft jedoch nur Posaunen, Tuba und die Trompeten, die immerhin da und dort Akzente setzen, Linien nachzeichnen oder Akkorde zum Glänzen bringen. Die Hörner hingegen sind generell bei Debussy und ganz besonders in den Jeux fast durchweg in Aktion: Hier pausieren sie nur an drei Stellen länger als zehn Takte (insgesamt für 193 Takte); sie haben also mehr als zwei Drittel des Stückes zu tun. Die ausgiebige Verwendung des Hornklanges – gedämpft und ungedämpft, ein- und mehrstimmig – ist ein Grund dafür, dass die Jeux trotz ihrer dezenten Instrumentierung nur an den seltensten Stellen kammermusikalisch klingen.[133] Die enorme Mischfähigkeit des Horns garantiert einen abgerundeten Klang[134]: Die Hörner unterstreichen melodische Einwürfe (z.B. T. 30ff. und T. 264–274), haben lange Liegetöne (z.B. T. 208ff. und T. 455–472), eigene Themen (T. 396ff.), werden dabei oft unterstützt durch andere Instrumente der Mittellage wie das Cello (z.B. T. 565–577) oder das Fagott (z.B. T. 534–549), sie mischen Akkorde ins Orchester (z.B. T. 106ff., T. 411ff. und T. 578ff.) und tupfen ›dumpfe‹ Farben ins Geschehen (z.B. T. 1–9).
Die Streicher schweigen niemals für mehr als sechs Takte[135]: Die Stelle Takt 325ff. ist ihre längste Pause, sieht man vom Ausdünnen vor der Generalpause gegen Ende des Stückes (vor T. 700) ab. Setzen die Streicher einmal aus, so bevorzugt, um einen neuerlichen Einsatz vorzubereiten (so T. 83, T. 223 und T. 325–30) – sozusagen als ›Atemumschlag‹, der die nicht vorhandenen Auftakte ersetzt.[136] Dennoch fällt den Streichern selten die klassische Aufgabe der Führung des Orchesters zu. Diese wird zumeist von den (oft solistisch konzipierten) Holzbläsern, vor allem Oboen, Englisch Horn und Klarinetten, wahrgenommen. Die Streicher sind oft vor allem für Klangfassaden und harmonisch-rhythmische Flächen zuständig.
Was die Dynamik anbelangt, so dominieren in den Jeux überdeutlich Piano und Pianissimo (die Dynamikstufe Pianopianissimo existiert in Jeux nicht): Laut Eimert sind es 79% der 709 Takte.[137] Nuancierungen durch diskrete Spielanweisungen wie ›un peu en dehors‹, ›pas en dehors‹, ›doux‹, ›expressif‹ und ›marqué‹ lassen auch die Dynamik zu einem ausgeklügelten Parameter des Stückes werden. Dies macht sich besonders bemerkbar »in den Lautstärkeveränderungen des Klanggewichts durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Klanggruppen«.[138]
Das Spielerische in den Jeux hängt auch mit dieser feinen Klangstaffelung zusammen, wenn Debussy beispielsweise Klarinetten, Fagotte oder Flöten nur für kurze Einsätze hinter- und übereinander spielen lässt, die Streicher immer unterschiedlich schichtet, Harfentöne beimischt und stets neue Möglichkeiten der Kombination vor allem von Blasinstrumenten findet. Dabei gehen Färbung und dynamische Abstufung Hand in Hand, denn mit der Hinzu- oder Wegnahme einzelner Instrumente oder Instrumentengruppen lässt sich eine wohldosierte dynamische Staffelung erzielen, ohne dass in der Partitur eine explizite dynamische Vorzeichnung angezeigt werden müsste.
Das Aufteilen des Streicherapparates in meist neun statt fünf Parts (und jene dann oft noch mehrfach unterteilt) ermöglicht eine subtile Registrierung von Akkorden und ein fein austariertes Frage-Antwort-Spiel innerhalb der Streicher. Fortlaufend differenzierte Spielanweisungen kommen hinzu: ›pizzicato‹ gegen ›arco‹, Triller und Tremoli gegen regulär ausgeführte Achtel, dynamische Unterschiede innerhalb der Streichergruppen, gedämpfte neben nicht gedämpften Klängen, quasi Soli einzelner Pulte, Glissandi, Flageolets, ›de la pointe‹- und Griffbrett-Spiel, geräuschhafte Passagen mit ›col legno‹, ›sur le chevalet‹ (= ›sul ponticello‹) oder ›murmurando‹. Zusammen ergibt sich so ein Tonbild, das dem satten, dicken Streicherklang des romantischen Orchesters kaum noch entspricht.[139] Es scheint der filigrane Sound fast aller Instrumentengruppen dem Ringen um Nuancen zu entstammen, dem Willen zu Differenziertheit und dem Streben nach Klarheit bei gleichzeitig gesteigerter Sinnlichkeit des Klangerlebens.[140]
Bedeutung der Klangfarbe
Es ist bekannt, dass Debussy zu den Komponisten gehört, denen ein sinnliches Klangbild besonders am Herzen lag. Ein relativ schlichtes, aber trotzdem eindrucksvolles Beispiel findet sich zu Beginn des Finales. Auf die raffinierte Orchestrierung der Melodielinie – ein Horn, eine Bassklarinette und Fagotte unisono als echte Mischfarbe, die nach einem ganz eigenständigen Instrument klingt, und die sich ständig abwechselnden Solohörner – haben Eimert[141] und Maurer Zenck[142] bereits hingewiesen.
Streicher-Klangeffekte wie ›col legno‹ und das ebenfalls zu jener Zeit besonders in Kompositionen von Berg[143] und Webern[144] populäre ›sul ponticello‹ – kommen selten vor, und wenn, dann subtil. Zudem verzichtet Debussy auf eine Herausstellung der Schlaginstrumente, wie sie in demselben Jahr von Stravinsky im Sacre vorgenommen wurde. Flageolets in den Streichern und der Harfe (dort auch der Effekt: ›près de la table‹) sind hingegen ebenso häufig wie der Gebrauch von Dämpfern in Streichern und Blech.
In den Klavier-Particells existieren nur wenige handschriftliche Vermerke zur Orchestrierung, was dafür sprechen dürfte, dass entgegen früherer Deutungen Debussy – hierin ganz der klassisch-romantischen Tradition folgend – zuerst weitestgehend den ›Satz‹ hergestellt habe.[145] Die Deutungsversuche von Autoren wie Boulez (Klangfarbe als Primärparameter[146]) und Maurer Zenck (er »komponierte zuerst die Farbe, dann den Satz«[147]) sind damit hinfällig. Die Klavierfassung vom September 1912 war eben kein Klavierauszug, sondern eine erste Komposition: eine Arbeitsfassung für Nijinsky. Man kann daher, wie auch weiter oben schon angedeutet, mit einiger Sicherheit von zwei voneinander getrennten Arbeitsphasen sprechen.
Es wurde eingangs bestritten, dass Debussy das Libretto genau vertont habe. Durchaus plausibel aber ist die These, Debussy habe die Orchestrierung am Szenario ausgerichtet. Sollte die These stimmen, dass der genaue Plot erst mit Vorhandensein des ›Klavierauszuges‹ ab September 1912 entstand, als nämlich Nijinsky sich in das Stück einarbeiten konnte, dann ist es gut möglich, dass der Komponist die Orchesterfassung (Frühling 1913) erst auf das fertige Libretto geschrieben hat. Einige Beispiele[148] sprechen dafür, dass Debussy an bestimmten Stellen tatsächlich die Handlung instrumentiert hat. Leitmotivische Zuordnungen von Instrumentengruppen zu Personen scheint dieses Stück nicht zu haben, wohl aber ausgeprägte Kleinabschnitte, in denen eine Korrespondenz zwischen Klang und Bild durch den Komponisten in Szene gesetzt werden konnte.
IV. Zusammenfassung
Begibt man sich nun auf die Suche nach dem, was den musikalischen Zusammenhang in den Jeux gewährt, so sticht als allgegenwärtiger Baustein des Stückes die große Sekunde ins Auge: Sie ist harmonisch und melodisch das Hauptintervall des ganzen Stückes. Der Ganzton ist sowohl in den Fundamentschritten des Beginns (h-a-h-cis) als auch in der gesamten Motivik der Ouvertüre präsent, er dominiert die Mehrzahl der Motive – teilweise auch, indem das Motiv ›von der II startet‹ (z.B. T. 47ff.). Anhand der Vielzahl der Sekundakkorde (z.B. der gis7-Akkord T. 290), der herausragenden Bedeutung der II. Stufe(n) in nahezu allen Abschnitten, und schließlich des Höhepunkts in T. 677ff. zeigt sich die Bedeutung des vertikalen wie horizontalen Ganztons für das gesamte Stück.[149]
Entscheidend sind auch die regelmäßig wiederkehrenden Twister-Stellen auf der Tonika-Ebene. Diese insgesamt vielleicht hervorragendsten Stellen ›reinigen‹ die Tonika nach und nach von allem melodischen und rhythmischen Beiwerk, so dass – genau in der Mitte des Stückes – die Tonika mit ihren acht Tönen als bloßes Feld übrig bleibt. Eher vordergründiger Natur scheinen hingegen die vielen langen Orgelpunktbildungen.
Jeux lässt sich im Sinne der »neuen Tonalität« (Bernhard Haas) verstehen: Feldstrukturen, vorzugsweise gebildet durch ›Funktionen‹, weniger durch ›Quintenreihen‹[150], beherrschen das Stück. Dabei nimmt im Verlauf der Jeux die Mischung unterschiedlicher Felder zu. In der zweiten Hälfte des Finales (T. 605–676) scheint ihre Separierung endgültig aufgegeben. Einen Kontrast hierzu bildet die Coda, in der alle verwendeten Tonvorräte noch einmal für sich erwähnt werden, so, als wolle Debussy sein Ausgangsmaterial Revue passieren lassen.
Im Unterschied zu früheren Kompositionen, bei denen man von einem ›polymodalen Ansatz‹ sprechen könnte, zeugt Jeux von einer Hinwendung zu einem homogeneren Komponieren, das unterschiedliche harmonische Ordnungen synchronisiert. Dieser Wandel ist etwa im zweiten Band der Préludes für Klavier noch wenig spürbar, setzt sich aber in Debussys Kompositionen nach 1913 durch.
Anmerkungen
Boulez 1956, 5; das Stück sei außerdem immer zu seinem Nachteil mit Stravinskys Sacre verglichen worden, vgl. hierzu auch Eimert 1959, 7. | |
Vgl. Boulez 1956, 5. | |
»Jeux ist zeitgenössisch mit Pierrot lunaire und Sacre de printemps, aber jetzt, da wir sowohl die Schrift des Schocks als auch die innere Chromatik geistig erfasst haben, erscheint das Licht noch geheimnisvoller, welches von den Jeux ausstrahlt.« (Boulez 1955, 73) | |
Vgl. Barraqué 1964, 153. | |
Ebd., 8. | |
Boulez 1956, 5. | |
Vgl. Stockhausen 1954, 78ff. | |
Vallas 1949, 133. | |
Vgl. Strobel 1940, 241. | |
Rutz 1954, 148. | |
Jakobik 1977. | |
Ebd., 127ff. | |
Vgl. Eimert 1959, 16. | |
Vgl. Pasler 1982, 75. | |
Vgl. Maurer Zenck 1976, 39. | |
Z.B. für Eimert als Komponist Neuer Musik. Maurer Zencks Kritik trifft hier offensichtlich zu (vgl. Maurer Zenck, ebd.). | |
Pommer 1971. | |
Zitat Maurer Zenck 1976, 28. | |
Ebd. | |
Vgl. Barraqué 1964, 142. | |
Vgl. hierzu Lesure/Howard 2001, 112f. | |
Vgl. Vignal 1987, 218. | |
Vgl. George 1993, 717f. | |
Vgl. ebd.; Egan 1993, 380 und Dorris 1993, 1022. | |
Vgl. Egan 1993, 380. | |
Vgl. ebd., 382. | |
Vgl. George 1993, 717f. | |
Vgl. Sauguet 1964, 54. | |
Danckert 1950, 75. | |
Vgl. George 1993, 719 und Pasler 1982, 61. | |
Nijinsky, zitiert nach Eimert 1959, 9. | |
Vgl. George 1993, 719. | |
Vgl. Fischer-Dieskau 1993, 413f. | |
Vgl. Pommer 1971, 3. | |
Vgl. George 1993, 719. | |
Strobel 1940, 241. | |
Dass aber auch in dieser Abkehr vom traditionellen Ballettstil der alte Perfektionismus nicht aufgegeben werden sollte, zeigt zumindest die Tatsache, dass Nijinsky seine eigene Choreographie 103 Mal geprobt hatte (vgl. Fischer-Dieskau 1993, 418). | |
Vgl. Dorris 1993, 1021ff. | |
Vgl. George 1993, 719 und Fischer-Dieskau 1993, 419. | |
Zit. nach Eimert 1959, 9. | |
Vgl. Fischer-Dieskau 1993, 413; Stravinsky soll ihn sogar als »ebenso unselbständig wie unmusikalisch« bezeichnet haben (vgl. ebd.). | |
Barraqué 1964, 139f. | |
Zit. nach Rutz 1954, 140. | |
So eine Auskunft von Jean Cocteau aus dem Jahre 1926, zit. nach Barraqué 1964, 160; vgl. auch Rutz 1954, 218. | |
Vgl. u.a. Danckert 1950, 161. | |
Verschiedene Autoren berichten, Debussy habe aus Geldmangel zugesagt – das dürfte ziemlich wahrscheinlich sein, hatte er doch zeit seines Lebens mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen (vgl. Maurer Zenck 1976, 28). | |
»[…es] lässt sich, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, kaum ein Werk finden, das nicht in irgendeinem Sinne eine zentrale Stelle seines Gefühlslebens und Kunstdaseins berührte.« (Rutz 1954, 233) | |
Man beachte die kurze Zeit, die den Musikern verblieb, das Stück angesichts seiner Komplexität zu proben – ein Problem, das nur die drei Tänzer, denen ja die von Diaghilev bestellte Klavierfassung schon lange vorlag, nicht hatten. | |
Vgl. Dorris 1993, 1023. | |
Fischer-Dieskau 1993, 416. | |
Vgl. George 1993, 719. | |
Maurer Zenck 1976, 28. | |
Paris, Ballets Suédois 1920; dann erst New York 1950; seitdem etwas häufiger. | |
Vgl. George 1993, 717f. | |
Vgl. z.B. Vallas 1949, 133. | |
Debussy 1974, 243. | |
Auch räumte Debussy ein, vor der Komposition der Jeux von Ballett (und dessen speziellen Anforderungen an ein Musikstück) nichts verstanden zu haben (vgl. ebd., 242). | |
Barraqué 1964, 144. | |
In dessen Symphonie in d-Moll (1890) sind jedoch weniger Holzbläser vorschrieben. | |
Eimert 1959, 7. | |
Jakobik 1977, 134. | |
Auch Eimert (1959, 10f.), Maurer Zenck (1976, 35ff.) und Pasler (1982, 64ff.) betonen das Moment ›Übersetzung der Handlung in Musik‹. In dieser Arbeit orientiert sich die Zuordnung von Themen, Motivbruchstücken oder Melodien zu Handlungsteilen, soweit sinnvoll erscheinend, vor allem an Eimert. | |
So auch bei Pasler: »Debussy intended a constant pulse.« (1982, 71) | |
[…] es ist die rhythmische Organisation, welche Jeux seine formale Kohärenz verleiht; die Wiederaufnahme von Motiven und Klangfarben unterstützen diese Form anstatt sie zu erzeugen […]. So wird aus dem Rhythmus der Motive der Rhythmus der Form.« (Ebd., 61) | |
Von 709 Takten 600 Takte. | |
Insgesamt 16 Takte. | |
Insgesamt 46 Takte. | |
Insgesamt 41 Takte. | |
Sechzehntel im Prélude und Achtel im Hauptteil sollen ungefähr gleich schnell sein, nämlich etwa 216 M.M. (vgl. Pasler 1982, 71). | |
Eimert 1959, 19. | |
Pasler: »[…] drei metrische Regionen grenzen die drei Individuen sorgfältig voneinander ab, während zwei Typen von Klangfarben den jungen Mann und die Mädchen unterscheiden.« (1982, 64) | |
Vgl. ebd., 72f. | |
Zur Symmetrie der Jeux vgl. ebd., 72f. Im Gegensatz dazu: »discontinuité des séquences cloisonnées, l’asymétrie totale de la forme« (Vignal 1987, 221). | |
Vgl. auch Maurer Zenck: »Deutlich als Kontrast gesetzt sind die langsamen Episoden und die Unterbrechung eines Tanzes durch einen anderen.« (1976, 36) | |
Strobel diskutiert die Jeux als Rondo (1940, 241). Hierbei müssen allerdings so viele Abstriche gemacht werden, dass der Bezug irreführend ist (vgl. Eimert 1959, 9). | |
Damit soll nicht suggeriert werden, hier liege letztlich eine solche (verschleierte) Sonatenhauptsatzform vor, sondern es sei lediglich angedeutet, dass Formtypen des 18. und 19. Jahrhuderts bei Debussy noch lebendig genug waren, um ›hintergründig‹ wirken zu können. Zugleich widerspreche ich damit der Deutung von Maurer Zenck, die mit Blick auf das Ganze zwar eine Dreiteiligkeit annimmt, doch infolge ihrer These von der ›Steigerungsform‹ – auch hinsichtlich eines jeden einzelnen der drei Abschnitte –, bei der sich die »die motivischen Gebilde zunehmend […] stabilisieren« (1976, 37), die größte Instabilität und geringste Kraft beim ersten Formteil verortet, während in den darauffolgenden, vor allem im dritten, sich das »Material fester konturiert« und daher an Zugkraft gewänne (ebd., 37ff.). | |
»Dem Geschehen liegt immer ein Orientierungsplan zugrunde […]. Die harmonischen Großflächen werden durch nuancierte harmonische Mosaiktechnik im Kleinen besetzt.« (Porten 1974, 49) | |
Jakobik 1977, 11ff. und 16. | |
Ebd. | |
Ebd. | |
Haas 2004. | |
Vgl. Rohringer 2010. | |
Vgl. hierzu Maurer Zenck 1976, 41. | |
Es lässt sich »das Bemühen um größte Ausgewogenheit deutlich erkennen« (ebd., 40). | |
Vgl. auch Pasler 1982, 63. | |
Jakobik 1977, 129; vgl. hierzu auch Barraqué 1964, 144f. | |
Deswegen ist er in Beispiel 4 auch nicht dargestellt. | |
Man sieht, dass auch bei Fundamentschritten die große Sekunde eine Hauptrolle spielt. | |
Vgl. Eimert 1959, 8 und 16. | |
Die Regieanweisung an dieser Stelle lautet »ein Tennisball fällt auf die Bühne«. Dieses Ereignis ist nicht nur durch den Moduswechsel, sondern auch dynamisch (ff) und melodisch-rhythmisch durch die scharfe Synkope und den melischen Stillstand markiert. | |
Keine Tonart annonciert ist für den zentralen Einschub der Takte 377–386 und den steigernden Teil des Finales (T. 619–676) – mit 68 Takten ein gutes Zehntel. | |
Vgl. auch Eimert 1959, 5. | |
Kirchentonale Modi kommen gar nicht vor – das profane Sujet der Jeux legt die entsprechenden semantischen Konnotationen nicht nahe. | |
Vgl. Storb 1971, 121; vgl. Porten 1974, 113f.; vgl. Berlemann o.J., 4f.; vgl. Gerhardt 1985, 23 und vgl. Jakobik 1977, 29. | |
Jakobik 1977, 140ff. | |
Eimert 1959, 21. | |
Jakobik 1977, 139ff. | |
Es scheinen die herausgehobenen Stellen in Jeux je ca. 140 bis 150 Takte auseinander zu liegen: die ›isolierten‹ Funktionen Takt 84ff., Takt 226–247, Takt 378ff., das ausladende Thema Pas de trois (T. 535ff.), sowie der Höhepunkt Takt 677ff.: Jede dieser wesentlichen Stellen liegt an herausgehobener Position eines anderen Teils des Stückes (II, III, IV, VI). | |
Auf einige Füllstimmen wurde verzichtet: triolische Einwürfe in jedem zweiten Takt durch die hohen Holzbläser und gegeneinander stehende Sechzehntel und punktierte Sechzehntel in den beiden Harfen. | |
Man erkennt spätestens hieran die enorme Bedeutung der II-V-I-Kadenzen in Jeux – ganz im Gegenteil zu dem, was teils in der Literatur behauptet wird (vgl. etwa Porten 1974, 87f.). | |
»[…] Vorliebe Debussys für langsamen Aufstieg oder Aufbau und schnellen Abstieg« (ebd., 76). | |
Hierbei handelt es sich um eine Analogie zum ersten Erscheinen des Tennisballs. | |
Eimert 1959, 21. | |
Es stellt sich die Frage, warum Debussy das Stück nicht symmetrisch schließt, indem er auf den Abgang zum a verzichtet und es mit dem Ganztonfeld ausklingen lässt. Es dürfte nahe liegen, den Ganztonmodus als Symbol der Leere vor und nach dem Tanz zu verstehen. Der leere Park ist auch das letzte, was der Zuschauer sieht, da die drei Tänzer zuvor von der Bühne geflohen sind. So scheint in diesem Schluss eine gewisse Ironie zu liegen; Debussy erlaubt sich einen Kommentar zur Handlung. Bekanntlich war er von Diaghilev gebeten worden, das Ende des Stückes etwas länger zu machen. Es existieren zwei verschiedene Versionen vom Ende in der Arbeitsfassung: In der einen wird nach dem Höhepunkt in Takt 677 schnell abgebrochen, und das Stück klingt im 3/4-Takt des Höhepunktes aus, ohne dass der Tennisball oder die Leere des Parks noch einmal thematisiert worden wären. In der anderen, wohl später entstandenen, folgen auf die Wiederaufnahme des Prélude noch wenigstens zwei Takte in A-Dur mit einem sff-Endakkord. | |
Vgl. auch Porten 1974, 65. | |
Vgl. Jakobik 1977, 18ff. | |
Wiederaufnahme des Hauptsatzmotivs aus Takt 84ff. in den Flöten. | |
Vgl. Stravinsky 1961, 197. | |
Vgl. Eimert 1959, 15. | |
Eimert nennt dies »organische Ungenauigkeit« (ebd., 14). | |
Die Melodien Debussys haben einen »seltsamen Widerstand gegen die Apperzeption« (Porten 1974, 32). | |
Der Name stammt von Eimert (1959, 13). | |
Vgl. Maurer Zenck 1976, 37. | |
Eimert 1959, 16. | |
Jakobik 1977, 129; vgl. ferner Barraqué 1964, 144f. | |
Vg. bereits Pasler 1982, 70. | |
Eimert 1959, 13. | |
Die ganze Stelle soll ›joyeux‹ (freudig) gespielt werden. | |
Maurer Zenck 1976, 37. | |
Ebd. | |
Vgl. Pasler 1982, 72ff. | |
Barraqué 1964, 153. | |
Vgl. Mikorey 1982, 53f. »[N]ur Brahms und Bruckner widerstanden« diesem Trend (ebd.). | |
Vgl. Debussy 1974, 266; vgl. ferner Nietzsche gut dreißig Jahre zuvor: »Unsere Ohren sind […] immer intellektualer geworden. Daher ertragen wir jetzt viel größere Tonstärke, viel mehr ›Lärm‹« (1988 I, 411). | |
Maurer Zenck 1976, 42. | |
Ebd. | |
Die Posaunen sind nicht nur an diesem Höhepunkt unbeteiligt, sondern insgesamt in den Jeux nur bescheiden vertreten. Diese Instrumentengruppe (inklusive Tuba) schweigt zunächst 412 Takte lang, um anschließend von verbleibenden knapp 300 Takten 60 mitzuspielen. | |
Lesure/Howard 2001, 111. | |
Eimert 1959, 6. | |
Vor Beginn des Celestateils, etwa Takt 433–454. | |
Vgl. Berlioz/Strauss 1904, 275. | |
Es sind insgesamt 42 Takte komplett ohne Streicher. | |
Vgl. hierzu auch Eimert 1959, 8. | |
Vgl. ebd., 18. | |
Ebd., 17. | |
Z.B. Takt 247ff., Takt 397ff. und Takt 403ff. | |
Vgl. hierzu Maurer Zenck 1976, 40. | |
Vgl. Eimert 1959, 13. | |
Vgl. Maurer Zenck 1976, 43f. | |
Vgl. Streichquartett op. 3 (1910). | |
Vgl. Sechs Bagatellen für Streichquartett op. 9 (1911). | |
Vgl. Chimènes 1997, 9 und 12. Einige Stücke aus den Jahren zuvor wurden sogar von anderen Musikern orchestriert (Gigues und Saint-Sébastien in seiner heutigen Form von André Caplet, Khamma von Charles Koechlin)! | |
Zit. nach Chimènes 1997, 12. | |
Maurer Zenck 1976, 45. | |
Maurer Zenck gibt Beispiele für eine handlungsvertonende Instrumentation (ebd., 42ff.). | |
Das Problem der Motivik ist ihre Ähnlichkeit, verführerisch genug, um aus der nahezu unbegrenzten Variabilität der winzigen Motiveinheiten etwas »Serielles« abzuleiten – oder wenigstens ›Protoserielles‹, wie es Stockhausen, Barraqué u.a. getan haben. | |
›Konstrukte‹ wurden nicht beobachtet, es sei denn komplementär ergänzt zu Ganztonskalen. |
Literatur
Barraqué, Jean (1964), Debussy, Reinbek: Rowohlt.
Berlemann, Walter (o.J.), Debussy – letzter Vertreter der Romantik oder entscheidender Wegbereiter für die Neue Musik?, Staatsarbeit Neesen/Rhld.
Berlioz, Hector / Richard Strauss (1904), Instrumentationslehre, Leipzig: Peters.
Boulez, Pierre (1999), »Claude Debussy et Anton Webern«, in: Musik-Konzepte, Darmstadt-Dokumente I, hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: edition text + kritik, 72–79.
––– (1956), »Debussy: Jeux (poème de danse)«, in: Gravesaner Blätter 2/3, 4–5.
Chimènes, Myriam (1997), »The definition of timbre in the process of composition of Jeux«, in: Debussy Studies, hg. von Richard Langham Smith, Cambridge: Cambridge University Press, 1–25.
Danckert, Werner (1950), Claude Debussy, Berlin: de Gruyter.
Debussy, Claude (1974), Monsieur Croche, Stuttgart: Reclam.
Dorris, George (1993), Art. »Nijinsky«, in: International Dictionary of Ballet, hg. von Martha Bremser, Detroit u.a.: St James Press, 1021–1023.
Egan, Carol (1993), Art. »Diaghilew«, in: International Dictionary of Ballet, hg. von Martha Bremser, Detroit u.a.: St James Press, 380–383.
Eimert, Herbert (1959), »Debussys ›Jeux‹«, in: Die Reihe V, Wien: Universal Edition, 5–22.
Fischer-Dieskau, Dietrich (1993), Fern die Klage des Fauns. Claude Debussy und seine Welt, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
George, Rosaline (1993), Art. »Jeux«, in: International Dictionary of Ballet, hg. von Martha Bremser, Detroit u.a.: St James Press, 716–719.
Gerhardt, Martin (1985), Debussy als Klavierkomponist und Ästhetiker, Staatsarbeit, o.O.
Haas, Bernhard: Die neue Tonalität von Schubert bis Webern, Wilhelmshaven: Noetzel 2004.
Jakobik, Albert (1977), Claude Debussy oder Die lautlose Revolution in der Musik, Würzburg: Triltsch.
Lesure, Francois / Roy Howard (2001), Art. »Debussy, Claude«, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, hg. von Sadie, Stanley, Vol. VII, Oxford, London, New York: Macmillan, 96–119.
Maurer Zenck, Claudia (1976), »Form- und Farbenspiele: Debussys ›Jeux‹«, AfMW 33, 28–47.
Mikorey, Stefan (1982), Klangfarbe und Komposition, München: Minerva.
Nietzsche, Friedrich (1988), Menschliches Allzumenschliches, Bde. I und II, Berlin: de Gruyter.
Pasler, Jann (1982), »Debussy, Jeux, Playing with time and form«, 19th Century Music 6, 60–75.
Pommer, Max (1971), Vorwort zur Partitur von ›Jeux‹, Leipzig: Peters.
Porten, Maria (1974), Zum Problem der ›Form‹ bei Debussy, München: Katzbichler.
Rohringer, Stefan (2010), Art. »Diatonik-Chromatik-Enharmonik«, in: Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft. Musikästhetik-Musiktheorie-Musikpsychologie-Musiksoziologie (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 6), hg. von Helga de la Motte Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter und Christian Utz, Laaber: Laaber, 82–86.
Rutz, Hans (1954), Claude Debussy, Dokumente seines Lebens und Schaffens, München: Beck.
Sauguet, Henri (1964), »Claude Debussy – musicien français«, in: Revue musicale – Livre d’or Claude Debussy, 41–56.
Stockhausen, Karlheinz (1963), »Von Webern zu Debussy. Bemerkungen zur statistischen Form«, in: Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik I, Köln: DuMont/Schauberg, 75–85.
Storb, Ilse (1971), Untersuchungen zur Auflösung der funktionalen Harmonik in den Klavierwerken von Claude Debussy, Diss. Köln.
Strawinsky, Igor (1961), Gespräche mit Robert Craft, Zürich: Atlantis.
Strobel, Heinrich (1940), Claude Debussy, Zürich: Atlantis.
Vallas, Léon (1949), Achille Claude Debussy, Potsdam: Akademische Verlags-Gesellschaft Athenaion.
Vignal, Marc (Hg.) (1987), Dictionnaire de la Musique / sous la dir. de Marc Vignal, Paris: Larousse.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.