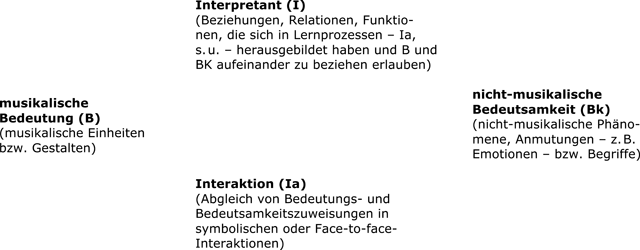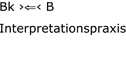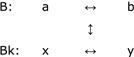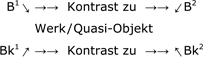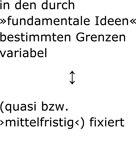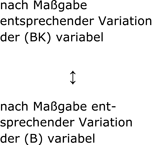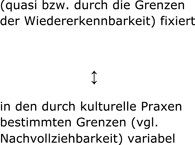Musikbezogenes Unterscheiden
Überlegungen zu einer interaktionalen Theorie musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit
Stefan Orgass
Der Beitrag versucht auf systemtheoretischer bzw. unterscheidungstheoretischer Grundlage die Frage zu beantworten, welche Parameter bei der Erstellung einer musikbezogenen Bedeutungstheorie welchen Zusammenhang ausbilden müssen. Auf die Bestimmung des Gegenstandes der Theorie folgen zeichentheoretisch orientierte Überlegungen im Anschluss an Charles S. Peirce, die dessen triadischen Zeichenbegriff um die Dimension der musikbezogenen Interaktion erweitern. Es wird begründet, warum die in den Dimensionen ›musikalische Bedeutung‹, ›nicht-musikalische Bedeutsamkeit‹, ›Interpretant‹ und ›Interaktion‹ zweiwertig Unterscheidungen getroffen werden. Den Kern der Erörterungen bildet eine Typologie der Zuweisung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit, die zwischen deren ›Quasi-Identität‹, ›Ähnlichkeit von Verhältnissen‹ und ›Trennung‹ unterscheidet und diesen Fällen drei – bereits bei Thomas von Aquin respektive Kardinal Thomas de Vio Caietan genannte – Arten der Analogiebildung zuordnet: ›Attributionsanalogie‹, ›Proportionalitätsanalogie‹ und ›Analogie der Ungleichheit‹. Dabei wird zwischen ganzen Musikstücken und ›Stellen‹ als ›Objekten‹ der Zuweisung von ›Bedeutung‹ und ›Bedeutsamkeit‹ unterschieden. Abschließend wird der Geltungsbereich der Theorie diskutiert.
I. Sinn und Musik/Nicht-Musik
Die Kategorie ›Sinn‹ fungiert in vorliegender Untersuchung als Kriterium für diverse Unterscheidungen. Im Bereich des schlechthin durch den Menschen (als Gattungswesen) Hörbaren kann zunächst zwischen von Individuen als ›sinnvoll‹ Gehörtem und solchem Hörbaren unterschieden werden, für das das Attribut ›sinnvoll‹ nicht gilt. Im Bereich des als sinnvoll Gehörten kann die Folgeunterscheidung zwischen Musik und Nicht-Musik ergehen. ›Musik‹ wiederum zeichnet sich nicht nur durch bestimmte Medien aus (Töne, Klänge, Geräusche und/oder Stille und Zeit), die vom Autor bzw. von den Autoren in geeigneten Materialitäten der Kommunikation (z.B. Notentext, Graphik, elektronischer Datenträger etc.) mehr oder weniger festgelegt werden (wobei das Maß der Festlegung historisch und je nach musikästhetischer Wertehierarchie variiert), sondern auch dadurch, dass die Abfolge und/oder Gleichzeitigkeit von Tönen, Klängen, Geräuschen und/oder Stille als ›sinnvoll‹, d.h. als Zusammenhang aufgefasst wird, was das Unterscheiden und In-Beziehung-Setzen distinkter Klangereignisse voraussetzt.
Wenn im Folgenden von der Unterscheidung zwischen Musik und Nicht-Musik die Rede ist, ist immer dieser weite, und damit nicht auf sogenannte Kunstmusik eingeschränkte Begriff von ›Musik‹ gemeint. Für alle diese Unterscheidungen gilt, dass die Deutung des Wahrnehmenden unabhängig von einer möglichen Intention des bzw. der möglichen Produzenten des Hörbaren erfolgen kann. Auch bei Musik muss nicht vorausgesetzt werden, dass das Gedeutete überhaupt von einem anderen Individuum oder anderen Individuen intendiert war.
Da ›Sinn‹ – systemtheoretisch betrachtet – als Selektionsform psychischer und sozialer Systeme seinerseits auf der Unterscheidung von ›Aktualität‹ und ›Potentialität‹ beruht, ist die damit verbundene ›Sinngrenze‹ jederzeit verschiebbar, weil kontingent.[1] Bestimmte Sinnselektionen erlauben es einerseits, bereits existierende Musik zu deuten und zu bewerten, andererseits – in welchen ›Brechungen‹ auch immer – neue Musik hervorzubringen. Sinngrenze und Sinnselektion sind Themen der Musikästhetik.[2]
II. Individualität des Bewusstseins – Individualität der Kommunikation
In vorliegender Untersuchung wird der Begriff des Individuums mit Blick auf psychische Systeme im Sinne einer Unteilbarkeit der reflexiven Lern- und Erfahrungsgeschichte verwendet[3], wobei es genügt, Unteilbarkeit nicht als Unvergleichlichkeit (denn wer sollte aufgrund welcher Beobachtung zu solchen Schlüssen kommen?), sondern als Unbeobachtbarkeit durch andere Bewusstseine, die sich selbst gerade durch solche Vergleiche bestimmten, zu verstehen (was selbstverständlich auch für das beobachtete Individuum gilt).[4] Diese Vergleiche können dann Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und mehr oder weniger deutliche Unterschiede der Lern- und Erfahrungsinhalte der beteiligten Individuen in individueller Kombination bzw. Ausprägung beobachtbar werden lassen. Im Sinne Luhmanns kann also psychischen und sozialen Systemen Individualität zugesprochen werden.
Psychische wie soziale Systeme stehen, wie Peter Fuchs es ausdrückt, im Verhältnis »konditionierter Koproduktion«.[5] Fuchs begreift die System/Umwelt-Differenz, die zwischen sozialen und psychischen Systemen verläuft, als »eine Differenz von Differenzen derselben Art (eben: System/Umwelt), die einer absonderlichen Verschleifung« unterliegt.[6] Kommunikation und Bewusstsein werden »direkte Gegenspieler«, sie sind »füreinander unmittelbare (relevante) Umwelt«.[7] Diese theoriestrategische Entscheidung zeitigt gewöhnungsbedürftige Konsequenzen – sowohl für das Konstrukt ›Individualität‹ als auch für das musikalische Denken, d.h. für das Prozessieren der sich in der Zeit entfaltenden Beziehungen zwischen Tönen, Klängen, Geräuschen und/oder Stille. Zum Eigenen der Individualität führt Fuchs aus: Jeder Versuch, die Singularität von Bewusstseinen zu bezeichnen, vollziehe sich zeichenhaft und insofern in einem Medium der Allgemeinheit.[8] Und mit Blick auf den Zeichengebrauch, der (wie zu zeigen sein wird) das musikalische Denken ermöglicht, erläutert Fuchs, das Bewusstsein könne Zeichen ›gebrauchen‹ ohne Zeichen als Zeichen beobachten zu müssen:
Die Zeichen funktionieren in der Katenation auch ohne Referenz auf ihre fundamentale Unterscheidung. In Wittgensteinscher Manier: Die Zeichen sind ihr Gebrauch. Die Bedeutung käme ins Spiel, wenn die Erklärung des Zeichens notwendig wird. Die Bedeutung wäre erst das erklärte Zeichen. Die Erklärung benötigt weitere Zeichen, die gegebenenfalls erklärt werden müssen durch wieder weitere Zeichen, unter anderem mit dem Zeichen für ›Zeichen‹.[9]
Fuchs’ Zeichenbegriff ist nicht auf sprachliche Zeichen eingeengt. Auf das musikalische Denken angewandt, folgt aus dieser Position, dass Bewusstseine die sich in der Zeit entfaltenden Beziehungen zwischen Tönen, Klängen, Geräuschen und/oder Stille nicht-reflexiv prozessieren können und dabei auf einen eingeschliffenen Zeichengebrauch rekurrieren (denn sonst ließen sich diese Beziehungen überhaupt nicht in actu mitvollziehen). Aber sobald sie diesen irreflexiven und zeichenbezogenen Mitvollzug post hoc beobachten, unterscheiden und bezeichnen sie die in der Kommunikation bewährten Zeichen, d.h. sie rekurrieren auf Soziales und können diese Dimension durch erinnernde Beobachtung der Interaktionen, in denen die Zeichen gebildet wurden, thematisch werden lassen. Das musikalische Denken wäre also in actu kommunikativ unzugänglich. Da die Erklärung des Zeichens nur reflexiv erfolgen kann und kein anderer Kandidat als diese Erklärung für einen Begriff musikalischer Bedeutung in Aussicht steht, lässt sich auch sagen, musikalische Bedeutung sei die Erklärung des musikalischen Denkens.
III. Musikbezogener Sinn: musikalische Bedeutung und nicht-musikalische Bedeutsamkeit
Die obige Verwendung des Begriffs ›Zusammenhang‹ ist nicht auf die Beobachtung von Musik beschränkt, wodurch Verwendungen dieses Begriffs in nicht-musikalischen Kontexten notwendig von dessen musikbezogener Verwendung zu unterscheiden sind. So erscheinen beispielsweise Benennungen, die auf die syntaktischen Verhältnisse einer Musik angewandt werden (Formungsprinzipien wie Wiederholung, Abwandlung und Kontrast), auch in den Bereichen der (hörbaren oder nicht hörbaren) Nicht-Musik. Das Prinzip des Bestimmens von Einheiten, das die Unterscheidung von sinnvoll Gehörtem von solchem Hörbaren ermöglicht, für das das Attribut ›sinnvoll‹ nicht gilt, wird also auf jeder ›Seite‹ dieser Unterscheidung – auf der der ›Musik‹ und auf der der ›Nicht-Musik‹ – angewendet.
Terminologisch soll im Folgenden mit Blick auf den als sinnvoll aufgefassten und unter Verwendung von (nicht notwendiger Weise sprachlichen) Zeichen reflektierten, sich in der Zeit entfaltenden Zusammenhang von Tönen, Klängen, Geräuschen und/oder Stille von ›musikalischer Bedeutung‹ die Rede sein. Dagegen wird mit Blick auf Zusammenhänge (Beziehungen, Relationen, Funktionen) in Bereichen der Nicht-Musik, die als mit musikalischen Zusammenhängen korrespondierend aufgefasst werden können und unter Verwendung von (nicht notwendiger Weise sprachlichen) Zeichen bewusst gemacht wurden, von ›nicht-musikalischer Bedeutsamkeit‹ gesprochen.[10]
IV. Verhältnis von Musik und Sprache
Sebastian Jentschke und Stefan Koelsch unterscheiden drei kortikale Stufen in der Entwicklung der Musikwahrnehmung: »Merkmalsextraktion (feature extraction)«[11], die sich auf die Repräsentation bestimmter Merkmale des auditorischen Signals (z.B. Höhe, Chroma, Klangfarbe, Intensität und Rauhigkeit eines Tons) bezieht; »Gestalt formation, analysis of intervals«[12], womit die Analyse melodischer und rhythmischer Intervalle und das Zusammensetzen der auf der ersten Stufe extrahierten Merkmale zu auditorischen Gestalten (melodische und rhythmische Abschnitt) gemeint ist; schließlich »structure building«[13], mit der die Verarbeitung struktureller Merkmale musikalischer Phrasen bezeichnet wird (z.B. harmonischer Beziehungen, das Erkennen einer Akkordfunktion, die an einer bestimmten Stelle einer Akkordsequenz unangemessen ist, aber an einer anderen Stelle angemessen sein kann).[14]
Für die zu entwickelnde Theorie ist entscheidend, dass die von Jentschke und Koelsch genannten drei kortikalen Stufen der Musikwahrnehmung unter dem Aspekt des Unterscheidens (und einer entsprechenden Theoriebildung) als miteinander zusammenhängend betrachtet werden können. So ließe sich z.B. nicht erst mit Blick auf die zweite Stufe der »Gestalt formation«, sondern bereits bezogen auf die erste Stufe der »Merkmalsextraktion (feature extraction)« die Forschungsfrage generieren, welche impliziten Unterscheidungen mit einer solchen Extraktion verbunden sind.
Es gibt mindestens zwei Zusammenhänge, in denen sich unabhängig von empirischen neurophysiologischen Untersuchungen, nämlich in teilnehmenden Beobachtungen, zeigt, dass musikalisches Denken in nicht-sprachlichen Unterscheidungen prozessiert wird. Die Referenzen dieses Denkens – Zeitgestaltung, Töne, Klänge, Geräusche und/oder Stille, auf die es sich bezieht, – können in Interaktionen auch ohne die Verwendung einer bereits für diese Phänomene reservierten Sprache relevant werden:
In deiktischen Sprechakten kann durch Neologismen oder durch (andere) onomatopoetische Ausdrücke auf musikalische Phänomene hingewiesen werden, für die das musikbezogene Sprechen (bislang) keine Termini vorgesehen hat. Dabei können zum Zwecke größerer Fasslichkeit Begriffe mit Unterscheidungen im zu Hörenden in Verbindung gebracht werden, die womöglich zunächst nur implizit bleiben (also ›fungieren‹), indem sie auf ihre Gegenbegriffe bezogen werden.[15]
Im Rahmen von Face-to-face-Interaktionen, in denen nicht nur nicht dieselbe Sprache, auch keine lingua franca, von den Beteiligten gesprochen werden kann, sondern deren Interaktanten ihr musikalisches Denken sowie ihre musikbezogene Begrifflichkeit in divergenten musikalischen Praxen und den sich in ihnen realisierenden Lern- und Erfahrungsgeschichten ausgebildet haben, kann durch abduktiv strukturierte Kognitionen der Beteiligten und den von ihnen angeleiteten Handlungen ein Verständigungsprozess angestoßen werden. Dieser realisiert sich in vielfältigen tentativ eingesetzten musikalischen Handlungen, mit denen ein Interaktant der vermuteten Erwartung des anderen Interaktanten entsprechen will.[16]
V. Bezeichnung, Unterscheidung und Beobachtung unter den Gesichtspunkten Vollzug und Reflexion
Luhmann begreift Beobachten als »Unterscheiden und Bezeichnen«:
Mit dem Begriff Beobachten wird darauf aufmerksam gemacht, dass das ›Unterscheiden und Bezeichnen‹ eine einzige Operation ist; denn man kann nichts bezeichnen, was man nicht, indem man dies tut, unterscheidet, so wie auch das Unterscheiden seinen Sinn nur darin erfüllt, dass es zur Bezeichnung der einen oder der anderen Seite dient (aber eben nicht: beider Seiten). […] Wenn man […] mit in Betracht zieht, dass Beobachten immer ein Operieren ist, das durch ein autopoietisches System durchgeführt werden muss, und wenn man den Begriff dieses Systems in dieser Funktion als Beobachter bezeichnet, führt das zu der Aussage: Der Beobachter ist das ausgeschlossene Dritte seines Beobachtens. Er kann sich selbst beim Beobachten nicht sehen.[17]
Luhmann lehnt sich mit seinem Gebrauch des Wortes ›bezeichnen‹ an George Spencer-Browns Theorie der Form der Unterscheidung an, in der »indication« jede Form von Bezeichnung eines »marked state« meint, also beispielsweise auch die Bezeichnung einer musikalischen ›Gestalt‹, d.h. eines musikalischen Phänomens als Einheit, ohne dass dies eine Einengung auf das sprachliche Bezeichnen impliziert.[18] Alle Bezeichnungen, so lässt sich Luhmann kommentieren, gehen mit einer Unterscheidung einher, die nicht mehr beobachtet werden muss, weil sich die Markierung bewährt hat – im Sinne eines viablen nicht-sprachlichen oder sprachlichen Umgangs mit dem jeweiligen Ausschnitt von Welt qua Bewusstsein und/oder in der sprachlichen Verständigung mit anderen, in der Kommunikation also. Die Beobachtung, in der Unterscheiden und Bezeichnen (letzteres im erläuterten nicht-sprachlichen und/oder sprachlichen Sinne) verbunden sind, kann somit auf den viablen Gebrauch der Bezeichnung ›zusammenschrumpfen‹.[19] Erst aufgrund der Non-Viabilität einer Bezeichnung – beispielsweise infolge einer gestörten Hörerwartung und/oder ausbleibenden Verständigung – wird die Rekonstruktion der Unterscheidung, die die Bezeichnung fundiert, notwendig. Gleichwohl kann auch unabhängig von solcher Notwendigkeit eine Rekonstruktion mit dem Ziel (Selbst-)Reflexion als ›erkenntnisträchtig‹ erscheinen, womit ein zentrales Motiv sowohl kultur- bzw. musikwissenschaftlicher als auch musiktheoretischer Tätigkeit benannt sein dürfte.
In einer Theorie des musikbezogenen Unterscheidens ist dementsprechend zwischen dem Erlernen dieses Unterscheidens durch eine die – Unterscheidungen explizit machende – Bezeichnung konstitutiver Bestimmungsgrößen einer musikalischen Einheit einerseits und dem Wiedererkennen einer musikalische Einheit aufgrund dieser Bestimmungsgrößen andererseits zu differenzieren, bei dem die im Rahmen des Bezeichnens getroffenen Unterscheidungen nicht mehr bewusst prozessiert werden müssen, d.h. ›abgesunken‹ sein können.
Das Erlernen des musikbezogenen Referierens durch das Bezeichnen einer musikalischen Einheit bzw. Gestalt erfolgt durch das Treffen von Unterscheidungen, einerlei, ob es sich um ein Lernen im Kontext von Lehre, die dieses Lernen intendiert (z.B. deiktisch: »›diese Akkordverbindung ist eine V-I-Verbindung«‹), oder um ein (heutzutage gern als ›informell‹ bezeichnetes) Lernen durch »Anführung« einer als »Ausführung« aufgefassten Handlung im Sinne Bernd Michael Scherers[20] handelt (»›in Mozarts Klaviersonaten klingt die Beziehung zwischen den beiden letzten Harmonien manchmal wie eine eindeutige V-I-Verbindung, manchmal aber irgendwie anders«‹; letztere Beobachtung kann dann Anlass für die Auseinandersetzung mit Vorhalten sein),[21] Die durch das ›informell‹ lernende junge Individuum hörend vollzogene »Anführung« (der sich in der Zeit entfaltenden und als »Ausführung« aufgefassten Zusammenhänge von Klängen) unterscheidet sich formal nicht von der »Anführung«, die von der visuellen Beobachtung einer beliebigen (Zeige)-Handlung, beispielsweise des Schuhe-mittels-Schleife-Bindens, als »Ausführung« ausgeht. Das Treffen von Unterscheidungen ›bestimmt‹ die Gestaltwahrnehmung also entweder – während des erwähnten Lernvorgangs – unmittelbar, indem die Bezeichnung (»›in Mozarts Klaviersonaten klingt […]«, dann die andere Seite der Unterscheidung (»es gibt andere Akkordverbindungen, vor einem Schluss gibt es viel andere Musik«) und schließlich deren Kriterium (Stufenbezeichnungen der Drei- und Vierklänge; Identifizierbarkeit der Stufe trotz unterschiedlicher Stellungen und Lagen der Akkorde) explizit gemacht werden, oder – nach dem ›Einschleifen‹ der erlernten Unterscheidungen – mittelbar.
Dieses explizite Treffen von Unterscheidungen ist für die Wahrnehmung von Musik insofern als konstitutiv zu bezeichnen, als der überzeitliche Gesichtspunkt einer ›Zusammenstellung‹, eines ›Gefüges‹, der mit dem Begriff ›Konstitution‹ konnotiert wird, durch das Aufgehobensein eines ehedem aktualen gestaltbezogenen Treffens und Explizierens einer Unterscheidung überhaupt erst gegeben ist. Dieses Explizieren, dieses (reflexive) Explizitmachen der den musikbezogenen Bezeichnungen zugrunde liegenden Unterscheidungen wird hier als ›Zuweisung musikalischer Bedeutung‹, das (reflexive) Explizitmachen jener Unterscheidungen, die den nicht-musikalischen Korrespondenzen zugrunde liegen, hier als ›Zuweisung nicht-musikalischer Bedeutsamkeit‹ bezeichnet. Demgegenüber soll die Formulierung ›Vollzug von musikalischer Bedeutung‹ hier dem bewussten, aber irreflexiven musikbezogenen Bezeichnen im Sinne des Erfassens musikalischer Einheiten bzw. Gestalten und die Formulierung ›Vollzug von nicht-musikalischer Bedeutsamkeit‹ dem mit jenem Bezeichnen einhergehenden bewussten, aber irreflexiven Erfassen nicht-musikalischer Korrespondenzen vorbehalten sein.
Das sich in der Zeit vollziehende Explizieren gibt keine Reihenfolge für die Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit vor. Die Thematisierung des Zusammenhangs beider Zuweisungen mündet in das, was als ›Interpretation‹ bezeichnet werden kann. ›Interpretation‹ wiederum wird hier zuvörderst nicht als Resultat, sondern als Voraussetzung der Vollzüge verstanden – auch, weil die implizit eigenen Lern- und Erfahrungsgeschichten (mithin die vormals erfolgten Zuweisungen und die mit diesen verbundenen Unterscheidungen) solcher Vollzüge, die Schwierigkeiten für die musikbezogene Kommunikation zeitigen, mittels entsprechender Deixis (in Verbindung mit dem zu Hörenden) begrifflich rekonstruiert werden müssen.[22]
VI. Vom zwei- und dreistelligen Zeichenbegriff unter notwendigem Einbezug musikbezogener Interaktion zum vierstelligen Zeichenbegriff
Das musikbezogene Bezeichnen (und das mit ihm verbundene implizite Unterscheiden) lässt sich in actu mit einem zweistelligen Zeichenbegriff modellieren, denn dieser erscheint mit Blick auf das Bewusstsein hinreichend, die Beziehung zwischen einer gehörten musikalischen Einheit bzw. Gestalt und dem durch sie exemplifizierten Formteil, harmonischen Zusammenhang, Gefühl oder nicht-musikalischen Lebensbereich etc. zu formalisieren. Dagegen wird im Zuge der Beobachtung dieser Beobachtung das Exemplifizierte selbst zum Zeichen, das seinerseits auf einen Interpretationskontext verweist und auf diese Weise die Beobachtung erster Ordnung ›erklärt‹. Beobachtungen zweiter Ordnung sind sowohl für die Zuweisung von Bedeutung als auch für die Zuweisung von Bedeutsamkeit maßgeblich, denn die Beobachtung, die während ihres Vollzugs dem Beobachter nicht zugänglich ist, kann nur aufgrund einer anderen Beobachtung – einer Beobachtung zweiter Ordnung – beobachtet werden. Es ist diese Vorstellung, die den zweistelligen Zeichenbegriff, welcher der Referenzform der Exemplifikation[23] zugrunde liegt und der zweiwertigen Logik entspricht, mit einem dreistelligen Zeichenbegriff in der beispielsweise durch Charles S. Peirce vorgestellten Form vereinbar macht – und zwar aufgrund der Verzeitlichung des Prozessierens des triadischen Zeichenmodells in Form von zwei differenten Unterscheidungen. Es ist zwischen dem zweiwertigen Prozessieren von aufeinander bezogenen Beobachtungen einerseits und deren Zusammenfügung qua Gedächtnis zu einem dreistelligen Zeichen andererseits zu unterscheiden.[24]
Peirces Zeichenbegriff unterscheidet zwischen ›Zeichen‹ im engeren Sinne (auch ›Repräsentamen‹ genannt), ›Objekt‹ und ›Interpretant‹, wobei in der folgenden Begriffsbestimmung von 1902 insbesondere die ›Historizität‹ des Interpretanten und damit dessen Emergenz aus einer kontinuierlichen Zeichenverwendungspraxis deutlich wird:
Zeichen[:] Alles, was etwas anderes (seinen Interpretanten) bestimmt, sich auf ein Objekt zu beziehen, auf das es sich selbst (als sein Objekt) auf die gleiche Weise bezieht, wodurch der Interpretant seinerseits zu einem Zeichen wird, und so weiter ad infinitum.
Zweifellos muss in diese Folge intelligentes Bewusstsein eingehen. Wenn die Folge einander ablösender Interpretanten zu einem Ende kommt, wird das Zeichen damit zumindest unvollkommen. Wenn die Idee eines Interpretanten, nachdem sie in einem individuellen Bewusstsein bestimmt worden ist, nicht wiederum selbst ein äußeres Zeichen bestimmt, erlischt jenes Bewusstsein oder verliert alle Erinnerung oder andere bedeutsame Wirkung des Zeichens. So wird es unmöglich, nachzuprüfen, ob es jemals eine solche Idee in jenem Bewusstsein gegeben hat. In diesem Fall ist schwer zu sehen, wie die Aussage, es habe jemals eine solche Idee in jenem Bewusstsein gegeben, noch irgendeine Bedeutung haben könnte, da diese Aussage ja ein Interpretant jener Idee wäre.[25]
Zudem ist Naomi Cummings Korrektur der womöglich naheliegenden, jedoch falschen Vorstellung zu berücksichtigen, eine erklingende Musik sei ein (Zusammenhang von) Zeichen: Vielmehr wird das ›Objekt‹ Musik für Hörerinnen und Hörer, die sich mit großer Aufmerksamkeit seiner Phänomenalität zuwenden und in Gestalt der Anmutung, die mit ihm verbunden ist, im Bewusstsein zu einem Zeichen. Cummings erläutert dies anhand des Zeichencharakters der (gesangsähnlichen) Klangfarbenqualitäten einer Instrumentalstimme:
[…] remarks on qualities of ›voice‹ in an instrumental sound convey something of how a sound may be heard as signifying. They do not suggest that a given timbral quality refers to ›voice‹ as an extra-musical object, or even that it becomes expressive of vocal emotionality as an idea that is entirely preconceived. The timbral quality has become a ›sign‹ in giving rise to a mode of listening that goes beyond its reception as an acoustic fact, a case of ›hearing as‹. Its ›object‹ is that quality which is pointed at in the metaphoric description, but not fully grasped by it, or made seperable from its sounding form. Its ›interpretant‹ is formed by the general notions of expressive vocality, which allow the sign to be understood.[26]
Kommt also im erläuterten Sinne im Zuge einer zweiten Beobachtung durch die Reflexion des Zeichens (als dem neuen Objekt der Beobachtung) dessen kontextuelle Grundlage zeichenhaft in Gestalt des Interpretanten zur Geltung, so wird ›spätestens‹ im Rahmen von dessen Thematisierung deutlich, dass Zeichen, auch musikalische Zeichen in diesem elaborierten Sinne, nicht ohne eine Lerngeschichte seitens des Bedeutung und Bedeutsamkeit zuweisenden Individuums entstehen können (was auch das obige Peirce-Zitat verdeutlicht). Diese Lerngeschichte wiederum verweist notwendig auf Interaktionen mit anderen Individuen – zumindest auf ›symbolische Interaktionen‹ im Sinne George Herbert Blumers[27] (z.B. klangliches Realisieren eines Notentextes, Studieren einer Harmonielehre) oder auf Interaktionen unter Anwesenden (Face-to-face-Interaktionen) im Sinne eines (jeweils kulturell und geschichtlich bedingten) typischen Lernkontextes. Letzterer bringt den Vorteil mit sich, dass unmittelbar korrigiert werden kann. Solche Korrekturen erfolgen aufgrund einer entsprechenden Beobachtung einer Handlung des Lernenden, weil Verstehen durch denjenigen, der etwas zu Verstehen gegeben hat (oftmals die bzw. der Lehrende), (noch) nicht attribuiert werden konnte.[28] Auch hier werden die kognitiven Interna, die im vorliegenden Beitrag als kognitives Prozessieren angesprochen und durch den Rekurs auf Sebastian Jentschkes und Stefan Koelschs Untersuchungen thematisiert wurden, vorausgesetzt. Der Verstehensbegriff ist also in zwei Stufen zu entfalten: Auf der Stufe der kognitiven Interna und auf der Stufe der Verstehensattribution, die in einer Interaktion unter Anwesenden aufgrund einer Entsprechung zur Orientierungserwartung seitens alter ego durch die- bzw. denjenigen getätigt wird, die bzw. der diese Erwartung hegt(e).[29]
Der triadische Begriff des Zeichens ist also hinsichtlich der Musik zu einem vierstelligen Begriff zu erweitern: Das ›Objekt‹ kommt – wie beim späten Peirce – als wahrgenommenes Phänomen vor (es ist identisch mit den impliziten oder expliziten Unterscheidungen im zu Hörenden)[30], also als ›musikalische Bedeutung‹ (B).[31] Als Zeichen bzw. Repräsentamen fungiert ›musikalische Bedeutsamkeit‹ (Bk). Beide werden durch einen Interpretanten (I) aufeinander bezogen. Mit der vierten Stelle kommt die Interaktion (Ia) ins Spiel, wodurch auf die Dynamik des ›Objekts‹ rekurriert wird.[32] Da die Dimensionen B, Bk und I selbst auf (zumindest symbolischen[33]) Interaktionen beruhen, lässt sich die Ergänzung der Interaktion (Ia) als eigener Dimension des Zeichenbegriffs auch als (notwendiges, Reflexion auf diese Dimension ermöglichendes) ›Reentry‹ begreifen.
Abb. 1: Vierstelligkeit des musikalischen Zeichens
Die inhaltliche Füllung dieser Dimensionen lässt sich im Sinne expliziter Zuweisungen im oben erläuterten Sinne sukzessiv (auf zweiwertigen Unterscheidungen beruhend und/oder diese durch jeweils aufeinander folgende Bezeichnungen ›entfaltend‹) ausweisen oder gegebenenfalls – in Face-to-face-Interaktionen – kontrovers thematisieren. Der Zeichenbegriff lässt sich damit als Struktur, gar als ›Inhaltsverzeichnis‹ eines Bedeutung und Bedeutsamkeit mit Blick auf konkrete Musik erläuternden Diskurses verstehen. Er bildet folglich keine bestimmten Formen musikbezogener Wahrnehmung, d.h. bestimmter Weisen des Vollzugs von Bedeutung und Bedeutsamkeit ab, sondern strukturiert die Reflexion auf diese Wahrnehmung bzw. diesen Vollzug. – Beispiele für Beschreibungen und Erklärungen der Zuweisung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit, die diesen Zeichenbegriff nutzen, werden im nächsten Kapitel gegeben werden, weil mit ihnen gleichzeitig Typen der Analogie zwischen Bedeutung und Bedeutsamkeit exemplifiziert werden sollen.
VII. Typen der Zuweisung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit
Die im Folgenden vorzustellende Typologie der Zuweisung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit fokussiert die bei dieser Zuweisung reflexiv werdende Differenz zwischen Bedeutung und Bedeutsamkeit hinsichtlich eines Spektrums, das von einer ›Quasi-Identität‹ (a) über die ›Ähnlichkeit zweier Verhältnisse‹ (b) bis zur bewussten ›Trennung‹ (c) reicht. Fall (a) setzt einen engen und nicht in Frage gestellten Zusammenhang von bezeichneter musikalischer Gestalt und der ihr direkt zugeschriebenen Bedeutsamkeit voraus. Zu kulturellen Einheiten geronnene Komplexe musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit werden – sozusagen mit einem Schlage – als wirksam erfasst. Im Fall (b) gelingt die Überbrückung der wahrgenommenen Differenz dadurch, dass das Individuum die Tätigkeit des entsprechenden Zuweisens mit größerer Ruhe – post hoc – durch Relationierung zweier Unterscheidungen selbst übernimmt, denn die Unterscheidungen also auch die Relationierung stehen nicht bereits in geronnener Form als ›kulturelle Einheit‹ zur Verfügung. Fall (c) liegt vor, wenn die Kontingenz eines Interpretanten durch die (widerfahrende oder inszenierte) Beobachtung eines anderen oder anders gearteten Interpretanten bewusst genutzt wird – z.B. im Rahmen der Dekontextualisierung oder Funktionalisierung einer bestimmten Musik. In diesem Fall muss das Individuum wissen, was es dekontextualisieren bzw. funktionalisieren möchte, d.h., worauf sich die erwähnte Trennung beziehen soll. Es rekurriert also auf eine Musik, für die eine bestimmte ›Interpretationspraxis‹ existiert und die als Referenz der trennenden Tätigkeit des Individuums als solche erkannt werden muss. Dies lässt sich nur durch die Identität oder wenigstens die Möglichkeit der Wiedererkennung einer Musik erzielen, da die ›Variation‹ in der nicht bloß neuen, sondern gar neuartigen Zuweisung von Bedeutsamkeit besteht.
Die Unterscheidung zwischen ›Quasi-Identität‹, ›Ähnlichkeit‹ und ›Trennung‹ lässt sich auf eine basale Unterscheidung zurückführen, die die unter (b) angesprochene Ähnlichkeit zweier Unterscheidungen reformuliert: Es lassen sich auf den beiden Seiten (Bedeutung und Bedeutsamkeit) ähnliche Differenzen ausmachen oder nicht. Im Falle der Quasi-Identität (a) ist dies zugunsten einer nur durch Konvention bzw. Gebrauch bedingten Verbindung von Bedeutsamkeit und Bedeutung der Fall. Durch die in der analytischen Philosophie so genannten »fundamental Ideas«[34] wird hier das Spektrum der Möglichkeiten von musikalischer Variation – und damit der Zuweisung von musikalischer Bedeutung – bestimmt. Die »fundamental Idea« einer musikalischen Formulierung selbst muss entsprechend relativ konstant – also mit ›mittelfristig‹ gleichbleibender Geltung – in den entsprechenden Praxen gehandhabt werden – etwa wie dies auch für die Handhabung eines Begriffs festzustellen ist. Demgegenüber wird im Falle der Trennung von Bedeutung und Bedeutsamkeit durch Dekontextualisierung oder Funktionalisierung (c) das Operieren mit der Ähnlichkeit von Verhältnissen (b) durch ein Spektrum möglicher Bedeutsamkeitszuweisungen ersetzt, das allerdings – sozusagen zum Ausgleich für zu große Variabilität, die nicht mehr erkennen ließe, was jeweils variiert wurde, – auf die Identität oder zumindest auf die eindeutige Wiedererkennbarkeit der Musik angewiesen ist.
Gleichwohl würde die Typologie immer noch nicht den Kern des Zuweisens von Bedeutung und Bedeutsamkeit betreffen, bezöge sie sich nicht gleichzeitig auf die Qualität der Beziehung, die diese beiden Domänen miteinander eingehen. Eine brauchbare Unterscheidung zwischen Arten von Analogie findet sich im Kommentar des Kardinals Thomas de Vio Caietan zur Summa theologica des hl. Thomas.[35] Wolfgang Kluxen referiert diese Unterscheidung:[36] Caietan unterscheidet zwischen »Attributionsanalogie«, »Proportionalitätsanalogie« und »Analogie der Ungleichheit«, die sich recht gut auf die Unterscheidung zwischen ›Quasi-Identität‹, ›Ähnlichkeit‹ und ›Trennung‹ beziehen lässt. Die Begründung, inwiefern eine Unterscheidung, die in Caietans 1505–1522 entstandenem Kommentar getroffen wurde, für die vorliegende bedeutungstheoretische Untersuchung relevant sein soll, kann dadurch erbracht werden, dass sich die Trias von Attributionsanalogie, Proportionalitätsanalogie und Analogie der Ungleichheit systemtheoretisch reformulieren lässt.
Luhmann unterschiedet drei »Sinndimensionen«:[37] die »Sachdimension«, nach der »das ›innen‹ im Unterschied zum ›außen‹ der Form« (bzw. das System im Unterschied zur Umwelt) unterschieden wird, die »Zeitdimension« (Unterscheidung vorher/nachher, Vergangenheit/Zukunft) und die »Sozialdimension« (Unterscheidung zwischen Ego als jemand, der eine Kommunikation versteht, und Alter, »dem die Mitteilung zugerechnet wird«). Diese Dimensionen sind für alle drei Typen der Analogie konstitutiv: Jeder dieser Typen basiert auf dem Erlernen musikbezogener Unterscheidungen, das eine Sache fokussiert, Zeit benötigt und sich in Interaktionen vollzieht. Gleichwohl lässt sich für jeden Typus ein Fokus der Aufmerksamkeit bestimmen, der durch eine Eigenart des jeweiligen Typus besonders nahegelegt wird.
Als Fokus systemtheoretischer Beobachtung der Attributionsanalogie bietet sich die Sachdimension an, geht es bei ihr doch um eine ›äußerliche Benennung‹:
Nur dem Vorgeordneten, dem ersten Analogat (primum analogatum) kommt der Gehalt des Begriffs als Formbestimmtheit (formaliter) und innerlich (intrinsece) zu, dem Nachgeordneten (den secundaria analogata) nur auf Grund einer Beziehung, die über ihr Sein nichts aussagt.[38]
Durch eine eingeschliffene Interpretationspraxis werden musikalische Phänomene so wahrgenommen und in eins gedeutet, als ob sie einem als primum analogatum zu verstehenden Begriff (oder einem anderen Analogat – man denke beispielsweise an das dirigentische Zeichen für die Eins eines 4/4-Taktes) direkt entsprächen bzw. dieses Analogat repräsentierten. Die so erfasste ›Sache‹ lässt erst gar nicht die Idee aufkommen, die Grenze zu kreuzen und die der entsprechenden Bezeichnung zugrunde liegende Unterscheidung thematisch werden zu lassen (d.h. zu bezeichnen).
Die Proportionalitätsanalogie »kann eine den Analogaten innerliche Gemeinsamkeit zum Ausdruck bringen, da sie auf die Ähnlichkeit der ihnen je eigenen Verhältnisse abstellt«.[39] In systemtheoretischer Perspektive kann sie mit der Zeitdimension in Verbindung gebracht werden. Dazu muss die Vorstellung einer eher statischen bzw. logisch-mathematisch einzuordnenden Beziehung zwischen zwei Unterscheidungen in den Kontext einer Überlegung gestellt werden, die den Sinn der Unternehmung in den Blick nimmt. Das Zuweisen von Bedeutung und Bedeutsamkeit im Sinne der Proportionalitätsanalogie entfaltet erst seine Kraft, wenn das so Unterschiedene und analog Gesetzte im Sinne eines Reentry[40] auf die Seite nicht-musikalischer Bedeutsamkeit kopiert und auf diese Weise der durch eine Musik exemplifizierte Zusammenhang ›für das Leben‹, für nicht-musikalische Kontexte relevant wird. Ein solches Reentry benötigt allerdings Zeit; mehr noch: nach George Spencer-Brown wird Zeit erst durch Reentries generiert. So gesehen hängen Proportionalitätsanalogie und die Zeitdimension aufs Engste zusammen. Und auf diese Weise prozessiert, ermöglicht analoges Denken nicht nur die »Erläuterung unserer Erkenntnis«, sondern auch deren »Erweiterung«.[41]
Schließlich ist der Nachweis eines Zusammenhanges der Analogie der Ungleichheit (analogia inaequalitatis) mit der Sozialdimension möglich: Diese Art der Analogie sieht – »im Sinne der ›analogia secundum esse‹ […] von der realen Unterschiedlichkeit«[42] einfach ab; Kluxen nennt als Beispiel den Begriff ›Körper‹.[43] Die Beobachtung der Ungleichheit von Zuweisungen von musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit setzt eine entsprechende Fremdreferenz voraus, die in zumindest symbolischen Interaktionen, oft aber – und in Lernprozessen vorzugsweise – in Face-to-face-Interaktionen prozessiert wird. Für die Beobachtung im Sinne der Analogie der Ungleichheit ist die soziale Dimension also in actu konstitutiv, nicht bloß für die diese Beobachtung ermöglichende Lerngeschichte.
Attributionsanalogie | Proportionalitätsanalogie | Analogie der Ungleichheit |
Abb. 2: Visualisierung der drei Arten der Analogie
Um für die Beobachtung von Praxen des Zuweisens von Bedeutung und Bedeutsamkeit zusätzlich zu den drei als Beobachtungskategorien fungierenden Typen Quasi-Identität, Ähnlichkeit und Trennung noch mehr Schärfentiefe zu erzielen, wird im Folgenden zwischen Musikstücken, in denen ›Stellen‹ nachweislich die Aufmerksamkeit eines oder mehrerer Beobachter auf sich gezogen haben[44], und den Interpretationen ganzer Musikstücke (oder zumindest entsprechenden Interpretationsansätzen) unterschieden. Im Zuge der Diskussion der Beispiele wird die Funktionsweise des oben vorgestellten Begriffs eines vierstelligen musikalischen Zeichens exemplifiziert.
| a) Quasi-Identität | b) Ähnlichkeit von Verhältnissen | c) Trennung |
›Stelle‹ | Beethoven, 5. Sinfonie, op. 67, 1. Satz, T. 268 | Nono, Il Canto Sospeso, Nr. 4, T. 269 (Internationale) | Mozart, Klarinettenkonzert KV 622, 2. Satz, T. 1–8 |
Ganzes Musikstück | Chopin, 2. Klaviersonate op. 35, 3. Satz (»Marche funèbre«) | Bernstein, »Maria« aus West Side Story | Star Spangled Banner (Anne Akiko Meyers, Vl.; Jimi Hendrix, E-Gitarre, versch. Aufnahmen; Gregory T.S. Walker, electronic violin) |
Abb. 3: Diskutierte Beispiele
a) Quasi-Identität
›Stelle‹
Das Verhältnis von Bedeutung und Bedeutsamkeit kann an ›Stellen‹ in einer Musik beobachtet werden, die sich von ihrem musikalischen Kontext abheben und die Zuweisung von Bedeutsamkeit im Sinne einer Quasi-Identität mit einer musikalischen Figur geradezu herauszufordern scheinen: Im Falle des Oboen-Rezitativs im 1. Satz von Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie (T. 268) ist Martin Gecks Zuweisung von Bedeutsamkeit triftig: Den »Anspruch auf Humanität«, bemerkt Geck,
um derentwillen die Fünfte ideell konzipiert ist, spiegelt […] ein einziger, frei ausschwingender und die Unerbittlichkeit des Schicksals-Rhythmus für einen Augenblick außer Kraft setzender Takt zu Anfang der Reprise des ersten Satzes: Gleich einem spontanen Seufzer der menschlichen Stimme artikuliert die Oboe eine Kadenz, deren Innigkeit die Erlösungssehnsucht des Individuums auszudrücken scheint.[45]
Von den drei genannten Arten von Analogie ist es die Attributionsanalogie, die hier exemplifiziert wird: Dass die Oboe – und nicht etwa Klarinette oder Bratsche – mit der menschlichen Stimme konnotiert wird, beruht ebenso auf einer dies als plausibel erscheinen lassenden Interpretations- bzw. Beobachtungspraxis, wie nur durch eine solche Praxis der Eindruck erweckt werden kann, es werde frei (rezitativisch) gesprochen: Die Oboen-Kadenz im Adagio, die – legitimiert durch Fermaten – metrisch frei vorzutragen ist, unterbricht die ansonsten (mit Ausnahme der Takte 2 und 5) in 2/4-Takten voranschreitende Musik und fungiert in dem hier zu erläuternden Zeichen als Bedeutung (B). Für die Attributionsanalogie ist nun wichtig, dass Gecks Interpretation – sein Ansprechen von Bedeutsamkeit (Bk) – als primum analogatum zu gelten hat, während die Oboen-Kadenz den Seufzer der menschlichen Stimme nur genuin musikalisch exemplifiziert: Als Beschreibung der Oboen-Linie würde der Hinweis auf die »Innigkeit der Erlösungssehnsucht des Individuums« nicht taugen; die Differenz zwischen B (Oboen-Kadenz) und Bk (»Erlösungssehnsucht«) in die Seite der musikalischen Bedeutung zu ›kopieren‹ (Reentry), führt also nicht zu einer anderen Beobachtung. Ein Reentry dieser Differenz auf der Seite der Bedeutsamkeit führt ebenfalls nur zur Bestätigung der Attribution, indem es sich in die Kette seiner permanenten Wiederholungen einreiht und so das Individuum hinsichtlich seiner Attributionspraxis, mit der es sich in die entsprechende Rezeptionsgeschichte einreiht (Interpretant; I), bestätigt. Dass diese Attributionspraxis mit entsprechenden Interaktionen (Ia) einhergegangen sein muss, in denen sowohl die (Bedingungen der) Erfassung der Oboen-Kadenz als musikalische Einheit (Gestalt) als auch die Kenntnis des ideengeschichtlichen ›Sitzes‹ der Rede von der »Erlösungssehnsucht des Individuums« zu erlernen waren, ist evident.
›Ganzes Musikstück‹
Bedeutung und Bedeutsamkeit können im Verhältnis einer Quasi-Identität stehen, wenn die musikalischen Zusammenhänge die jeweilige Bedeutsamkeit exemplifizieren, indem sie sie scheinbar unmittelbar verklanglichen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn mit Gattungsnamen auf Einzelobjekte verwiesen wird: ›Die Sonate mit dem Trauermarsch‹ meint Chopins 2. Klaviersonate b-Moll op. 35; enger noch wird oftmals der dritte Satz aus dieser Sonate als ›der Trauermarsch‹ bezeichnet, obgleich in diesem Satz nur die Takte 1–30 und 55–84 das Idiom ausprägen. Die Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit bestünde nun in der Rekonstruktion des Zusammenhangs von Marsch und Trauer, womit – bezüglich der Bedeutung (B) – nach den musikalischen Eigenschaften dieses Marsches gefragt wird – er steht in b-Moll, wodurch selbst eine bestimmte Tonartencharakteristik zum einen bestätigt[46] und zum andern auf neue Weise begründet wird, ist langsam – die Satzbezeichnung Marche funèbre (Beerdigungsmarsch) ist selbst ein Beispiel für die Quasi-Identität von Tempo und Charakter – und zeichnet sich durch charakteristische Punktierungen aus (die bereits bei Beethoven – 3. Sinfonie, 2. Satz, c-Moll und Klaviersonate op. 26, 3. Satz, as-Moll – ›exponiert‹ werden). Quasi-Zitate bzw. Anspielungen greifen die Moll-Charakteristik einerseits in derselben Tonart b-Moll auf (Brahms, Händel-Varationen op. 24, Var. XIII), andererseits auch in anderen Tonarten (Mussorgskij, Bilder einer Ausstellung, Nr. 4: Bydlo, gis-Moll).
Für die Zuweisung von Bedeutsamkeit (Bk) ist die mit dem Beerdigungsmarsch verbundene Trauer hinsichtlich der durch die Verwendung dieses Begriffs implizierten Unterscheidung – z.B. Trauer/Freude – zu erläutern. Die Reflexion auf den Interpretanten (I) wird die vielfältige Verwendung dieses Trauermarsches von Chopin in offiziösen Kontexten (z.B. Staatsbegräbnis) – in Form von Blasorchesterbearbeitungen – fokussieren, womöglich dieses Stück auch in den Kontext des ›politischen Chopin‹, des Chopin der Revolutionsetüde op. 10, 12, einordnen. Durch solche Reflexionen kann dem Individuum klar werden, dass ihm die interpretatorische Arbeit durch einen wirkungsmächtigen kulturellen Komplex, der aus einem komplexen Zusammenhang von Interaktionen (Ia) emergiert sein muss, gleichsam abgenommen wird. Sobald es sich von der entsprechenden Interpretationstradition distanzieren würde, wäre das in Anschlag gebrachte Verhältnis von musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit im Sinne dieser Typologie als Ähnlichkeit (b) oder Trennung (c) zu bestimmen – und eben nicht mehr als Quasi-Identität.
Mit Blick auf die durch ›den Trauermarsch‹ exemplifizierte Attributionsanalogie lässt sich feststellen, dass das sprachlich fixierte primum analogatum die musikalische Gestalt des Satzes, das secundum analogatum, nicht vollständig bestimmt: Die erwähnten Variantenbildungen bei Brahms und Mussorgskij zeigen, dass es sich bei den beiden äußeren Teilen des Chopin-Satzes lediglich um eine von vielen Formen der Konkretion eines Trauermarsches handelt. Das Spektrum dieser Möglichkeiten wird durch eine »fundamental Idea« oder mehrere »fundamental Ideas« bestimmt, die man freilich nur in den Eigenschaften ›langsames Tempo‹, ›Tongeschlecht: Moll‹ und ›gleichmäßiger Puls im geraden Takt‹ (Viertel im 4/4-Takt wie bei Chopin und Brahms, Achtel im 2/4-Takt wie bei Mussorgskij) erblicken wird (und eben nicht in dem konkreten musikalischen Gefüge des Chopin-Satzes). Dagegen erscheint bereits die ostinate Folge zweier Anschläge in der Begleitung mit Harmoniewechsel (Chopin) oder ohne einen solchen Wechsel (Mussorgskij) nicht zu den »fundamental Ideas« zu gehören: Brahms komponiert nachschlagende gebrochene Akkorde (auf den ›und-Zählzeiten‹ des 4/4-Takts), die kein Ostinato ausbilden.
Ein solches ›Trauermarsch-Destillat‹ zu ermitteln, ist allerdings eine musikwissenschaftliche Tätigkeit, die nur das Epitheton ›quasi‹ der Quasi-Identität näher bestimmt. Mit den Reentries der Differenz zwischen ›Trauer‹ und ›Marsch‹ verhält es sich mit Blick auf das Zuweisen von Bedeutung und Bedeutsamkeit zu Chopins Trauermarsch wie bei der Oboen-Kadenz im 1. Satz der 5. Sinfonie Beethovens: Sie zeitigen keine neuen Beobachtungen.
Die obige Überlegung zu den »fundamental Ideas« des Trauermarsches zeigt, dass es eine Frage des jeweiligen Interesses, der jeweiligen Erläuterungsabsicht ist, als wie umfangreich sich die musikalische Einheit bzw. Gestalt, also die Dimension der musikalischen Bedeutung (B) des musikalischen Zeichens, darstellt. Sowohl das Trauermarsch-Idiom als auch die Oboen-Kadenz im Beethoven-Beispiel lassen sich jeweils als aus weniger umfangreichen Zeichen zusammengesetzt begreifen.[47]
b) Ähnlichkeit zweier Verhältnisse
›Stelle‹
Beobachtungen kognitiv prozessierter musikalischer Unterscheidungen können als nicht-musikalische Unterscheidungen aufgefasst werden: Es ist dies jener Typ von Zuschreibung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit, der Unterscheidungen in den beiden Domänen Musik und Nicht-Musik unter dem Gesichtspunkt von Ähnlichkeit aufeinander bezieht. Dies ist auch im Zuge der Fokussierung einer ›Stelle‹ möglich, wie am IV. Stück aus Luigi Nonos Il Canto Sospeso studiert werden kann, nämlich hinsichtlich Takt 269, in dem die drei Anschläge der 2. und 3. Trompete den ersten drei Tönen des Refrains der Internationalen entsprechen. Nono zufolge geht es hier um die Wiedergabe einer geschichtlichen Situation.[48] Dass die Töne c2, b1 und as1 als mit der Diastematik des Beginns der Internationalen identisch verstanden werden (B), setzt nicht nur die Kenntnis der Internationalen voraus, sondern auch die des Kontextes der Stücke mit Chor im Canto Sospeso, die letzte Briefe zum Tode verurteilter europäischer Widerstandskämpfer während der Nazi-Herrschaft verwenden (Bk).[49] Dies in Verbindung mit der Einordnung Nonos als politisch engagiertem Komponisten reicht hin zur Konstitution eines Interpretanten (I), der bei der erwähnten Bedeutsamkeitszuweisung in Anschlag gebracht werden kann.
Die Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit beruht in diesem Fall auf der Proportionalitätsanalogie: So, wie sich die im seriellen Kontext auffallenden zwei Ganztonschritte abwärts von jenem Kontext, der in dieser Unterscheidung als mit erfahrenem Leid zusammenhängend aufgefasst werden kann, abheben, so hoffen die Verurteilten in den Konzentrationslagern auf den Sieg jener, die im Sinne der durch die beiden Ganztonschritte ›angestimmten‹ Internationalen[50] das Menschrecht erkämpfen. Es kann also eine proportionalitätsanaloge Beziehung zwischen Bedeutung und Bedeutsamkeit nachgewiesen werden. Im Sinne eines Reentry, das den Kontext des IV. Stücks – die kantatenhaften Stücke des Canto Sospeso – berücksichtigt, kann diese Deutung wiederum ›für das Leben‹ relevant werden: Bei der ›Erkämpfung des Menschrechts‹ geht es um die Verhinderung konkreten Leids, das – beispielsweise in der Zeit der Nazi-Herrschaft – ebenso konkret erfahren wurde (und immer wieder erfahren wird). Insofern zeitigt die symbolische Interaktion, die durch die genannten beiden Ganztonschritte abwärts motiviert werden kann, potenziell Konsequenzen für andere, nicht (nur) musikbezogene symbolische und Face-to-face-Interaktionen; der Interaktion (Ia) als einer Dimension des kommentierten musikalischen Zeichens eignet hier ein proflexives, also nicht nur mit Blick auf die interaktive Genese von (B), (Bk) und (I) zu veranschlagendes reflexives Moment.
Ganzes Musikstück
Die Ähnlichkeit zweier Verhältnisse kann für die Interpretation des Songs Maria aus Leonard Bernsteins West Side Story maßgeblich werden. Intonieren Fagotte, Finger Cymbals, elektrische Gitarre und Kontrabässe die Rumba-Begleitfigur, die leicht der von Tony besungenen puertoricanischen Maria zuzuordnen ist, so sind der Melodik und der (oftmals triolischen) Rhythmik des Gesangs ein ›westlicher‹, arienhafter Ton zueigen, der ebenso leicht als Charakterisierung des »Moderato con anima« singenden lyrischen und realen Ich Tony aufgefasst werden kann (B). Und so, wie die beiden Protagonisten – Tony und Maria – trotz ihrer Zugehörigkeit zu verfeindeten Gangs (den einheimischen Jets der West Side New Yorks und den eingewanderten, puertoricanischen Sharks) im Begriff sind, eine Liebesbeziehung einzugehen, so sind eben die beiden in diesem Musical bis zu dieser Nummer 5 der 4. Szene (The gym) auseinander gehaltenen Grundarten von Musik im Song Maria miteinander verbunden (Bk). Der Interpretant (I) hat mit den Geschichten der jeweiligen Entstehung der genannten musikalischen Idiome sowie mit ihrer harmonisch und metrisch bedingten Kombinierbarkeit einerseits und mit der Vorstellung eines innigen Verbundenseins von Liebenden andererseits zu tun: Proportionalitätsanalogie konkretisiert sich in einer musikalischen und einer nicht-musikalischen Vorstellung von Verbindung bzw. Vereinigung.
Dass mit der Interpretation dieses Songs die Proportionalitätsanalogie, also die »Ähnlichkeit der… je eigenen Verhältnisse«[51] in den Domänen der Bedeutung einerseits und der Bedeutsamkeit andererseits, exemplifiziert werden kann, ist evident. Das entsprechende Reentry des proportionalitätsanalog Unterschiedenen in die Domäne der Bedeutsamkeit führt zur Vorstellung von der ›Liebe, die alle Differenzen zu überwinden vermag‹, auch ethnische oder anders ›begründete‹ Grenzen (wobei die Kriterien für die Bestimmung solcher Grenzen selbst beobachtbar und dadurch kritisierbar werden). Auf diese Weise vermag der proportionalitätsanaloge Zugriff ›Erkenntnis‹ zu erweitern und lebenspraktisch relevant zu werden. Das im Kontext des obigen Nono-Beispiels erläuterte proflexive Moment von Interaktion (Ia), das über den bloß reflexiven Aspekt hinausgeht, ist auch für den Song Maria als eines komplexen Zeichens charakteristisch.
c) Trennung
›Stelle‹:
Die Kontingenz zugewiesener Bedeutung und Bedeutsamkeit wird durch die Konfrontation mit anderen Zuweisungen beobachtbar, die andere oder gar konträre Inhalte bestimmen. Dies wird auch im Film Padre Padrone[52] virulent: Gavino Ledda, ein Junge auf Sardinien, wird von seinem Vater zum Hirtendasein gezwungen wird, was für ihn bedeutet, nicht zur Schule gehen zu können und ein Analphabet bleiben zu müssen. Der Film erzählt die Geschichte von Gavinos Emanzipation von seinem Vater und von den Lebensbedingungen seines Zuhauses: Er geht zur Armee, wo er lesen und schreiben sowie das Konstruieren von Radios lernt. Die ›Mozart-Szene‹[53] spielt nach der Rückkehr des Protagonisten in seine Heimat: Gavino hört Radio. Es wird gerade der Beginn des 2. Satzes des Klarinettenkonzertes KV 622 von Wolfgang Amadeus Mozart gesendet. Gavinos Vater betritt den Raum. Es kommt zum Kampf, in dessen Verlauf der Vater das Radio zerstört, indem er es im Spülbecken unter Wasser setzt. Nachdem die Musik aufgrund der Zerstörung des Radios abrupt endet, pfeift Gavino die Fortsetzung der Melodie des Satzanfangs mit geringfügigen Abweichungen.[54] Darauf geht der Kampf zwischen Vater und Sohn weiter.
Das Prozessieren von Bedeutung und Bedeutsamkeit durch die beiden Akteure, auf das freilich aus der Perspektive des Beobachters der Szene (des Betrachters des Films also) mithilfe der Rekonstruktion ›entsprechender‹ Zuweisungen nur tentativ geschlossen werden kann, lässt sich in drei aufeinander folgenden Stufen beschreiben: Aus der Sicht Gavinos scheint der Beginn des Mozart-Satzes zunächst (1.) – in der Abwesenheit des Vaters – für Friedfertigkeit[55] und eine ›andere Welt‹ (Radioübertragung!) zu stehen. Der sodann (2.) hinzutretende Vater nimmt ebenfalls wahr, dass diese Musik von einer ›anderen Welt‹ kündet, bewertet dies aber im Vergleich zu seinem Sohn, der aus der Enge des sardinischen Elternhauses ausbrechen möchte, genau konträr, nämlich als feindseligen Akt Gavinos gegen ihn, den pater familias. Die Situationsdefinition des gemeinsamen Hörens dieser Musik erfolgt auf unmissverständliche Weise durch den Vater, der seinen Sohn schlagen möchte, worauf (3.) diese Situationsdefinition durch den Sohn übernommen und Mozarts Musik zu einem ›Kampfmittel‹ gegen des Vaters Autorität aufgeboten wird: Die Friedfertigkeit und das transzendente, die gegenwärtige Situation überschreitende Moment dieser Musik werden nach der Zerstörung des Radiogerätes zum Ausdruck der Aggression gegen den Vater umfunktioniert, indem der Sohn die Melodie der ersten sieben Takte des Satzes (mit kleinen Abweichungen vom Notentext[56]) pfeift. Die hiermit verbundene implizite Ich-Aussage Gavinos lautet: »Mir, dem Pfeifenden, ist wichtig, wofür diese Musik steht, und ich setze sie gegen Dich, den Banausen und ungebildeten Ziegenhirten, ein!«[57]
Die Zuweisung von Bedeutung (B) lässt sich nur mit Blick auf Gavino – (nicht zuletzt) aufgrund der kleinen Abweichungen – rekonstruieren. Hinsichtlich der entsprechenden Zuweisung seitens des Vaters kann man nur eine Mindestbedingung ausmachen, die darin besteht, dass er ›fremde Musik‹ wahrgenommen hat, die im Radio gesendet wurde. Für die Beurteilung (und Definition) der Situation mag es dabei wichtiger gewesen sein, dass sein Sohn diese Musik gehört hat.
Die in der 1. Phase durch Gavino einerseits, in der 2. Phase durch den Vater andererseits zugewiesenen Bedeutsamkeiten (Bk) sind kontradiktorisch. Dagegen gibt es in der 3. Phase so etwas wie eine Übereinstimmung in der ›Thematik‹ der jeweiligen Interpretanten (I): Als Interpretant kommen für Gavino in der 1. Phase die erwähnten Vorstellungen von Friedfertigkeit und Transzendenz in Frage, in der 3. Phase bleibt hiervon die Transzendenz übrig, die jetzt gegen den Vater und die Enge seiner Welt gewendet wird. Der Interpretant, der als Maßgabe für des Vaters Mozart-Deutung rekonstruiert werden kann – die ›fremde Musik‹ als Exempel für die zu verhindernde Emanzipation des Sohns –, kontrastiert krass mit Gavinos (ebenfalls nur zu ›rekonstruierender‹) positiver Bewertung des die Situation transzendierenden Charakters, den er Mozarts Musik zuschreibt und der mit seiner Emanzipationsabsicht korrespondiert. Die Interaktion (Ia; als Dimension des musikalischen Zeichens) konstituiert hier das Zeichen direkt, ist also nicht nur in den jeweils für (B), (Bk) und (I) relevanten jeweiligen Lernprozessen ›aufgehoben‹. Es muss sich im übrigen nicht wie im gegebenen Beispiel um eine Face-to-face-Interaktion handeln, die die Kontingenz der jeweils eigenen Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit erfahrbar werden lässt.[58]
Lässt sich eine Instanz bestimmen, die diese diametral gegenüberstehenden Interpretanten als Analogien von Bedeutung und Bedeutsamkeit motiviert? Das Beispiel exemplifiziert eine Analogie der Ungleichheit, – »bei der der gemeinsame Begriff von der realen Unterschiedlichkeit einfach absieht«.[59] Als ein solcher »gemeinsamer Begriff« kommt hier die Referenz der Unterscheidungen im zu Hörenden in Frage, die die beiden interagierenden Personen jeweils hinsichtlich der von ihnen gehörten Takte des Mozart-Satzes in Anschlag bringen. Für diese Personen wie auch für den Beobachter des Films ist es also ein klingender Ausschnitt aus einem musikalischen Kunstwerk, der die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Rezeption(sgeschichte) einerseits zu fokussieren und andererseits zu motivieren vermag.[60] Diese gleichsam ›halbe Identität‹, die durch den Beobachter vervollständigt wird, indem er die andere Seite der Unterscheidung hinzufügt – und eben nicht notwendiger Weise durch Ergänzung derselben oder wenigstens ähnlicher Inhalte hinzufügt –, meint Luhmann, wenn er von Kunstwerken als »Quasi-Objekte[n]« spricht: Quasi-Objekte
[…] nehmen genügend Varianz auf, genügend Wiedererkennbarkeit in wechselnden Situationen, um Wechselfälle sozialer Konstellationen begleiten zu können. Aber sie behalten, im Unterschied zu Begriffen, die durch spezifizierte Antonyme bestimmt sind, auch in wechselnden Lagen ihre Objektheit im Sinne des Ausschlusses […] aller anderen Vorkommnisse oder Zustände. Sie sind nichts anderes als sie selbst, und kein Begriff kann ihnen gerecht werden. Kunstwerke sind Quasi-Objekte in diesem Sinne.[61]
Diese Überlegung zur interaktiven Konstitution der auf Kunstwerke (als »Quasi-Objekte«) bezogenen Differenzwahrnehmung kann im Sinne eines Reentry auf die beiden anderen Arten von Analogie bezogen werden. Auf diese Weise lässt sich die Unterscheidung zwischen Konsens- und Dissensorientierung als letzte Kategorie von Unterscheidung in die Typologie einführen: Während Attributionsanalogie und Proportionalitätsanalogie auf Konventionen beruhen, die gleichsam ein Flussbett, einen konsensuellen Rahmen für das Zuweisen musikalischer Bedeutungen und nicht-musikalischer Bedeutsamkeiten – auch in der Ermöglichung eines partiellen Widerspruchs – vorgeben, wird im Falle der Analogie der Ungleichheit der Dissens virulent, der offenbar mit einem bestimmten Begriff der Offenheit des Kunstwerks korrespondiert.
| a) Quasi-Identität | b) Ähnlichkeit von Verhältnissen | c) Trennung |
Analogie | Attributionsanalogie | Proportionalitätsanalogie | Analogie der Ungleichheit |
Sinndimension (Fokus der Beobachtung) | Sachdimension | Zeitdimension | Sozialdimension |
Konsens-/ Dissensorientierung | konsensbasiert (nicht nur in der Interaktion) | konsensorientiert/›rational‹ (nicht nur in der Interaktion) | nur in der (symbolischen) Interaktion: dissensbezogen/›kohärenzrational‹ |
Reentry | (Selbst-)Bestätigung | ›Erkenntnis‹ | Fremdreferenz nutzend; Kontingenzerfahrung |
Abb. 4: Arten musikbezogener Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit (Typologie der Analogiebildung)[62]
Während die Proportionalitätsanalogie im Vergleich zur Attributionsanalogie als zusätzliches Moment der Beurteilung der Adäquatheit (bewusstseinsintern) bzw. Nachvollziehbarkeit (kommunikativ, in der Interaktion unter Anwesenden) so etwas wie (logische) Widerspruchslosigkeit der jeweils festgestellten Beziehung zwischen zwei Einheiten bzw. zwei Unterscheidungen aus Gründen der ›Rationalität‹ benötigt, wobei die Einheiten bzw. Unterscheidungen im Prinzip in jeweils entsprechenden Konventionen, in einer kohärenten Interpretationspraxis begründet bleiben, kann von Widerspruchslosigkeit mit Blick auf die Analogie der Ungleichheit aus der Sicht eines ›dritten Beobachters‹ nur in einem auf ein Individuum bezogenen kohärenzrationalen Sinne die Rede sein: Gavino und der Vater haben jeweils für sich gute Gründe, Bedeutung und Bedeutsamkeit wie oben rekonstruiert zuzuweisen.
Dass sich die Zuweisung der Bedeutsamkeit ›Friedfertigkeit‹ als Ergebnis einer zumindest impliziten proportionalitätsanalogen Überlegung deuten und ggf. durch eine attributionsanaloge Deutung des langsamen Tempos des Satzes (Adagio) und des insgesamt verhaltenen Charakters des Stückes (beispielsweise T. 1–8: piano) mit demselben Ergebnis ersetzen ließe, zeigt nur, dass die von beiden Akteuren in der direkten Konfrontation wahrgenommene Divergenz der jeweils maßgeblichen Interpretanten auch – und hier vor allem – mit den kontradiktorischen Situationsdefinitionen zu tun hat: Nicht das Kunstwerk, sondern unterschiedliche Definitionen der Situationen, in denen es wahrgenommen und gedeutet wird, veranlassen unterschiedliche Zuweisungen von Bedeutung und Bedeutsamkeit.[63] (Diese Zuweisungen müssen sich freilich ihrerseits durch Eigenschaften des Kunstwerks legitimieren lassen, was sogar für intendiert willkürliche oder gar absurde Bedeutungs- und Bedeutsamkeitszuweisungen – nämlich ex negativo – gilt.) Dies zu beobachten, wird durch den Vergleich ermöglicht, der sich in einer zumindest probeweisen Übernahme eines fremden Interpretanten für das eigene Zuweisen musikalischer Bedeutung realisiert (Gavinos kämpferische, den Vater ›spiegelnde‹ Funktionalisierung der Musik Mozarts) und so den eigenen Interpretanten als kontingent erweist.
Ganzes Musikstück
In unterschiedlichen Fassungen von Star Spangled Banner – von Anne Akiko Meyers, Jimi Hendrix und Gregory T.S. Walker[64] – wird die Analogie der Ungleichheit erfahrbar. Es handelt sich jeweils um instrumentale Versionen. Meyers intoniert – auf einem Soldatenfriedhof stehend – eine weitgehend mit der Gesangsmelodie identische Fassung.[65] Im Anschluss an den Videoclip ist eine Widmung zu lesen, die den affirmativen Charakter der Klangrealisation unterstreicht (»Dedicated to the men and women who gave their lives protecting their country and to those who serve today«). Demgegenüber sind sowohl in Hendrixs Versionen für E-Gitarre (nicht nur in der Version des berühmten Woodstock-Auftritts) als auch in Walkers Fassung für ›electronic violin‹ viele Einschübe (Interpolationen einschließlich der Intonation des Zapfenstreichs) verstärkt ab Takt 17 zu hören, die auf vielfältige Weise die Einsätze von Waffen (Granaten, Raketen, Gewehrsalven) in entsprechenden Glissandi und perkussiven Spielweisen mit hohen Geräuschanteilen klanglich repräsentieren oder – dies nur bei Walker – eine Militärtrommel nachahmen, auf der ein Marschrhythmus intoniert wird (T. 18.1f.).
Hinsichtlich der Hinzufügungen bei Hendrix und Walker wird virulent, dass sie auf Zuweisungen musikalischer Bedeutung zur originalen Melodie beruhen, die diese mit Blick auf den ihr zugeordneten Text als defizitär beurteilen. Dieses Urteil rekurriert offenbar auf eine normative Vorstellung von einer textadäquaten Vertonung, die weniger das Heroentum der (für die eigene Nation kämpfenden) Soldaten verherrlicht – vgl. Meyers Version –, sondern vielmehr die Lebensbedrohung durch die kriegerischen Handlungen in den Vordergrund stellt, was seinerseits sicherlich auf das Bedürfnis nach Brandmarkung der ›Sinnlosigkeit des Krieges‹ verweist. So oder ähnlich können die Interpretanten (I) bei Meyers einerseits und bei Hendrix und Walker andererseits angesprochen werden. Auf der Grundlage dieser Vorstellung einer anzustrebenden Bedeutsamkeit (Bk) wird die Möglichkeit von deren Bezugnahme auf entsprechende Bedeutung (B) – durch die erwähnten Einschübe und andere Hinzufügungen – erst geschaffen. Anders formuliert: Die Analogie der Ungleichheit wird erst durch die Hinzufügung neuer Möglichkeiten des Treffens von Unterscheidungen im zu Hörenden erfahrbar gemacht.[66]
Die Analogie der Ungleichheit zeigt sich im Vergleich zwischen der Melodie des ›National Anthem‹, die als identischer Ausgangspunkt der drei Fassungen fungiert, und diesen Fassungen selbst. Diese Identität des Ausgangspunkts für (Bedeutsamkeit bedingende) Analogiebildung kann also nicht nur durch musikalische Kunstwerke gestiftet werden, sondern auch durch nicht schriftlich fixierte Musik, die (vor allem) in entsprechenden Gebrauchspraxen tradiert wird und bereits von sich aus ein gewisses Spektrum von Variantenbildung ermöglicht. Zudem ließ sich die Beobachtung einer Analogie der Ungleichheit auf der Grundlage einer (nur) symbolischen Interaktion (als gegenüber der Face-to-face-Interaktion andere Form von Ia) exemplifizieren, die in einer Sichtung der einschlägigen Videoclips bei youtube seitens des Autors bestand.
Durch den Vergleich der drei Arten der Analogie(bildung) zeigt sich, dass die Analogie der Ungleichheit auf der Wahrnehmung von Differenz bzw. Dissens beruht, während diese Wahrnehmung das Benennen von Attributionsanalogie und von Proportionalitätsanalogie stören würde: Die Erkenntnis der Relativität bzw. Kontingenz der jeweiligen Zuweisung von Bedeutung und Bedeutsamkeit liegt gleichsam nicht im Fokus dieser Arten von ›Analogieverwendung‹.
VIII. Musikalisches Lernen: Neubestimmung des Verhältnisses von Medium und Form in den Domänen Musik und Nicht-Musik
Wenn die Theorie musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit in der erläuterten Weise auf eine Erklärung des Erlernens von Unterscheidungen im zu Hörenden und in der Domäne der Nicht-Musik angewiesen ist, weil die im Zuge der musikbezogenen Zeichenverwendung in Anschlag gebrachten Bezeichnungen als aufgrund von ehedem getroffenen Unterscheidungen begriffen werden, dann muss wenigstens der Ansatz (zu) einer Theorie des Musiklernens erläutert werden, der mit den bislang zur Rate gezogenen Konzepten von Peirces Zeichentheorie und von Luhmanns (respektive Spencer-Browns) System- und Unterscheidungstheorie kompatibel ist.
Musikalisches Lernen lässt sich als Ermöglichung neuer Zuweisungen von musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit durch Neubestimmung der jeweiligen Verhältnisse von Medium und Form in den Domänen Musik und Nicht-Musik begreifen. Dies sei nun unter Bezugnahme auf die entsprechenden Erörterungen Niklas Luhmanns und Dirk Baeckers erläutert, die beide auf Fritz Heider rekurrieren.
Ein Medium hat die folgenden von Dirk Baecker erläuterten Eigenschaften, die sich Fritz Heiders einschlägige Überlegungen zu Ding und Medium (aus dem Jahre 1926!) zunutze machen:
Dinge sind fest gekoppelte Einheiten, die aus Elementen bestehen, die dann, wenn sie lose gekoppelt sind, das Medium ausmachen. Wir übersetzen ›Ding‹ in ›Form‹ […]. Ein Medium ist eine unbestimmte, aber bestimmbare Menge von Möglichkeiten, in ihm bestimmte Formen zu bilden. Nur die Form ist bestimmt, deswegen ist auch nur sie beobachtbar. Aber wir führen bei der Beobachtung einer bestimmten Form das Wissen um die unbestimmte Menge an Möglichkeiten, die in dieser Form als Fundus und Horizont ihrer Bestimmung vorausgesetzt werden, mit. Aus jeder Form erschließen wir das Medium, aus dem sie dank fester Kopplung derselben Elemente gebildet worden ist. […] Im Gegensatz zu jeder einzelnen Form, die auftaucht und wieder verschwindet, die gelingen, aber auch misslingen kann, bleibt uns das Medium, das Wort, der Text, die Liebe, die Macht, als das erhalten, was sie sind.[67]
Dieser Aufzählung von Medien können wir hier noch Noten bzw. Klänge sowie – weil sie als Anweisungen zur festen Kopplung mit begrenzter Reichweite fungieren – Regeln für deren Kombination hinzufügen.[68]
Wenigstens ein Beispiel für den (rekonstruierbaren) Zusammenhang von Form und Medium sei aus dem Mozart-Satz gewonnen. Mit Blick auf die Melodie der Takte 3 und 4 mag man den Phrasenschwerpunkt beobachten, der durch die Wiederholung des höchsten Tons a2 gegeben ist und der aufgrund des in Takt 1 noch nicht erklingenden Aufschwungs in Achteln in Takt 3 stärker ausfällt als der Phrasenschwerpunkt der ersten beiden Takte mit der entsprechenden Wiederholung des Tons fis2. Mit Blick auf diese Variantenbildung innerhalb des ersten Achttakters kann man das Material der Töne und Dauern, mit denen man den Wechsel von der I. zur V. Stufe darstellen kann, als Medium begreifen. Durch diese Beschreibung wird der Analysegesichtspunkt gewechselt, der die Einheit der beschriebenen Unterscheidung – aufgrund einer anderen Unterscheidung – beobachtbar und gleichzeitig ein musikalisches Medium bestimmbar macht.
Gavinos gepfiffene Version bietet ein Beispiel für einen anderen Gebrauch der durch die lose gekoppelten Elemente gegebenen Möglichkeiten. Die durch ihn gewählte Form, in der er bestimmte dieser Elemente des genannten (rekonstruierten) Mediums präsentiert, also seine Version von deren fester Kopplung, unterscheidet sich von Mozarts Variantenbildung: In seiner gepfiffenen Fassung entsprechen die Takte 3 und 4 in rhythmischer Hinsicht vollständig den Takten 1 und 2.
Der Vergleich zwischen Mozarts Melodiebildung und Gavinos Variante ermöglicht auf bewusste (und nicht sprachpflichtige) Weise ein Musiklernen, in dem die komplexere von der einfacheren Variante einer Formbildung auf identischer medialer Basis unterschieden werden kann. (Falls Gavino seine Fassung korrigieren sollte, müsste ihm also die Möglichkeit zu dieser Beobachtung eröffnet werden.) Aber nicht nur dieser recht komplexe Lernvorgang, sondern jedwedes Lernen, auch das Erlernen der Elementaria, vollzieht sich als Umlernen, das von der Wahrnehmung und Deutung einer bislang verwendeten (prozessierten) Form als aus einer bestimmten Konstellation von Elementen des ihr zugrunde liegenden Mediums bestehend ausgeht. Erst dies ermöglicht die Erkenntnis, dass mit denselben Elementen durch deren neue, andere Zusammenstellung eine andere Form gebildet werden kann. Daher lässt sich als ein Anwendungsbereich dieser Theorie – neben der Erklärung erfolgter Prozesse der Zuweisung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit – die Strukturierung musikalischen Lernens wie auch der Hervorbringung neuer, bislang unerhörter Musik, die Anbahnung (Initiierung) kreativer Prozesse bestimmen. Insofern ›unterhält‹ diese Theorie auch eine Brücke zur Kreativitätstheorie, die sie ihrerseits anders zu strukturieren bzw. zu modellieren hilft.
Da Luhmann bzw. Baecker sich den Rekurs auf Heiders Unterscheidung zwischen Medium und Form zunutze machen, kann auf einen ausgeführten Nachweis der Kompatibilität mit einem systemtheoretischen Ansatz verzichtet werden. Für den Nachweis der Anschließbarkeit an den vorgestellten modifizierten Zeichenbegriff Peirces wiederum mag hier folgende Überlegung Helmut Papes genügen:
Die Form, die im Objekt verkörpert und im Zeichen dargestellt ist, wird zum Objekt des Zeichens. Wenn also das unabhängige Objekt logisch kausal wirksam ist, dann nur, insofern es eine bestimmte Form verwirklicht, die damit unabhängig vom Zeichen bereits existiert. Durch die Folge interpretierender Zeichen wird dann dieser formale Aspekt des Objekts zum vereinheitlichenden Bezugspunkt der Interpretationen.[69]
Die Rede vom »vereinheitlichenden Bezugspunkt« zeigt bereits, dass Pape von einer gewissen Variabilität der Form der interpretierenden Zeichen ausgeht (Peirce lange Zeit gar von deren Verbesserbarkeit, eine Vorstellung im Übrigen, deren Übernahme nicht notwendig ist – Peirce verabschiedete sie in dem bereits zitierten Manuskript 318 aus dem Jahre 1907 selbst[70] – und hier auch nicht erfolgt). Dies muss auf einer in mehr oder weniger engen Grenzen sich vollziehenden Formbarkeit von kombinierbaren Elementen beruhen, wobei der Grad der Gestaltvarianz je nach dem Grad verbindlicher Fixierung, der von (einer) Konvention oder von der Stringenz einer Zeichenverwendungspraxis in einer Face-to-face-Interaktion (von einer Konventionsbildung in actu also) abhängt, unterschiedlich sein wird. Jedenfalls ist allein schon wegen der notwendigen Unterschiedlichkeit der Lern- und Erfahrungsgeschichten der Zeichen generierenden Individuen nicht von einer Gestaltidentität der Zeichen auszugehen. Das »reale Objekt« bietet also eine Konstellation von lose gekoppelten Elementen, durch deren feste Kopplung unterschiedliche »unmittelbare Objekte« (Formen im Sinne Baeckers) generiert und die dennoch auf dasselbe »reale Objekt« bezogen werden können.[71]
IX. Geltungsbereich der Theorie
Bestimmte Arten von Musik lassen sich als Grenzfälle im Hinblick auf den Geltungsbereich der Theorie begreifen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es wäre zu überlegen, wie sich diese Theorie auf die »›Echtzeit‹-Semiose« des Hip Hop beziehen sollte[72], wobei eine Gemeinsamkeit mit den Überlegungen zur oben thematisierten Musik sicherlich im Post-hoc-Status der zu treffenden Aussagen bestehen wird. Wenngleich man mit Blick auf das Verhältnis von Bedeutung und Bedeutsamkeit sicherlich Attributionsanalogien in actu benennen können wird, bleiben doch Bedenken bezüglich des Missverhältnisses zwischen dem (funktions-)ästhetischen Sinn des Hip Hop, der in der Körperlichkeit dieser Musik zu suchen ist, und der (möglichen) Anstrengung der auf jene Analogien bezogenen begrifflichen Arbeit bestehen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, den Geltungsbereich der vorgestellten interaktionalen Theorie musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit zunächst auf Musik zu beschränken, die so aufgefasst (beobachtet) wird, als sei für sie das reflektierte Verhältnis von Bedeutung und Bedeutsamkeit relevant.[73] Ihre Beschreibungs- und Erklärungskapazität mit Blick auf Prozesse der Bedeutungs- und Bedeutsamkeitszuweisung, die sich auf andere Musik beziehen, bleibt zu überprüfen.
Anmerkungen
Vgl. Luhmann 1997, 174 und 1998, Bd. 1, 199f. sowie Fuchs 2002, 154f. | |
Dazu könnte beispielsweise die Frage gehören, ob bestimmte ›Kompositionen‹ John Cages als ›Musik‹ gelten können. | |
Vgl. Luhmann 1993, 228f.; hier auch der Hinweis auf die Individualität sozialer Systeme, z.B. von Interaktionssystemen. | |
Vgl. Habermas 1988, dessen Rezeption der Begriffe ›Identität‹ und ›Subjektivität‹ bei George Herbert Mead durchaus systemtheoretisch reformuliert werden könnte. Vgl. auch die dortigen Überlegungen zur »Dezentrierung des Subjekts« (201ff. und 217ff.) mit den Überlegungen im Anschluss an Peter Fuchs in vorliegener Arbeit. | |
Fuchs 2002. | |
Ebd., 154. | |
Ebd. | |
Ebd., 160ff. | |
Ebd., 167f. | |
Sicherlich ließe sich auch von ›nicht-musikalischer Bedeutung‹ sprechen. Infolge der hier vorgenommenen Definition kann die Unterscheidung Bedeutung/Bedeutsamkeit jedoch ohne die jeweilige (in der Häufung sprachlich etwas steife) adjektivische Charakterisierung als ›musikalisch‹ bzw. ›nicht-musikalisch‹ in Anschlag gebracht werden. | |
Jentschke/Koelsch 2010, 42. | |
Ebd., 43. | |
Ebd., 43ff. | |
Immer geht es um die vorprädikative Verarbeitung der genannten musikalischen Phänomene, die mit den Mitteln neurowissenschaftlicher Forschung beobachtet wird. | |
Vgl. Orgass 2007, 497–503. | |
Vgl. Orgass 2008. In der beschriebenen Situation kann ein »Ein-Situations-Sprachspiel« emergieren (Weiss 2004, 94). | |
Luhmann 1998, Bd. 1, 69. | |
Vgl. Spencer-Brown 2009, 1–4 und 9f. | |
In phänomenologischer Theorietradition könnte man auch von einem monothetischen Akt sprechen, für dessen Hervorbringung ein polythetischer Akt erforderlich war (vgl. Husserl 1992, § 119, 275–277 [247–249]). | |
Vgl. Scherer 1984, 57–64. | |
Im Zuge der Beobachtung des letztgenannten Lernvorgangs ist nicht nur das Hören, sondern auch das zu Hörende als Handlung zu modellieren: im Beispiel als Ergebnis der Handlung eines Pianisten, das sich seinerseits auf das Ergebnis des Komponierens als Handlung Mozarts bezieht und gegebenenfalls aufgrund des Ergebnisses der Handlungen der am Prozess elektroakustischer Aufzeichnung Beteiligten ohne die Präsenz des Pianisten und seines Instruments zu Gehör gebracht wird. | |
Diese Überlegung tendiert zum Gegenteil der didaktischen Konsequenzen, die Wilfried Gruhn aus der Unterscheidung »figuraler« und »formaler« Repräsentationen mit Blick auf das Musiklernen getroffen hat (2005, 47, 186ff. und 189f.). Freilich ist das formale Moment des bewussten musikbezogenen Unterscheidens, wie erläutert, an die Möglichkeit »›figuraler‹, d.h. zeitlich strukturierter Repräsentation« (ebd., 190) gebunden. | |
Zur Erläuterung der hier implizit aufgegriffenen Unterscheidung zwischen ›Denotation‹ und ›Exemplifikation‹ sowie zwischen ›Label‹ und ›Sample‹ Nelson Goodmans (1997) vgl. Thorau 2006, 145ff. | |
Eine wichtige Bedingung für die Kompatibilität von Zwei- und Dreiwertigkeit nennt Werner Scheibmayr: »Zur Drittheit [Peirce unterscheidet ›Erstheit‹, ›Zweitheit‹ und ›Drittheit‹] werden diese Phänomene [›Gesetz‹, ›Regelmäßigkeit‹, ›allgemeine Regel‹] deshalb gerechnet, weil die Relationierung von bestimmten Bedingungen mit bestimmten Konsequenzen nur in einem Dritten geregelt werden kann […]. Die Regelungsleistung der Drittheit erfüllt […] wesentliche Anforderungen, die Luhmann an konditionierende Systemstrukturen richtet: […] Wenn sich aus […] geregelten Relationen von Elementen in der Zeitdimension ein systemischer Prozess ergibt, dann ist dieser Prozess weder instabil noch entropisch, sondern vielmehr gerichtet und qualifiziert. Denn der Anschluss jedes neuen Elements geschieht nicht in beliebiger oder zufälliger Relationierung, sondern gemäß den geregelten Konditionen der Drittheit. Diese erfüllen damit genau Luhmanns Anforderungen an die Konditionierung der Anschlussmöglichkeiten von Elementen im System. Diese besteht ja auch darin, als Wenn-Dann-Regel nur von bestimmten Systemelementen aus bestimmte weitere Anschlüsse selektiv zuzulassen.« (Scheibmayr 2004, 181) | |
Peirce 2000a, Bd. 1, 375, hier die kursiven Hervorhebungen; das englische Original auch in CP 2.303; »CP« steht für Peirces Collected Papers (Peirce 1931–35): Die erste Zahl bezeichnet den Band, die folgenden drei Zahlen den Abschnitt, z.B. CP 2.303 für 2. Band, Abschnitt 303. | |
Cumming 2000, 76. Diese Überlegung wäre nun noch unter Berücksichtigung von Peirces Unterscheidung zwischen unmittelbarem und realem Objekt zu präzisieren. Vgl. Pape 1989, 297–342. | |
»Der symbolische Interaktionismus vertritt den Standpunkt, dass die Welten, die für die Menschen und ihre Gruppen existieren, aus Objekten zusammengesetzt sind, und dass diese Objekte das Produkt symbolischer Interaktion sind. Zu den Objekten ist alles zu zählen, was angezeigt werden kann, alles, auf das man hinweisen oder auf das man sich beziehen kann – eine Wolke, ein Buch, eine gesetzgebende Versammlung, ein Bankier, eine religiöse Lehrmeinung, ein Geist und so weiter.« (Blumer 1981, 90) Weiter heißt es: »Die Bedeutung von allem und jedem muss in einem Prozess des Anzeigens geformt, erlernt und vermittelt werden – in einem Prozess, der zwangsläufig ein sozialer Prozess ist. Das menschliche Zusammenleben auf der Ebene der symbolischen Interaktion ist ein unermesslicher Prozess, in dem die Menschen die Objekte ihrer Welt bilden, stützen und abändern, indem sie Objekten Bedeutung zuschreiben.« (Ebd., 91) Vgl. in vorliegender Arbeit den Gedanken der Kondensierung erlernter Unterscheidungen zu Einheiten. | |
Die hier lediglich angerissene »Attributionstheorie des Verstehens« stammt von Gebhard Rusch (1992). | |
Vgl. ebd., 223f. | |
Vgl. Peirces Bestimmung des Begriffs Zeichen von 1911, in der auch die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und realem (bzw. dynamischem) Objekt aufgehoben ist: »Ein Zeichen ist […] alles – gleichgültig, ob es sich um ein Aktuales, ein Kann-Sein oder Würde-Sein handelt –, was auf einen Geist, seinen Interpreten, einwirkt [affects] und die Aufmerksamkeit des Interpreten auf ein Objekt (ein aktuales, ein Kann-Sein- oder Würde-Sein-Objekt) zieht, das bereits in den Bereich der Erfahrung gelangt ist. Und neben dieser rein selektiven Wirkung des Zeichens hat es die Kraft, im Geist (ob direkt, durch das Bild oder den Klang oder indirekt) eine Art von Empfindung oder eine Anstrengung oder einen Gedanken hervorzurufen.« (Peirce 2000b, Bd. 3, 467, hier die kursiven Hervorhebungen). Für das amerikanische Original vgl. Cumming 2000, 79. | |
Musikalische Bedeutung (B) wird durch unbewusste, auf entsprechenden Lern- und Erfahrungsgeschichten beruhenden (Hör-)Erwartungen (Antizipationen) strukturiert, die entweder mit dem entsprechenden Interpretanten identisch sind oder diesen (im Sinne einer seiner Aspekte) konstituieren; vgl. hierzu Huron 2007, insbesondere die Typologie der Formen ›musikbezogener Antizipation‹ (»Creating Predictability«), ›musikbezogener Überraschung‹ (»Creating Surprise«) und ›musikbezogener Spannung‹ (»Creating Tension«) in den Kapiteln 13–15 (239–329). – Es könnte hier der Eindruck entstehen, als ob der Begriff der Bedeutung unter den Zeichenbegriff (als den allgemeineren Begriff) subsumiert würde, was mit folgender Begriffsbestimmung Peirces aus dem Jahre 1903 kompatibel wäre: »Es erscheint natürlich, das Wort Bedeutung zu benutzen, um den intendierten Interpretanten eines Symbols zu bezeichnen« (Peirce 1991, 118). Der in vorliegender Arbeit hervorgehobene konstitutive Stellenwert der jeweiligen Entstehungsgeschichten der musikalischen Bedeutung, der nicht-musikalischen Bedeutsamkeit und des Interpretanten ist jedoch eher mit Peirces späterer (z.B. 1907 vertretener) Auffassung kompatibel (vgl. Anm. 70 vorliegender Arbeit). | |
Die musikbezogene Interaktion (Ia) fungiert als Anschlussstelle einer Theorie des Musiklernens. | |
Vgl. Anm. 27. Heinz Buddemeier (1973, 47) spricht in diesem Zusammenhang von »fingiert-dialogischer Kommunikation« (Buddemeier zitiert nach Link 1980, 164, Anm. 12). | |
Vgl. Evans 1982, 108–112. | |
Caietan 1888–1912. | |
Kluxen/Schwarz/Remane 1971, Sp. 224f. | |
Luhmann 1998, Bd. 2, 1136f. | |
Kluxen/Schwarz/Remane 1971, Sp. 224. | |
Ebd., hier die kursiven Hervorhebungen. | |
Matthias Varga von Kibéd nennt im Rahmen seines Referates von George Spencer-Browns Theorie der Form fünf Merkmale der Form einer Unterscheidung: 1. Innen, 2. Außen, 3. Grenze, 4. Kontext, 5a) Motiv und 5b) Reentry. Er bezeichnet das Motiv als schwache Form des Reentry, also der »Wiedereinführung des Kontextes ins Innere der Unterscheidung«, während das Reentry in seiner starken Form wiederholt vorkommt und auf diese Weise Zeit erzeugt (2008, 63, 64 und 70). | |
Vgl. dagegen Kluxen/Schwarz/Remane 1971, Kant referierend, Sp. 226, hier die kursive Hervorhebung. | |
Ebd., Sp. 224. | |
Ebd. | |
Es wird erwähnt, wenn es sich dabei um den Autor vorliegender Untersuchung handelt. | |
Geck 1993, 44. | |
Vgl. Schubart 1806, 378. | |
Mithilfe eines Zeichenbegriffs, der aufgrund der Verabschiedung des repräsentationalen Verweisungscharakters fixierter (musikalischer) Einheiten die für musikbezogene Belange erforderliche Flexibilität aufweist, lässt sich die semantische Dimension der Musik mit mehr Schärfentiefe erfassen, als dies in musikbezogenen bedeutungstheoretischen Untersuchungen möglich erscheint, die auf einen Zeichenbegriff gänzlich verzichten (vgl. noch Orgass 2007, 21–23). Der zu dem hier entwickelten Zeichenbegriff gehörige »Referenzmodus ist ein Vorweisen und kein Verweisen«, »eine zusammengesetzte Referenzform«, bei der »Besitz von Merkmalen und »Bezugnahme« auf diese Merkmale »zusammenkommen« müssen (Thorau 2006, 146, hier die kursiven Hervorhebungen, mit Blick auf den durch Nelson Goodman eingeführten Begriff der »Exemplifikation«; vgl. Goodman 1997, 59–63). | |
Nach Auskunft von Nicolaus A. Huber, ehedem Schüler Nonos, ›aus erster Hand‹. | |
Stücke Nr. I, IV und VIII sind Orchesterstücke, Stücke Nr. II, III, V, VI und VII sind Soli mit Orchester, Stück Nr. IX hat die Besetzung Chor und Pauken. | |
Die Achtelpunktierung des Originals wird im Summenrhythmus durch ein Achtel und zwei Sechzehntel ersetzt, von denen das zweite zu einer halben Note übergebunden wird. | |
Kluxen/Schwarz/Remane 1971, Sp. 224, hier die kursiven Hervorhebungen. | |
Padre Padrone von Paolo und Vittorio Taviani, 1977, auf DVD seit 2007, Arrow Films FCD316. | |
1:35’20’’–1:41’15’’. | |
Bei diesen Abweichungen handelt es sich a) um die rhythmische Angleichung der Takte 3 und 4 an die Takte 1 und 2 unter Beibehaltung des diastematischen Verlaufs (hierdurch entfällt die Antizipation des b2 am Ende von T. 3), und b) um die Punktierung der jeweils letzten Zählzeit der Takte 5 und 6. | |
In den ersten acht Takten des Mozart-Satzes bilden die Takte 3 und 4 – bei beibehaltender Tonart (D-Dur) – eine rhythmische und melodische Variante der Takte 1 und 2; Takt 6 variiert Takt 5 melodisch, wiederholt aber dessen Rhythmus: Der Weg nach A-Dur (T. 8) wird also mit Wiederholung kombiniert bzw. vorsichtig und nur nach und nach, eben ›nicht gewaltsam‹ und ›friedfertig‹ beschritten. | |
Vgl. Anm. 54. | |
Die Fokussierung auf die ›Stelle‹ der ersten acht respektive sieben Takte erscheint gerechtfertigt, weil sie durch Gavinos gepfiffene Wiedergabe situativ und in der direkten Konfrontation mit dem Vater fokussiert wird (und dann pars pro toto für den Konzertsatz, für das Konzert, für Mozart, für ›fremde Musik‹ steht). | |
Bleibt die ›Interaktion‹ (›Ia‹ als Dimension des musikalischen Zeichens im Typus der ›Quasi-Identität‹ latent, weil sie lediglich in den Lernprozessen eine konstitutive Rolle spielt, in denen (B), (Bk) und (I) hervorgebracht werden, und wird Interaktion (Ia) im Typus der ›Ähnlichkeit von Verhältnissen‹ wie in den Kontexten des Nono- und des Bernstein-Beispiels erläutert potenziell virulent, so spielt sie im Typus der ›Trennung‹ für die Hervorbringung des musikalischen Zeichens selbst die entscheidende Rolle – entweder als symbolische oder als Face-to-face-Interaktion. | |
Kluxen/Schwarz/Remane 1971, Sp. 224. | |
Vgl. hierzu Orgass 2007, 260–279, insbesondere 275f. | |
Luhmann 1997, 81f. | |
Diese im Sinne von Idealtypen unterschiedenen Typen kommen in konkreten Prozessen des Vollzugs und des Zuweisens von Bedeutung und Bedeutsamkeit in unterschiedlichen Mischungen (in der Gleichzeitigkeit und in der Sukzession) vor. – Durch die Typologie werden Arten und Weisen der »metaphorischen Exemplifikation« (vgl. Goodman 1997, 59ff. und 88ff.) anders differenziert, als dies mit Nelson Goodman selbst, der »den Begriff der Ähnlichkeit […] wegen seiner Unschärfe meidet« (Thorau 2006, 147, Anm. 38), gerechtfertigt werden könnte. Die unterscheidungstheoretische Ausrichtung dieser Typologie spannt dabei ein größeres Spektrum an Möglichkeiten des Zuweisens von Bedeutung und Bedeutsamkeit auf, als dies bei Thorau mit der (alleinigen) Unterscheidung zwischen »geteilten und nicht geteilten sinnlichen Eigenschaften« verschiedener »exemplifizierender Zeichen«, die »untereinander Bezug über Ähnlichkeit oder Kontrast« nehmen (147), darunter musikalische Einheiten bzw. Gestalten, geleistet werden könnte. | |
Vgl. Orgass 2007, 113–116. | |
Alle auf www.youtube.com. | |
Abweichungen: Arpeggio aufwärts in Takt 28.2, hinzugefügte Quarte aufwärts in Takt 30.2, Auszierung des Schlusstons in Takt 32 durch Arpeggio und Dreiklang. | |
Der entsprechende Vergleich von Interpretanten und das durch ihn ermöglichte Reentry vollziehen sich analog zum oben mit Blick auf das Mozart-Beispiel beschriebenen, die Fremdreferenz nutzenden Reentry. | |
Baecker 2007, 182. | |
Mit Blick auf Musik vgl. Kreidler 2008 und Orgass 2009. | |
Pape 1989, 399f., hier die kursive Hervorhebung. Vgl. auch Anm. 26 vorliegender Arbeit. | |
Peirce bestimmt in MS 318 als einzige geistige Wirkung (»mental effect«), die als »ultimate logical interpretant« fungieren kann, »habit change« (CP 5.476, hier die kursive Hervorhebung). Für Short (2009, 57) rückt Peirce damit von seiner älteren Vorstellung einer unendlichen Semiose ab: »Meaning is not an endless translation of sign into sign.« (Vgl. Anm. 31 vorliegender Arbeit.) | |
Als musikbezogenes Beispiel mag hier Nicolaus A. Hubers Auflistung von Hörweisen der ersten sieben Takte von Mozarts Figaro-Ouvertüre dienen, die er im Rahmen des Begleittextes zu seiner Komposition First play Mozart für Flöte solo (1993) vorstellt. Vgl. Huber 2000, 376f. – Dies versteht sich als Beitrag zur Diskussion, wie Peirces Vorstellung von der Determination eines Zeichens durch das Objekt und eines Interpretanten durch das Zeichen verstanden werden kann (wenn nicht im mechanistischen oder teleologischen Sinne; vgl. Short 2009, 164ff.). Short schlägt hierfür die Vorstellung des »Begrenzens« des Zeichens durch das Objekt vor (ebd., 167: »to limit«). Zumindest mit Blick auf die Relation zwischen Objekt und Zeichen wird aufgrund der referierten Vorstellung der unterschiedlichen Kombinierbarkeit von Elementen bestimmbar, worin die jeweilige Begrenzung besteht und wie sie sich konkretisiert. | |
Vgl. hierzu die Überlegungen in Orgass 2007, 270–276, der zitierte Begriff ebd., 274. | |
Dies zeigt mit Blick auf den Sinn bzw. die Rahmung dieser Theorie, dass sich deren zeichentheoretischer Aspekt auf die Reflexion der Hervorbringung und Geltung musikalischer Bedeutung und nicht-musikalischer Bedeutsamkeit bezieht und hinsichtlich dieser Funktion unter die übergeordneten Termini Bedeutung und Bedeutsamkeit zu subsumieren ist (vgl. auch Anm. 31 und Anm. 70 vorliegender Arbeit). |
Literatur
Baecker, Dirk (2007), Form und Formen der Kommunikation, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Blumer, Herbert (1981), »Der Methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus«, in: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.), Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. 1: Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie. 2. Ethnotheorie und Ethnographie des Sprechens, Opladen: Westdeutscher Verlag, 80–146.
Buddemeier, Heinz (1973), Kommunikation als Verständigungshandlung. Sprachtheoretische Ansätze zu einer Theorie der Kommunikation, Frankfurt a.M.: Athenäum.
Caietan, Thomas (1888–1906), Summa theologiae cum Supplemento et commentariis Caietani (Editio Leonina: Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici Opera omnia iussu Leonis XIII. P.M. edita, cura et studio fratrum praedicatorum, 50 Bde., Rom 1888–2000, hier Bde. 4–12, 1888–1906), Rom: Ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide.
Cumming, Naomi (2000), The Sonic Self. Musical Subjectivity and Signification, Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.
Evans, Gareth (1982), The Varieties Of Reference, hg. von John Mc Dowell, Oxford: Clarendon Press und New York: Oxford University Press.
Fuchs, Peter (2002), »Die konditionierte Koproduktion von Kommunikation und Bewusstsein«, in: Ver-Schiede der Kultur. Aufsätze zur Kippe kulturanthropologischen Nachdenkens, hg. von der Arbeitsgruppe »menschen formen« am Institut für Soziologie der freien Universität Berlin), Marburg: Tectum Verlag, 150–175.
Geck, Martin (1993), Von Beethoven bis Mahler. Die Musik des deutschen Idealismus, Stuttgart/Weimar: Metzler.
Goodman, Nelson (1997), Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Gruhn, Wilfried (2005), Der Musikverstand. Neurobiologische Grundlagen des musikalischen Denkens, Hörens und Lernens, zweite, neu überarbeitete Auflage (= Olms Forum 2), Hildesheim u.a.: Olms.
Habermas, Jürgen (1988), »Individuierung durch Vergesellschaftung. Zu G.H. Meads Theorie der Subjektivität«, in: Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 187–241.
Heider, Fritz (2005), Ding und Medium, hg. und mit einem Vorwort versehen von Dirk Baecker, Berlin: Kulturverlag Kadmos.
Huber, Nicolaus A. (2000), »First play Mozart für Flöte solo (1993)«, in: Durchleuchtungen. Texte zur Musik 1964–1999, hg. und mit einem Vorwort versehen von Josef Häusler, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 376–377.
Huron, David (2007), Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectations, Cambridge/MA: The MIT Press.
Husserl, Edmund (1992), Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (= Gesammelte Schriften 5), [Text nach Husserliana III/1 und V], hg. von Elisabeth Ströker, Hamburg: Felix Meiner.
Jentschke, Sebastian und Stefan Koelsch (2010), »Sprach- und Musikverarbeitung bei Kindern: Einflüsse musikalischen Trainings«, in: Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von ›audio literacy‹ im Fremdsprachenunterricht (= Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernorientiert 17), Frankfurt a.M. u.a.: Lang, 37–55.
Kluxen, Wolfgang, Hans Schwarz und Adolf Remane (1971), Art. »Analogie«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 1, hg. von Joachim Ritter, Sp. 214–229.
Kreidler, Johannes (2008), »Medien der Komposition«, Musik & Ästhetik 48, 5–21.
Link, Hannelore (1980), Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme, Stuttgart u.a: Kohlhammer.
Luhmann, Niklas (1993), »Individuum, Individualität, Individualismus«, in: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 149–258.
––– (1997), Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
––– (1998), Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 Bde., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Orgass, Stefan (2007), Musikalische Bildung in europäischer Perspektive. Entwurf einer Kommunikativen Musikdidaktik (= FolkwangStudien 6), Hildesheim u.a.: Olms.
––– (2008), »Interkulturelle Interaktion. Auseinandersetzung mit fremdkultureller Musik aus systemtheoretischer und musikpädagogischer Sicht«, Diskussion Musikpädagogik 40/4, 27–36.
––– (2009), »Werke beobachten – Beobachtung durch Werke. Systemtheoretische Überlegungen zur Autonomie der Musik«, Musik – Transfer – Kultur. Festschrift für Horst Weber, hg. von Stefan Drees, Andreas Jacob und Stefan Orgass (= FolkwangStudien 8), Hildesheim u.a.: Olms, 491–505.
Pape, Helmut (1989), Erfahrung und Wirklichkeit als Zeichenprozess. Charles S. Peirces Entwurf einer Spekulativen Grammatik des Seins, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Peirce, Charles S. (1931–35), Collected Papers, Bde. 1–6, hg. von Charles Hartshorne und Paul Weiss, Bde. 7 und 8, hg. von Arthur W. Burks, Cambridge/MA.
––– (1991), »Vorlesung VI: Drei Typen des Schließens«, in: ders., Vorlesungen über Pragmatismus. Mit einer Einleitung und Anmerkungen neu hg. von Elisabeth Walther, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 101–121 [Vorlesungen an der philosophischen Fakultät der Harvard-Universität, gehalten am 07. Mai 1903].
––– (1998), »Pragmatism« (1907), in: The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Bd. 2 (1893–1913), hg. durch das Peirce Edition Project (Nathan Houser u.a.), Bloomington und Indianapolis: Indiana University Press, 398–433.
––– (2000a), »Grundbegriffe der Semiotik und formalen Logik«, in: Semiotische Schriften, Bd. 1., hg. und übersetzt von Christian J.W. Kloesel und Helmut Pape, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 336–375.
––– (2000b), »Sicherheit durch Schließen. Deduktives Schließen«, in: Semiotische Schriften, Bd. 3, hg. und übersetzt von Christian J.W. Kloesel und Helmut Pape, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 448–467.
Rusch, Gebhard (1992), »Auffassen, Begreifen und Verstehen. Neue Überlegungen zu einer konstruktivistischen Theorie des Verstehens«, Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2, hg. von Siegfried J. Schmidt, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 214–256.
Scheibmayr, Werner (2004), Niklas Luhmanns Systemtheorie und Charles S. Peirces Zeichentheorie. Zur Konstruktion eines Zeichensystems (= Linguistische Arbeiten 486), Tübingen: Max Niemeyer.
Scherer, Bernd Michael (1984), Prolegomena zu einer einheitlichen Zeichentheorie. Ch. Peirces Einbettung der Semiotik in die Pragmatik (= Probleme der Semiotik 3), Tübingen: Stauffenburg.
Schubart, Christian Friedrich Daniel (1990), Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, hg. von Fritz und Margit Kaiser, 2. Nachdruck der Ausgabe Wien 1806, Hildesheim u.a.: Olms.
Short, Thomas L. (2009), Peirce’s Theory of Signs, New York: Cambridge University Press.
Spencer-Brown, George (2009), Laws of Form. The New Edition of this Classic with the First-Ever Proof of Riemann’s Hypothesis, Leipzig: Bohmeier.
Thorau, Christian (2006), »Symphony in White – Musik als Modus der Referenz«, in: Musik – Zu Begriff und Konzepten. Berliner Symposion zum Andenken an Hans Heinrich Eggebrecht, hg. von Michael Beiche und Albrecht Riethmüller, München: Franz Steiner, 135–150.
Varga von Kibéd, Matthias (2008), George Spencer Brown. Die Unterscheidungstheorie Spencer Browns und die Unterscheidungsformaufstellung, Aachen: Ferrarimedia.
Weiss, Thomas (2004), Die Gebrauchstheorie der Bedeutung im Big Typescript – eine neue Perspektive auf Wittgenstein, Berlin: Tenea.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.