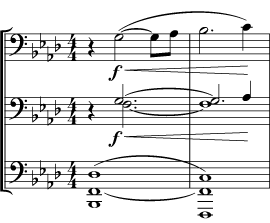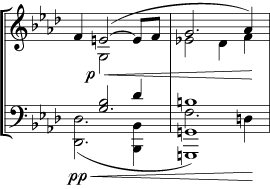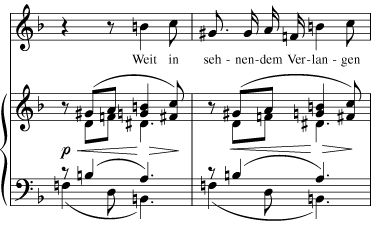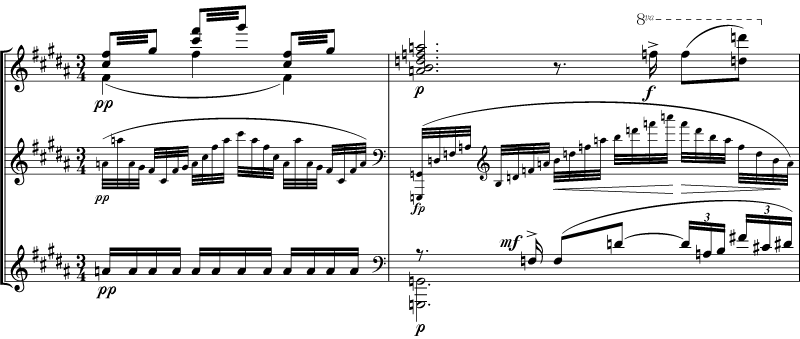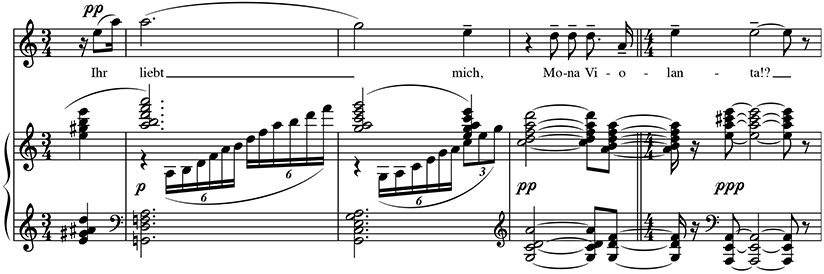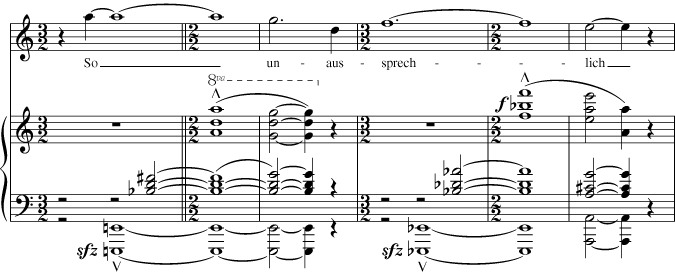Zwischen Schopenhauer und Freud
Ernst Kurths Musiktheorie als hermeneutisches Potenzial
Wolfgang Krebs
Die energetische Musiktheorie Ernst Kurths bedient sich des Modells der Psychodynamik und akzentuiert die unbewußten Anteile des musikalischen Ereignisses. Daraus ergibt sich eine Verwandtschaft zu Sigmund Freuds Psychoanalyse, wenn auch keine direkte Abhängigkeit. Gemeinsam ist beiden die Affinität zur Willensmetaphysik Arthur Schopenhauers, teilweise auch dessen Interpretation der Sexualität. Anhand von Beispielen aus Hugo von Hofmannsthals / Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten und Erich Wolfgang Korngolds Violanta werden Spezifika leittönigen Drangempfindens (unter Berücksichtigung der Terminologie Kurths) als musikalische Indices für Sublimierungs- bzw. Verdrängungsvorgänge interpretiert. Kurths Perspektive enthüllt auf diese Weise ihre innere Nähe zur Psychoanalyse.
Die Musiktheorie Ernst Kurths erhebt den Anspruch, eine Musikpsychologie zu sein. In Kurths (zu seiner Zeit) Aufsehen erregender Schrift Grundlagen des linearen Kontrapunkts mangelt es in der Tat ebenso wenig an Psychologismen wie in seiner ›Harmonielehre‹, der Romantischen Harmonik und seinem Kompendium Musikpsychologie.[1] Das psychologische Element ›erklärt‹ Kurths Ansatz jedoch nicht. Die Erkenntnis der Bedeutsamkeit psychischer Vorgänge für die Musik vollzieht kaum mehr als einen ersten Schritt zum tieferen Verständnis der Grundlagen des Systems. Die These, das wahrhaft Musikalische steige aus den Abgründen des menschlichen Seelendunkels auf, bedarf selbst der Einordnung in die Geschichte der Psychologie und ihrer Vorgänger in der Geistesgeschichte.
Kurths Musiktheorie zehrt unverkennbar von den Akzenten, die um die Wende zum 20. Jahrhundert in psychologischen Fragestellungen dominierten: Psychische Regungen – so die herrschende Meinung – beruhen auf ›Vorgängen‹, die sich nicht sämtlich auf biologische oder chemische Faktoren zurückführen lassen. Das Modell der Psychodynamik besagt, daß menschliches Seelenleben auf ›Kräften‹ (statt auf chemischen Verbindungen oder, wie in den behavioristischen Modellen des späteren 20. Jahrhunderts, auf Konditionierungen) beruhe. Theodor Lipps – der Psychologe, der auf Ernst Kurth einen erheblichen Einfluß ausübte[2] – definierte die Grundlagen der Psyche mit Hilfe der Vokabeln ›Kraft‹ bzw. ›Energie‹. Sigmund Freud sprach von der Libido, die er dann unter vorrangig psychopathologischen Vorzeichen in einen engen Zusammenhang mit dem menschlichen Sexualstreben brachte.[3] Carl Gustav Jung kannte den Begriff ebenfalls, allerdings in der Bedeutung einer allgemeinen psychischen Lebensenergie.[4]
Ernst Kurth ist ein Dynamiker in Fragen des Musikalisch-Psychologischen. Der Theoretiker operiert mit Begriffen wie ›Kraft‹, ›Spannung‹ oder ›Energie‹, um dem musikalischen Phänomen auf den Grund gehen zu können. Kurths Standpunkt läßt sich, kurz gefaßt, wie folgt umreißen: Musik sei keine Anhäufung oder Aneinanderreihung akustischer Schwingungen, sondern ein psychischer Vorgang. Im Mittelpunkt stehe der Eindruck von Bewegung, welche die Psyche in den Einzelton (oder den Akkord) hineindeutet. Paradox formuliert, das wahrhaft Musikalische ist für Kurth das Unhörbare, die Empfindung einer durchgreifenden Spannung in und zwischen den Klängen und Tönen. Das Widerspiel von Stauung und Auslösung von Bewegungsmomenten bezeichnet der Theoretiker als potentielle und kinetische Energie des musikalischen Verlaufes. Die physikalistische Terminologie meint nicht meßbare Größen. Kurth entlehnt die Begriffe »in freier Anwendung« aus der Naturwissenschaft,[5] um den rein psychisch gedachten Eindruck von Bewegung in der Musik – auch ›innere Dynamik‹ genannt – zu beschreiben.
Ein Zentralbegriff der Kurthschen Musikpsychologie ist ›das Unbewußte‹. Auf Veranlassung des akustischen Tonreizes steigen Spannungen bzw. Energien aus der Sphäre psychischer Schichten auf und wandeln die physikalischen Schwingungen der Einzeltöne zu Musik um. Nicht die klangliche Seite des Musikhörens, sondern die innere Dynamik des Empfindens macht für Kurth das musikalische Phänomen aus. Musik ist ein beständig aus der Sphäre des Unbewußten gespeister Eindruck von Bewegung, von Impuls, Entladung, Kraftentfaltung – so die geläufigen dynamistischen Vokabeln, derer sich Kurth zur Beschreibung des psychologischen Phänomens bedient.
Begriffe wie »Drang«[6] oder das ›Drangvolle‹ schließen sich, wie es zunächst scheint, mit der Zentralität des Unbewußten zu einem zeitverhafteten, bis zur Stunde aktuellen therapeutischen System zusammen: Dem unbefangenen, aber psychologisch vorgebildeten Leser Kurths dürfte sich gegenwärtig vor allem die Assoziation zur Psychoanalyse Sigmund Freuds aufdrängen.
Die Vermutung, zwischen Ernst Kurths Musiktheorie und Sigmund Freuds Psychoanalyse bestehe eine Verwandtschaft, enthält nichts Neues. Desgleichen ist nach wie vor die weiter reichende Hypothese virulent, hinter den Ähnlichkeiten zwischen Kurths Akzentuierung des drangvollen Unbewußten beim Musikhören und Freuds metapsychologischen Grundannahmen verberge sich mehr als eine zufällige Parallele.[7] Der Gedanke erscheint zumindest nicht von vornherein abwegig: Freuds Autorität war zwar nie unumstritten, aber doch ein Fixpunkt, an dem psychologisch interessierte Zeitgenossen schwerlich vorbeigehen konnten. Der Musiktheoretiker und der Psychiater stimmten überdies in den Voraussetzungen ihres Denkens (in der Psychodynamik) überein. Und die Erscheinungsform besagten psychischen Dynamismus, das Vorwalten spannungsvoller Grundkräfte, scheint ein Übriges dazu beizutragen, eine besondere Affinität des Kurthschen Systems zu dem des Wiener Psychoanalytikers plausibel zu machen.
Doch läßt sich die Annahme einer Verbindung nicht durch kurzschlüssige Zuordnungen von Begrifflichkeiten klären. Der Nachweis einer direkten Einflußnahme Freuds auf Kurth verlangt mehr als die oberflächliche Parallelisierung. Wie ließe sich eine geistige Abhängigkeit wirklich belegen? Zum einen stünde die philologische Methode zur Verfügung, also der Versuch, in Kurths Schriften, Briefen oder sonstigen Äußerungen Hinweise auf eine rezeptive Verarbeitung dingfest zu machen. Zum anderen könnte man sich notfalls mit der Erkenntnis zufrieden geben, daß Kurth und Freud über das Unbewußte hinaus Gemeinsamkeiten in dessen spezifischer Auffassung pflegten. Gerade diese Gesichtspunkte veranlassen indes, in der Frage des potenziellen Einflußbereiches Vorsicht zu üben:
Kurth bezieht sich, soweit ersichtlich, nicht ausdrücklich auf Sigmund Freud. Das hat mit einer Strategie des Verschweigens wenig zu tun. In der Musikpsychologie beglaubigt Kurth seine Theoreme durch eine Vielzahl an Verweisen, die zitierten Namen gehören meist der psychologischen Fachrichtung zu. Der Fußnotenapparat von Kurths letztem Buch über Musikpsychologie erwähnt Freud jedoch nirgends. Daß der Theoretiker den Namen seines berühmten Zeitgenossen unterschlagen haben sollte, sofern dieser tatsächlich zu seinen nennenswerten geistigen Initialzündungen oder begleitenden Rückversicherungen zählte, darf unter diesen Umständen bezweifelt werden.
Ferner besagt das energetische Konzept nicht, daß die psychodynamische Grundlage des Bewegungsimpulses auf Triebregungen beruht. In der Tradition der Psychoanalyse hängt die ›Dynamik‹ der Psyche mit der Notwendigkeit der Befriedigung zusammen. Der Lebens›trieb‹ kann sich sowohl auf Lebensnotwendigkeiten beziehen, als auch, wie im Sexualstreben, auf die Sicherung der Fortdauer über das eigene biologische Ende hinaus. Kurths Konstrukten zufolge verfügt der ›musikalische‹ Mensch gleichfalls über ein Potenzial, welches sich im Zusammenhang mit einer von außen gegebenen ›Motivation‹ – eben der einströmenden Klangschwingungen – in Bewegung setzt. Dennoch geht Kurth nicht von bestimmten Trieben aus. Auch konzipiert er, trotz mancher Anklänge, keine Bewältigung der psychischen Gespanntheit durch Befriedigungen. Seine ›Energie‹ äußert sich nicht in Bedürfnissen des inneren musikalischen Reservoirs, welches sich vermittels akustischer Reize ›abreagiert‹.
Kurths Theorie intendiert des weiteren kein Programm, welches sich verborgene Antriebe des Unbewußten ins Bewußtsein holt, um dort steuernd einzugreifen. Der Ansatz verfährt in einem wesentlichen Punkt nicht psychoanalytisch, sondern synthetisch. Nicht, daß der Musiktheoretiker psychischen Erkrankungen nachzuforschen unterläßt, ist das Problem; das wäre nicht seines Amtes gewesen. Sondern daß bei Kurth die psychisch-musikalische Energie alsbald im Dunkel einer gefühlten Lebensenergie verschwindet, die als solche der ferneren rationalen Durchdringung nicht zugänglich ist.
Die Rolle des Unbewußten betonten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche Psychodynamiker, auch solche, die der Psychoanalyse Freuds fern standen. Daß Psychologen von vorbewußten Schichten ausgingen, in denen sich meist unerkennbare ›Vorgänge‹ abspielen, deutet also nicht notwendig auf Verwandtschaft mit Freuds Gedanken. Ebenso gut könnte man behaupten, Kurths Vorstellungen von psychischer Energie ständen dem Libido-Begriff Carl Gustav Jungs näher als demjenigen Freuds. Die psychologische Fundierung des musikalischen Erlebens läßt den spezifischen Halt an der für den Psychoanalytiker Freud charakteristischen Ausrichtung am Sexuellen vermissen.
Daß Kurth die Psychoanalyse nicht rezipiert habe, ist zwar eher unwahrscheinlich. Doch die Möglichkeit der Kenntnis sagt für sich genommen wenig über die Voraussetzungen des Systemaufbaues aus. Die Analogie von Kurths Energie- und Freuds Libido-Begriff mag nahe liegen. Doch daraus folgt nur eine Entsprechung des psychodynamischen Grundmodells, mehr – zunächst einmal – nicht.
Kurth und Freud wurzeln andererseits bis zu einem gewissen Grade in gemeinsamen weltanschaulich-philosophischen Traditionen. Beide verband die Affinität zur Willensmetaphysik Arthur Schopenhauers. Schopenhauer war einer der einflußreichsten Philosophen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges hinein. Sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung kulturprägend zu nennen, dürfte mit Bezug auf diesen Zeitraum kaum eine Übertreibung darstellen. Der Eindrucksmacht des pessimistischen Weltverständnisses entzogen sich im frühen 20. Jahrhundert nur wenige unter den Künstlern und den Vertretern der Geistesgeschichte.
Schopenhauers Philosophie geht von der Existenz eines blinden, weltumspannenden Dranges, des metaphysischen ›Willens‹ aus. Der Wille als (in Kants Sprache) Ding an sich durchdringt die empirisch erfahrbare Wirklichkeit und sucht sich in den Besonderheiten der Naturkräfte (Gravitation), der pflanzlichen und tierischen Gattungen und dem menschlichen Streben nur seine äußere Form. Der Wille zum Leben manifestiert sich bei Schopenhauer in einem unstillbaren ruhelosen Drängen, in dem Wunsch nach Erhaltung des Individuums und der Gattung. Und er tendiert dazu, die Willensregungen anderer Erscheinungen des Weltwillens zu ignorieren. Auf diesem Weltbild fußt Schopenhauers metaphysischer Pessimismus. Im Zeichen des ungezügelten Willens (der nur notdürftig durch Sitte, Kultur und vor allem durch die Strafjustiz des Staates im Zaum gehalten wird) herrschen unter den Menschen wie in der gesamten Natur Gewalt, Mord, Krieg und Tod.
Schopenhauer vertritt eine ›dynamische‹ Weltsicht. Sie trieft zwar von Blut, aber sie akzentuiert auch das ewig Schöpferische im endlos unbefriedigten Weltdrang nach Dasein und Wohlsein. Darin eingeschlossen ist der gierige Wunsch von Mensch und Tier, sich fortzupflanzen, wie der Philosoph in der Metaphysik der Geschlechtsliebe ausführt.[8] Schopenhauer beschreibt Sexualität als »Leidenschaft«, die unter Umständen »an Heftigkeit jede andere übertrifft, und dann alle Rücksichten beseitigt, alle Hindernisse mit unglaublicher Kraft und Ausdauer überwindet, so daß für ihre Befriedigung unbedenklich das Leben gewagt, ja, wenn solche schlechterdings versagt bleibt, in den Kauf gegeben wird.«[9] Entsprechend dunkle, ja dämonische Züge könne die Geschlechtsliebe annehmen: Es handle sich um einen Trieb, welcher
»die Hälfte der Kräfte und Gedanken des jüngern Theiles der Menschheit fortwährend in Anspruch nimmt, das letzte Ziel fast jedes menschlichen Bestrebens ist, auf die wichtigsten Angelegenheiten nachtheiligen Einfluß erlangt, die ernsthaftesten Beschäftigungen zu jeder Stunde unterbricht, bisweilen selbst die größten Köpfe auf eine Weile in Verwirrung setzt, sich nicht scheut, zwischen die Verhandlungen der Staatsmänner und die Forschungen der Gelehrten, störend, mit ihrem Plunder einzutreten, ihre Liebesbriefchen und Haarlöckchen sogar in ministerielle Portefeuilles und philosophische Manuskripte einzuschieben versteht, nicht minder täglich die verworrensten und schlimmsten Händel anzettelt, die werthvollsten Verhältnisse auflöst, die festesten Bande zerreißt, bisweilen Leben, oder Gesundheit, bisweilen Reichthum Rang und Glück zu ihrem Opfer nimmt, ja, den sonst Redlichen gewissenlos, den bisher Treuen zum Verräther macht, demnach im Ganzen auftritt als ein feindsäliger Dämon, der Alles zu verkehren, zu verwirren und umzuwerfen bemüht ist.«[10]
Da der metaphysische Wille der Existenz vorausliegt, kann Schopenhauer als Philosoph auch schreiben: Schon die ersten zarten, sehnsüchtigen Blicke, die sich Mann und Frau zuwerfen, seien keine individuellen Regungen, sondern »eigentlich schon der Lebenswille des neuen Individuums«, des Kindes, welches ins Leben treten wolle. Sexualität entscheide also über »nichts Geringeres, als (über) die Zusammensetzung der nächsten Generation.«[11]
Erotisches Streben sei, so Schopenhauer als Philosoph, der individuelle »Wille des Einzelnen in erhöhter Potenz, als Wille der Gattung«.[12] Der Wille zum Leben suggeriert dem Individuum, sein sexuelles Wollen befriedige den eigenen Willen. Damit dieses Individuum die Interessen der Gattung über den Tod des Einzelnen hinaus gebührend berücksichtige, greift die Natur also zu einer List. Sie spiegelt dem Einzelnen die Möglichkeit von Erfüllung vor, aber nur so lange, bis die eigentlichen Absichten (die Zeugung eines neuen Kindes) erfüllt sind. Diese List nennt Schopenhauer ›den Wahn‹:
»Dieser Wahn ist der Instinkt. Derselbe ist, in den allermeisten Fällen, anzusehn als der Sinn der Gattung, welcher das ihr Frommende dem Willen darstellt. Weil aber der Wille hier individuell geworden; so muß er dergestalt getäuscht werden, daß er Das, was der Sinn der Gattung ihm vorhält, durch den Sinn des Individui wahrnimmt, also individuellen Zwecken nachzugehn wähnt, während er in Wahrheit bloß generelle (dies Wort hier im eigentlichsten Sinn genommen) verfolgt.«[13]
Dieser Zweck der Natur zieht für Schopenhauer eine Prozedur des Auswahlverfahrens unter den Liebenden nach sich, die – vorsichtig formuliert – darwinistischen Zuchtwahlkonzepten durchaus nahe steht. Pessimist, der er ist, zeichnet Schopenhauer darüber hinaus ein deprimierendes Bild der ›sexuellen Realität‹: Wie kaum ein Anderer schildert der Philosoph die Unmöglichkeit des Glückes durch Erotik, ihren Trug und den torturierenden Charakter als innere Spannung, die auf Befriedigung drängt, sich aber danach enttäuscht zeigt und neue Ziele des Begehrens sucht.
Schopenhauer prägt die willensmäßige Fixierung durch Sexualität, die Freud dann Besetzung eines menschlichen Objektes mit Libido nennen wird, deutlich vor. Zudem betont der Philosoph deren Bedeutsamkeit: »Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch geberden mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe, ja, ist durchaus nur ein näher bestimmter, specialisirter, wohl gar im strengsten Sinn individualisirter Geschlechtstrieb.« Sexualität sei eben, »nächst der Liebe zum Leben, [...] die stärkste und thätigste aller Triebfedern«.[14] Und sie stehe auch der Pathologie offen: Der erotische Trieb greife zu Vergewaltigungen, provoziere einseitige oder gemeinschaftliche Selbstmorde, führe gelegentlich »im Fall die Erfüllung unabänderlich versagt bleibt, zum Wahnsinn« oder »ins Irrenhaus«.[15] Schopenhauer stellt die sexuelle Leidenschaft also in den Kontext klinischer Phänomene, wenngleich nicht in der Form einer wirklich therapeutischen Auseinandersetzung mit dem Thema.
Sigmund Freuds Menschenbild dürfte in keinem Punkt dem Philosophen näher stehen als in dem der Relevanz des Sexualtriebes. Der Psychoanalytiker hat denn auch die Vorgängerschaft zum eigenen metapsychologischen Modell hervorgehoben. In seinem Aufsatz Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse bekennt er:
»Die wenigsten Menschen dürften sich klar gemacht haben, einen wie folgenschweren Schritt die Annahme unbewußter seelischer Vorgänge für Wissenschaft und Leben bedeuten würde. Beeilen wir uns aber hinzuzufügen, daß nicht die Psychoanalyse diesen Schritt zuerst gemacht hat. Es sind namhafte Philosophen als Vorgänger anzuführen, vor allem der große Denker Schopenhauer, dessen unbewußter ›Wille‹ den seelischen Trieben der Psychoanalyse gleichzusetzen ist. Derselbe Denker übrigens, der in Worten von unvergeßlichem Nachdruck die Menschen an die immer noch unterschätzte Bedeutung ihres Sexualstrebens gemahnt hat.«[16]
Freuds ›Gleichsetzung‹ der Willenskonzeption mit seinen eigenen Triebtheorien sollte nicht dazu verführen, Schopenhauer ohne weiteres in die Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse einzuordnen. Der philosophische Ansatz verlieh der Entwicklung psychoanalytischer Verfahren nicht die allein entscheidenden Impulse. Die Schwierigkeiten, Schopenhauer ins Vorfeld der Klinischen Psychologie Freuds einzuordnen, wurden bereits ausführlich untersucht.[17] Daß Freud jedoch zahlreichen Psychologismen Schopenhauers zustimmen konnte, die den menschlichen Trieb über die Vernunft, die Macht des Willens über diejenige des Intellektes, das Sexualstreben über die gesellschaftliche Konvention stellten, dürfte unstreitig sein.
Ernst Kurth bekennt sich in der Romantischen Harmonik seinerseits zur Willensmetaphysik Schopenhauers. Kurth befindet dort:
»Die Musik ist [...] keine Spiegelung der Natur, sondern das Erlebnis ihrer rätselhaften Energien selbst in uns; die Spannungsempfindungen in uns sind das eigentümliche Verspüren von gleichartigen lebendigen Kräften, wie sie sich im Uranfang alles physischen und organischen Lebens offenbaren.«
Und in einer Fußnote zu diesen Sätzen, die sich besonders auf das ›Uranfängliche‹ bezieht, schreibt der Theoretiker:
»Im Lichte von Schopenhauers Weltlehre [...] würde sich die Gleichartigkeit dieser Kräfte so darstellen, daß sie überhaupt als identischen Ursprungs anzusehen wären und nur verschiedene Objektivationen der gleichen Urkraft, des ›Willens‹, darstellen. [...] Auch Schopenhauers Anschauung vom Wesen der Musik ›als unmittelbaren Abbilds des Willens selbst‹ findet ihre Bestätigung in der Gleichartigkeit vom Charakter der ursprünglichsten musikalischen Spannungen mit Bewegungsempfindungen, von psychischen Empfindungsenergien mit physischen Kräftevorgängen.«[18]
Daß Kurth die fundierende Wirkung des Systems wie beiläufig erwähnt, verweist nicht auf die Marginalität des Einflusses. Die Fußnoten-Form der Erwähnung des Namens Schopenhauers steht in deutlichem Kontrast zur ›Willens-Atmosphäre‹, von der die Romantische Harmonik durchgängig geprägt ist. Aussagen wie die folgenden stehen dafür ein:
»Die Urform musikalischer Willensregung [...] sind psychische Spannungen, die nach Auslösung in Bewegung drängen; alles musikalische Geschehen beruht in Bewegungsvorgängen und ihrer inneren Dynamik.«[19]
Oder, an anderer Stelle: Nicht etwas »materiell Vorhandenes« mache die Wirkung der Musik aus, sondern vor allem »der Wille«.[20] Mehr als die übrigen Schriften Kurths durchwirkt die Romantische Harmonik ein eigentümlich metaphysisch-erotisches Fluidum, wenn die Rede auf Fluktuationen von Spannungen oder Energien kommt. Und dies hat, entgegen vordergründig möglicher Deutungen, nicht allein damit zu tun, daß in Kurths Buch das Liebesdrama Tristan und Isolde von Richard Wagner eine herausragende Position einnimmt.
Der Wille im Sinne Schopenhauers kehrt bei Kurth zwar in psychologischen Kategorien wieder. Doch die psychische Energie, welche die Voraussetzung des Musikalischen bildet, hängt doch stets mit einer ›Lebensenergie‹ zusammen, die sich auch in anderen als auf musikalischen Gebieten äußert. Kurth rezipierte die Philosophie Schopenhauers primär als weltanschaulichen Hintergrund, nicht als Quelle für psychologische Wegweisungen. Daher die für die Zeit nach der Jahrhundertwende signifikante Bemerkung, daß seine eigene Theorie mit der – so wörtlich – »Weltlehre« Schopenhauers kongruiere. Die Einzelheiten des Seelenlebens, die Kurth aus der Welt als Wille und Vorstellung ohne weiteres ebenfalls hätte ermitteln können, würdigt der Musiktheoretiker keiner näheren Betrachtung. Auch die krankhaften Arten der Willensäußerungen bleiben unbeachtet.
Eine Verwandtschaft zwischen Kurths Theorie und Freuds Psychoanalyse ist daher nicht direkt über die ›Wurzel‹ Schopenhauer hinlänglich begründbar. Bloße Übereinstimmungen in der Rezeption geistesgeschichtlicher Ereignisse besagen über Kongruenzen ohnedies wenig.[21] Im Falle Kurths und Freuds tritt erschwerend hinzu, daß beide von einer recht verschiedenen Interessenlage ausgingen. Was der Psychoanalytiker an Schopenhauer hervorhob: die Pathologie des Willens, die unbewußten Triebe des Sexus, war für Kurth peripher. Und was Kurth an der Willensphilosophie faszinierte: das metaphysische Weltbild, war nun wiederum für den Positivisten Freud ohne Belang. Im Kernpunkt des Schopenhauerschen Denkens, in der Frage der Bejahung oder Verneinung des Willens, trennten sich schließlich endgültig die Wege der beiden Psychologen. Schopenhauers Pessimismus fand bei Freud durchaus Resonanz,[22] nicht aber bei Kurth. Dazu war der Musiktheoretiker zu sehr Willensbejaher, zu sehr ›Lebensphilosoph‹.
Dennoch nahm die Denkungsart Schopenhauers mancherlei analogen Einfluß auf Kurth und Freud. Spezifische Kennzeichnungen der inneren Dynamik und deren Beziehung zu den Objekten jenseits der menschlichen Psyche weisen auf verborgene Entsprechungen hin. Kurths Musikpsychologie entwirft ein Widerspiel von Spannung und Lösung im musikalischen Erleben, die (vielleicht vermittelt über Schopenhauers Vorstellung von Willensregung und Befriedigung) immerhin bis zu einem gewissen Grade an Freuds Spannungsreduktionsmodell gemahnt. Die Gemeinsamkeit besteht in Folgendem: Die Psychodynamik bringe eine innere Gespanntheit mit sich, welche es ›abzubauen‹ gelte bzw. einem natürlichen Abbau zustrebe. Die entsprechende Dranghaftigkeit sei auf ein Objekt gerichtet (bei Kurth der musikalische Zusammenhang, bei Freud das libidinös Besetzte). Die Lösung des Dranges erfolge mit der Erreichung des Begehrten, welches doch nur ein vorläufiger Ruhepunkt im endlosen Fortbestand stets neuer Zustände der Spannungsakkumulation und -lösung sei. Das Vorhandensein von psychischer Spannung wertet Kurth zwar nicht als Quantum, welches sich durch Inanspruchnahme ›verbraucht‹. Und doch strebt dieser Zustand auch bei ihm zur Selbstauflösung. Vorstellungen von Lust und Unlust thematisiert der Theoretiker nicht primär, aber sie spielen in seine Beschreibungen hinein.[23]
Das Problem der Spannungsintensität und deren Auslösung in Bewegung sei an einem Beispiel aus Richard Wagners Tristan und Isolde näher erläutert, welches Kurth in der Romantischen Harmonik einer Kurzanalyse unterzieht.
* * *
Die innere Dynamik einer wagnerschen oder nachwagnerschen Partitur differiert stilistisch von der Bachschen Kontrapunktik, trotz gleichartiger ›energetischer‹ Wurzel. Kurth operiert in diesem Punkt mit Hilfe einer geschichtsphilosophisch anmutenden Konstruktion:[24] Die Zeit Haydns und Mozarts habe den vorübergehenden Sieg der Vertikalen über den Kontrapunkt und damit die Dämpfung innerer musikalischer Dynamik mit sich gebracht. Deren Wiedergewinnung gelang dem 19. Jahrhundert nicht durch eine Rückwendung zur Stilistik Johann Sebastian Bachs. Die Komponisten der Nachklassik hatten sich am klassischen Erbe abzuarbeiten, also am Klang. Eben diesen mußten sie mit psychischer Dynamik neu durchwirken. Was zur Zeit des Thomaskantors der lineare Kontrapunkt leistete, falle im 19. Jahrhundert als Aufgabe der Chromatik anheim. Wichtige Teilmomente des neuen, nachklassischen Tonsatzes bilden für Kurth die Leittöne und Nebentoneinstellungen als Male der romantischen Harmonik. Ihre Krise (Kurth meint: die Kulmination) erreiche die Chromatik in Richard Wagners Tristan und Isolde.
Das berühmte Tristan-Hauptmotiv:
Beispiel 1: Richard Wagner, Tristan und Isolde, Tristan-Hauptmotiv, T. 1–3
erscheint zu Beginn des dritten Tristan-Aufzuges in einer diatonisierten, lastend schwer wirkenden Variante:
Beispiel 2: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 3. Aufzug, T. 1–2
Wagner verleiht der Motivvariante in weiteren Verlauf des Vorspieles auch eine formale Funktion. Dazu dienen relativ einfache Tonika-Dominant-Verhältnisse inmitten der allgegenwärtigen Tristan-Chromatik. Der Linienzug in T. 1–15 vollzieht eine Tonika-Dominante-Öffnung auf der Basis von f-Moll. Die harmonische Entwicklung durchläuft die Stadien f-Moll-I (mit vorherigem Quintsextakkord[25] – As-Dur mit Beginn des sogenannten Motivs der Liebesentbehrung (T. 11) – C7 als öffnende Dominante in f-Moll. In T. 16 setzt Wagner wieder mit der IV. Stufe in f-Moll an (formal rückbezüglich auf T. 1), führt die Progression bei sonst analogem Material diesmal nach Des-Dur (T. 26) und einen Septklang über G in zweiter Umkehrung (T. 30). Dann komponiert Wagner nicht, wie noch in T. 16, einen formal wirksamen Bezugspunkt durch die Wiederkehr der IV. Stufe, sondern eine charakteristische Abwandlung:
Beispiel 3: Richard Wagner, Tristan und Isolde, 3. Aufzug, T. 30–31
Wagner läßt die lineare Diatonisierung aus T. 1 des Vorspieles zum dritten Aufzug in das neue Motiv hineinspielen (Diskantschritte: e-f-g-as, also Halbton-Ganzton-Halbton mit Ersetzung eines Ganztonschrittes durch einen Halbtonschritt unter Beibehaltung des anderen). Zudem nimmt T. 30–31 formal die Position ein, die ein mögliches ›drittes‹ Erklingen des Materials aus T. 1 nahegelegt hätte. Wagner aber intensiviert nun das Motiv, welches zu Beginn des Aufzuges eher nur den Eindruck von Schwere hinterläßt. Es erhält einen Halbton mehr und nähert sich darum dem Ursprung des Motivs an (welches im Diskant aus drei Halbtonschritten besteht, vgl. Bsp. 1).
Kurth analysiert dieses Klangpaar wie folgt:
»Klangunterlage ist für beide Takte der Nonenakkord g-h-d-f-as [...] Im vorliegenden Beispiel verzerren zuerst drei frei eintretende Leittoneinstellungen die Form des Spannungsakkords: der erste Motivton e vor dem f, ferner die chromatischen Spannungstöne des (= cis) zu d und b (ais) zu h; der Überblick ist dadurch erschwert, daß die Lösung der Spannungstöne nicht überall an die gleiche Stimme gebunden bleibt. Mit dem Beginn des zweiten Taktes erscheint noch ein es leittonartig vor d [...] Hier zeigt sich somit, daß nicht nur ein Septakkord, sondern auch ein Nonenakkord nach den vorangehenden Dissonanzenergien der mehrfachen Alterationsbildungen lösungsartig wirkt. Höchst beachtenswert ist hierbei, wie sogar im zweiten Takt das g der Hauptstimme im motivischen Zusammenhang, obwohl es zugleich Grundton ist, vorhaltsartig zur None as wirkt, noch dazu zur stark dissonierenden kleinen None, und diese erscheint dem Grundton gegenüber als Auflösung; so groß ist das Übergewicht der Spannungsverhältnisse über die klanglichen Erscheinungen. (Zugleich einer der zahllosen Fälle, wo sich im gleichen Ton verschiedene dynamische Inhalte kreuzen.)«[26]
Leittöne und Nebentoneinstellungen sind gleichermaßen musikalische Impulse und konkretisieren ein Drangempfinden im akustisch Wahrnehmbaren des Einzeltones. Während erstere dazu tendieren, aus dem Gesamtklang herauszuleiten, drängen sich letztere eher in ihn hinein. Anders gesagt, ›Nebentöne‹ sind für Kurth frei eintretende Vorhalte.[27] In Beispiel 3 (s.o.) ist es Nebenton zu d. Der Diskantton g aber treibt zu as, einem Lösungston, der klanglich gesehen eigentlich dissoniert. Kurth spricht in der Musikpsychologie auch von »Distendenz«, um das Forttreiben eines Tones nicht sekundär aus klanglichen Verhältnissen einer Tonreibung ableiten zu müssen.[28] Die Spannkraft der Distendenz geht über die Intensität hinaus, die Wagner zu Beginn des dritten Aufzuges komponiert. Es gibt keine reguläre Auflösung, selbst die Oktave ist neutralisiert und durch ›die Tendenz‹ zur wiederum dissonanten Note überlagert (die Distendenz schlägt in Dissonanz um, könnte man mit Kurth sagen).
Den Klang über G durchziehen also verstärkte Strebungen, die einer Intensivierung des Spannungsempfindens gleichkommen. Bezeichnend auch, daß Wagner darauf verzichtet, eine Klangprogression wie in T. 1ff. zu komponieren. Der G-Klang verbleibt, gleichsam gefangen in sich, bis T. 37. Sämtliche Nebentöne leiten in den Klang zurück bzw. intensivieren ihn in seiner Nonenstruktur. Der weitere Verlauf kennt weit weniger tonikale Stützpfeiler als der Beginn des Vorspieles.
Aber was bedeutet diese Intensivierung? Hinweise darauf geben dramatisch-musikalische Bezüge, in denen die Variante innerhalb der Symphonik des dritten Aufzuges erscheint, aber auch die eigentliche Herkunft dieses Akkordpaars. Wagner komponiert im Schlußakt des Tristan besagte Variante an folgenden Stellen:
Kl.A. | Person | Text |
229/5–7 | - | - |
247/2–4 | Tristan | Weh, nun wächst, bleich und bang, mir des Tages wilder Drang; grell und täuschend sein Gestirn weckt zu Trug und Wahn mir das Hirn! |
271/2–3 | Tristan | O dieser Sonne sengender Strahl, wie brennt mir das Hirn seine glühende Qual! |
Tabelle 1: Legende
Man könnte vermuten, die Variante sei ein Ausfluß musikalisch-›schopenhauerischen‹ Denkens. Die Stelle »O dieser Sonne sengender Strahl« setzt die Maxime der pessimistischen Philosophie in dramatische Verse um: In der Form der Vorstellung (bei Tage, unter der Sonne) ist jede Willensregung ein endloses Sich-Quälen und unstillbares Begehren. Darum der heraufgesetzte Spannungsreichtum des Akkordpaars. Andererseits sollte nicht außer Betracht bleiben, daß diese Klangverbindung aus dem Wesendonck-Lied Im Treibhaus auf den Tristan übergegangen ist. Und dort fällt sie bezeichnenderweise mit der Verszeile: »Weit in sehnendem Verlangen breitet ihr die Arme aus, und umschlinget wahnbefangen öder Leere nicht’gen Graus« zusammen:
Beispiel 4: Richard Wagner, Im Treibhaus, T. 21ff
Der Bezug zu dieser ›Tristan-Studie‹, die sich nahezu vollständig im dritten Aufzug des Musikdramas wiederfindet, semantisiert Wagners Klangverbindung. Er eröffnet die Möglichkeit, die Intensivierung im dritten Tristan-Vorspiel ein musikalisches Zeichen für Erotik – mit Freud: als wilden Drang, als Leidenschaft der Psyche – zu deuten. Einfache Chromatik reicht hierzu nicht aus, denn der Tristan ist von ihr allgemein durchdrungen.
Konvergiert aber ›intensivierte psychisch-musikalische Energie‹ mit der Vorstellung des Erotisch-Unerfüllten, fällt es nicht schwer, über die Klammer Schopenhauer Kurths Analyse einen libidinösen Beiklang abzulauschen. Daß Kurth an Beispielen gesteigerter Erotik seine energetischen Leittoninterpretationen exemplifiziert, rückt sie in die Nähe der Freudschen Psychoanalyse. Nicht daß ein Drangempfinden überhaupt vorhanden ist, macht die Interpretation mit Freud vergleichbar. Sondern daß der ›Drang‹ eine musikalische Steigerung gerade dort erfährt, wo Freud (und Schopenhauer, der den Geschlechtstrieb den »Brennpunkt des Willens« nannte[29]) die Quelle menschlicher Triebregung lokalisieren.
So fern Kurth der Pessimismus Schopenhauers und Freuds letztlich lag: Das Drangvoll-Energetische in der Musik setzt die Unerfüllbarkeit und, wo der erotische Trieb ins Spiel kommt, auch das Leiden mit. Trotz aller Unterschiede in der Auffassung und Gewichtung psychischer Phänomene berühren sich Kurth und Freud in diesem, man könnte sagen ›schopenhauerischen‹ Punkt.
* * *
Es wäre ein Einfaches, expressive Details aus den Partituren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als Ausflüsse erotischer Triebregungen aufzufassen und sie in Kurths Termini des ›Dranges‹ oder des Unerfüllbaren zu interpretieren. Ob dies sehr weit führen würde, ist eher zweifelhaft. Denn die entsprechende Hermeneutik würde den Glauben voraussetzen, daß die Libido als sexuelle Energie tatsächlich, wie Freud annimmt, die menschliche Psychodynamik beherrsche. Als bloße Hilfsvorstellung besagt diese Annahme aber nichts im Sinne einer Verwandtschaft der Musikpsychologie Kurths mit Freud.
Es gibt jedoch einen anderen Weg, Ernst Kurths Theoreme für psychoanalytische Interpretationen musikalischer Kunstwerke fruchtbar zu machen. Kurth selbst zeigt ihn in einem Kapitel der Romantischen Harmonik auf, welches mit dem bezeichnenden Titel Der Klang als Symbol überschrieben ist. Zum Tristanakkord schreibt Kurth dort:
»Daß der symbolische Sinn des einzigartigen Einleitungsklanges, wie schon aus dem Vorspielhöhepunkt am deutlichsten hervorging, ganz allgemein das Unerfüllbare, die Unerlöstheit des Liebessehnens bedeutet, erweist auch im Einzelnen seine leitmotivische Verwendung; man kann ihn als die Grundspannung des ganzen Dramas bezeichnen, als seine ›Not‹. Erster Akkord ist er daher nicht nur seiner Stellung im Vorspiel nach, die qualvoll zerrissene Grundstimmung des Werkes findet in ihm mit einem einzigen Klangreflex ersten und unmittelbarsten Ausbruch. Er hat etwas vom Ausdruck eines kranken Blickes. Ob helleuchtend oder nur schattenhaft, mit seiner unheimlichen Verhaltenheit streicht der Klang wie das Schicksal überall durch das Musikdrama, wo die Unerlöstheit aus den Worten der Dichtung herauftönt.«[30]
Anders gesagt: Die psychische Energie, die bei Kurth in den Ton ›gedeutet‹ wird und diesen zum Teil des musikalischen Verlaufes macht, ›be-deutet‹ auch etwas. In der Sprache der Semiotik: Auf ihrer Basis entwickeln sich Zeichen, Indices oder musikalische Symbole. Kurth gesteht dem Empfinden von Spannung und Bewegung zu, für konkrete, benennbare Spannungen und Bewegungen zu stehen. Das betrifft auch die menschliche Sexualität. Kurth behandelt die musikwerdende psychische Dynamik nicht in erster Linie als Ergebnis von sexueller Energie, sondern – wenn von Erotik die Rede ist – als Symbol für sexuelle Energie.
Sexualität und ihre Formen in der Musik sind lohnende (und zweifellos unerschöpfliche) Themen für energetisch-psychoanalytische Betrachtungsweisen.[31] Sie gelingen vor allem bei Bühnenwerken mit einschlägigem stofflichen Gehalt. Im Rahmen der Psychoanalyse interessieren auch die Abarten, die krankhaften oder exzentrischen Äußerungen. Die analytische Bewußtmachung von gestörter bzw. unterbundener Sexualität wirft zahlreiche Fragen auf. Was geschieht mit einem erotischen Impuls, der sich nicht ausleben kann oder will? In der Tradition Freuds gibt es zwei Möglichkeiten der Bewältigung: Verdrängung oder Sublimierung. Beide Strategien kennen wiederum vielfältige Formen der Realisierung.
Im Zusammenhang mit der Wandelbarkeit der erotischen Triebe seien zwei Teilaspekte Kurthscher Musiktheorie näher untersucht:
der Umschlag der Klangenergie ins ›Impressionistische‹,
das Moment der ›Zersetzung‹ von Klang.
Die dramatische Musik des frühen 20. Jahrhunderts enthält Hinweise darauf, daß diese beiden Momente bewußt eingesetzt wurden, um mit ihrer Hilfe gleichsam ›freudianische‹ (oder allgemeiner: psychoanalytische) musikalische Symbolik zu erzeugen.
* * *
Hugo von Hofmannsthals und Richard Strauss’ Bühnenwerk Die Frau ohne Schatten behandelt das Thema Sexualität differenziert und in geistesgeschichtlich weit in die Vergangenheit zurückreichenden Dimensionen. Das Symbol des fehlenden Schattens meint Unfruchtbarkeit, in der damals üblichen Sprache der Lebensphilosophie: Lebensferne, Abgeschlossenheit gegenüber dem ewigen Werden. Hofmannsthal mischt dem Zusammenhang sogar ein indisches Element durch den Rückgriff auf Vorstellungen der Wiedergeburt bei: Zum Ende des ersten Aufzuges läßt er, ›griechisch‹ kommentierend, die Wächter in den Straßen rufen:
»Ihr Gatten in den Häusern dieser Stadt,
liebet einander mehr als euer Leben
und wisset: Nicht um eures Lebens willen
ist euch die Saat des Lebens anvertraut,
sondern allein um eurer Liebe willen! [...]
Ihr Gatten, die ihr liebend euch in Armen liegt,
ihr seid die Brücke überm Abgrund ausgespannt,
auf der die Toten wiederum ins Leben gehn!
Geheiligt sei eurer Liebe Werk!«[32]
Strauss komponiert diesen Lebensbogen choralartig in As-Dur, in einer Melodie, die sich zugleich erhaben (heilig) durch langsames Tempo, aber auch als ununterbrochenes Kontinuum über den Text ausbreitet.[33] Ausgreifendes Melos ist für Strauss allgemein charakteristisch, besonders gegen Ende seiner Werke neigt er dazu. Nicht immer meint der Komponist also ›Erhabenheit der Erotik‹. In vorliegendem Falle aber semantisieren die Verse Hofmannsthals den musikalischen Fluß.
Umso bezeichnender, daß Strauss an anderen Stellen seiner Partitur den Charakter des Fließenden absichtsvoll stört und unterbricht.
Das Verhältnis zwischen Barak und seiner Frau – dem niederen Paar in Hofmannsthals Dramaturgie gegenüber dem Kaiser und der Kaiserin – ist zerrüttet. Den Vorgang als Ehekrise zu werten, wäre indes zu banal. Denn der Dichter thematisiert die Frage nach dem ›Leben‹, das philosophische Ineinssetzen von Schönheit und Tod spielt eine gewichtige Rolle. Kinderlosigkeit verweigert sich den Forderungen des Werdens und Vergehens. Wie ist der Verlust ersetzbar? Zum Teil durch die typischen Fin-de-siècle-Attribute der Schönheit und des Schmucks.
Der erste Aufzug des Musikdramas bringt den Handel um den Schatten der Färberin. Reichtum und Schönheit sollen das Geschäft beflügeln. Die Amme – in der Frau ohne Schatten Trägerin des Prinzips der Lebensferne – trifft mit ihren Angeboten durchaus den Nerv der ›Handelspartnerin‹. Die Färberin erlebt eine kurze Vision ihrer, so könnte man sagen, ästhetischen Erhöhung. Text und Szenenanweisung legen den Vorgang wie folgt fest:
»DIE AMME Verstattest du, ich schmücke dich!
(Sie legt ihr die Hand auf die Augen, sogleich ist sie selbst samt der Frau verschwunden. An Stelle des Färbergemaches steht ein herrlicher Pavillon da, in dessen Inneres wir blicken: es ist das Wohngemach einer Fürstin. Der Boden scheint mit einem Teppich in den schönsten Farben bedeckt, doch sind es Sklavinnen in bunten Gewändern. Sie heben sich nun von der Erde, lauschen kniend nach rückwärts. rufen mit süssen, wie ein Glockenspiel ineinanderklingenden Stimmen)
DIENERINNEN Ach, Herrin, süsse Herrin! Aah!
(Durch eine kleine Tür rückwärts, links, tritt die Frau, geführt von der Amme, in das Gemach. Sie ist fast nackt, in einen Mantel gehüllt, gleichsam aus dem Bade kommend; sie trägt das Perlenband ins Haar gewunden. Sie geht mit der Amme durch die knienden Sklavinnen quer durch, an einen grossen ovalen Metallspiegel, der rechts vorne steht. Dort setzt sie sich und sieht sich mit Staunen.)«[34]
Die immanente Erotik der Szene geht nicht nur aus der Verhandlung um den Schatten hervor, sondern auch aus den visionären Szenenbildern. Die Frau Baraks »ist fast nackt, in einen Mantel gehüllt, gleichsam aus dem Bade kommend«[35] und ergeht sich in der Orgie an Schönheit.
Strauss komponiert zur Einleitung dieser Teilszene eine Klangfolge, die sich sowohl auf die Szenerie der ausgebreiteten Schönheit als auch auf das ihr beigegebene erotische Element zu beziehen scheint:
Beispiel 5: Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten, Kl.A. S. 98, Ziffer 84, T. 1–2
Dem fis-Moll-Klang folgt ein Nonakord g-h-d-f-a, diesem wiederum der Neuansatz mit fis-Moll. Im weiteren Verlauf erfüllt das Akkordpaar auch Formfunktionen. Die Wiederholung der Takte 1–2 von T. 3 nach Ziffer 84 an spricht dafür, ebenso die Variantenbildungen ab T. 5.
Der Nonakkord über G strahlt zweifellos eine eminente Klangsinnlichkeit aus. Sie mit der Sichtbarkeit des Preziosen, des Spiegels, der Dienerinnen und der sonstigen Attribute des entfesselten Schönheitskultes in Verbindung zu bringen, dürfte geringe Probleme bereiten. Die Wirkung dieser Stelle tendiert zum musikalisch-impressionistischen Klangphänomen. Der Akkord steht für sich, wie so viele Nonakkorde bei Claude Debussy, und er entfaltet wenig Neigung, sich in den Gesamtzusammenhang einer harmonischen Progression zu integrieren. Damit dämpft er auch das Kontinuierliche des musikalischen Verlaufes.
Der Nonenakkord auf G entbehrt jedoch keineswegs ganz der Beziehung zu seinem Umfeld. Wenn nicht alles täuscht, liegt darin sogar seine symbolische Funktion in erster Linie begründet. Denn rein harmonisch-funktional gerechnet ist der Akkord g-h-d-f-a eine erweiterte Dominante, bezogen auf das vorausgehende und nachfolgende fis-Moll (unterstelltes cis als Grundton, Disalteration der Quinte gis zu g tief- und zu a hochalteriert, Terz eis als f geschrieben). Die Klangprogression fis-Moll-G9 weist, so gesehen g und eis als Leittöne zum fis-Moll-Grundton auf, ferner das Halbtonverhältnis d zu cis. Dennoch verselbständigt sich der Klang zum Eigenwert, ohne gänzlich seine Leittönigkeit aufzugeben.[36]
Mit Kurth zu reden: Der Klang behält seine Spannungen als Doppelleittonklang, integriert sie aber zu einem klanglich funkelnden Gesamtereignis. Energetik geht in Klangsinnlichkeit über. Daran ändert auch der Sachverhalt nichts, daß Strauss in T. 3 nach Ziffer 84 wieder mit fis-Moll ansetzt, also die Leittöne sogar zu ihrem Recht kommen läßt. Denn zu stark sticht der Akkord aus seinem Umfeld hervor (dynamisch, instrumentationstechnisch), als daß er allein als untergeordnetes Element einer übergreifenden Klangfolge sinnvoll deutbar wäre.
Kurth beschreibt die Absorption der psychischen Energie durch Klangsinnlichkeit in seinem Kapitel Impressionistische Züge.[37] Dort stellt er expressionistische und impressionistische Tendenzen romantischer Harmonik gegenüber und weist die energetischen Wirkungen den ersteren, die klangsinnlichen den letzteren zu:
»Expressionismus oder auch nur eine nach seiner Richtung neigende Entwicklung ist vor allem bedingt durch gesteigerte Einfühlung in den energetischen Ausdruck, die Bewegungsspannungen, Impressionismus durch deren Stillung, die gelöste Ruhe. [...] Von den alles Klangliche durchströmenden intensiven Spannungen strebt sich die Harmonik zu befreien, indem sie die klangsinnlichen Reizeffekte vorwiegend heraushebt. Daher schon das meist sehr ruhige, breite Zeitmaß impressionistischer Musik, welches sich über ein bewegtes und erregtes Miterleben stellt, Klanggebilde als einzelne Sinneneindrücke ausbreitet.«[38]
Kurth diagnostiziert den musikalischen Impressionismus als »Zurückdrängung aller energetischen Spannungen zugunsten des rein klangsinnlichen Eindrucks« und nennt den charakteristischen Zug impressionistischer Entwicklung einen »Zersetzungsprozeß«, bezogen auf den tonalen Gesamtzusammenhang.[39]
Dies kann, mit Bezug auf leittönige Strebung, folgendes bedeuten: Ein Klang, der eigentlich leittonreich ist, mutiert zum statischen Klangeindruck, in welchem die Leittontendenz nicht mehr ›im Vordergrund‹ steht (wenn man Kurths Begriff der Zurückdrängung ernst nimmt). Es handelt sich demnach um einen Neutralisierungseffekt.
Die Anwendung dieser Theoreme auf das Beispiel aus Strauss’ Frau ohne Schatten fällt leicht. Der Nonakkord über G steht als impressionistischer Effekt für sich, indem er so weit als möglich die dem Klang immanente Energetik (Doppelleittönigkeit) absorbiert und der unmittelbar wirksamen Sinnlichkeit der Nonenstruktur ausliefert. Das bedeutet konkret: Niemand unter den Hörern wird die Töne g und f als Strebetöne nach fis hören, die sie eigentlich sind. In den ›Vordergrund‹ rückt die Klangstruktur des Nonakkordes über G.
Der Übergang von energetischer Strebung in ein sinnlich erfahrbares Klangmoment entspricht genau dem, was den Kernbestand des ›Schatten-Handels‹ ausmacht: Der ›Triebverzicht‹ in der Abkehr von Barak wird kompensiert durch das Eintauchen in eine schöne, aber doch künstliche Welt. Die Substitution der Erotik durch das Künstliche aber darf Sublimierung genannt werden. Sublimierung ist eine von mehreren Formen der Triebbewältigung. Sie erfüllt sich zum Beispiel in der Kunst – oder eben in der Künstlichkeit des Schönen, in der rein ästhetischen Haltung. Im Prinzip haftet dieser Strategie des Triebverzichts nichts Krankhaftes an, im Gegensatz zu den Mechanismen der Triebabwehr durch Verdrängung. Aber sie wandelt den sexuellen Impuls ebenso spürbar um.
Der Vorgang, den Strauss im ersten Aufzug der Frau ohne Schatten in Musik setzt, wirft indes ein Licht darauf, daß Sublimierung auch Lebensferne mit sich bringen kann. Denn gerade hierin liegt die Bedenklichkeit des Handels um den Schatten der Färberin letztlich begründet: im Verzicht auf ›Leben‹ (Erotik) und im Ersatz durch eine vorgeblich höhere Welt des Scheins. Es ist die Vision einer sublimierten Sexualität, die sich in der Wirklichkeit des Handlungsfortganges als Dekadenz herausstellt.
* * *
Leittonreichtum muß den Klang, dem er sein energetisches Gepräge verleiht, nicht unbedingt klangschön machen. Im Gegenteil, er vermag seine Form auch zu verzerren. Kurth geht denn auch von den psychischen Gewalten aus, die einen Klang durchwirken und ihm gleichermaßen expressive Kraft und klangsinnliche Deformation bereiten können. Alterationen setzen am Akkord an und verzerren ihn: Das Ergebnis ist die Verformung der Terzstruktur, der Akkord nimmt eine neue äußere Gestalt an.
Nicht alle energetischen Klangverfremdungen haben etwas mit psychoanalytischen Befunden zu tun, dazu sind die Möglichkeiten der Semantisierung von Klanglichkeit zu vielfältig. Doch gibt es durchaus Fälle, in denen der dramatische Kontext des Klangmittels einen psychoanalytischen Kommentar liefert. Zu diesem Klangmittel zählen Akkorde mit doppelter Terz,[40] aber auch Alterationen der Quinte.
Erich Wolfgang Korngolds Operneinakter Violanta ist in mancher Beziehung ein psychoanalytisch grundiertes musikalisches Drama. Sicherlich in anderer Weise als Arnold Schönbergs Erwartung, das expressionistische Monodram, zu dem eine Verwandte Bertha Pappenheims (Sigmund Freuds Anna O.) das Libretto beisteuerte. Bei Korngold geht es nicht um Hysterie, sondern um fehlgeleitete Erotik. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Erkrankte, Violanta. Ihre Schwester Nerina wurde einst durch den Verführer Don Alfonso in den Selbstmord getrieben. Violantas Reaktion aber verweigert die Trauerarbeit. Sie, die »keusch ist wie Schnee«, leidet seit diesem Vorfall an einer »geheimnisvollen Schwermut«.[41] Simone, Violantas Ehemann, ergänzt:
»Seit diesem Tod ist Violanta stumm.
Ein Ungeheures presst den Hals ihr zu,
Und im Geheimnis ihres Hasses
Weist sie von sich, was Mann sich nennt.«[42]
Violanta selbst wünscht, Simone möge den Gegenstand ihres Hasses töten. Sie erläutert ihre psychische Befindlichkeit, und ihre Selbstanalyse ist durchaus triftig. Denn sie läßt frühzeitig den wahren Grund ihres Hasses durchblicken. Auf den ruchlosen Verführer der Schwester angesprochen, sagt sie:
»Und wie, wenns ihm gelinge?
Haß und Liebe sind Brüder im Herzen.
Wie, wenn ich selbst einst begehrte,
Was jetzt mich mit Schauern erfüllt?«[43]
Später enthüllt sich Violantas unterdrückte Liebe zu Alfonso – eine Liebe, die sich aufgrund einer asketischen Erziehung und eines Denkens in den Kategorien der Pflicht und des Gehorsams nicht entfalten durfte. Daß Violanta sich schließlich dennoch ihrer Leidenschaft hingibt, führt zwar, therapeutisch bewertet, zu ihrer psychischen Gesundung, im dramatischen Verlauf zugleich aber auch zu ihrem Tod.
Die psychoanalytische Tradition Freuds kennt zahlreiche ›Maßnahmen‹ der Triebabwehr. Sexuelle Energien, die nicht ausagiert werden können (oder dürfen), verlagern sich auf andere Ebenen, wo sie unkenntlich sind bzw. dem ursprünglichen Impuls nicht mehr nahe stehen. Violantas Verkehrung der Leidenschaft in das Gefühl des Hasses ist eine Form der Abwehr durch Verdrängung, angereichert mit Elementen der Rationalisierung (sie wähnt, ihren Mordplan im Interesse sämtlicher Frauen ins Werk zu setzen, die rein geblieben seien). Freud würde sagen: Violantas Hass sei ein Abwehrmechanismus gegenüber einer Libido, die aus Gründen der Pflicht und der sozialen Normen das Begehrte nicht sichtbar besetzen darf.[44]
Daraus folgt ein evidenter musikalischer Unterschied der ›Musik der Liebe‹ und derjenigen des Hasses. Korngold wählt in beiden Fällen den Nonakkord, als Ausdruck der Liebe Violantas den regulären Nonenklang g-h-d-f-a:
Beispiel 6: Erich Wolfgang Korngold, Violanta, Kl.A., 114f., bei Ziffer 123
in der ›Hassform‹ jedoch mit Tiefalteration der Quinte e-g-b-d-fis:
Beispiel 7: Erich Wolfgang Korngold, Violanta, Kl.A., 67, nach Ziffer 67
Die jubelnde Liebesmusik, die Violantas überwundene Verstockung anzeigt, wandelt – in großformaler Bezogenheit[45] – die kompositorisch ganz äquivalente Hassmusik um. Genau genommen, die Umwandlung treibt der Musik des Hasses ihre quälende Leittönigkeit aus. Hass und Liebe sind in der Tat damit auch musikalisch Brüder. Nur daß der Hass wesentlich leittonreicher, und damit auch ›gefangen‹ in der Hölle der libidinösen Triebe ist. Denn die Tiefalteration bewirkt zweierlei: Einerseits verzerrt sie den Klang und verschleiert somit absichtsvoll das Liebesgefühl, andererseits reichert sie ihn mit einer weiteren Strebung an. Die Negation des Liebesimpulses führt zu einer Steigerung innerer psychischer (und musikalischer) Spannung. Mit Freud müßte man von einer höchst mißlungenen Abwehr des verbotenen Triebes sprechen. Die Maskierung der Sexualität im Hassgefühl führt zur Erhöhung des psychischen Leidens, nicht zu dessen Bewältigung. Die ›Verzerrung‹ (Kurth) des Klangs durch Alteration ist das energetische Symbol dafür.
So enthüllen sich in der Frage, inwieweit sich Kurths Musiktheorie und Freuds Psychoanalyse nahe stehen, doch erstaunliche Kongruenzen: Nicht so sehr in der direkten Abhängigkeit der einen von der andern, sondern in der Verwendbarkeit der Theorie zur psychoanalytischen Interpretation. Kurths Theorie wohnt in diesem Sinne keine direkte psychoanalytische Tendenz inne, wohl aber ein entsprechendes hermeneutisches Potenzial.
Anmerkungen
Der psychologische Ansatz ist bei Kurth schon früh präsent. Ernst Kurths Schriften zur Musikpsychologie (in chronologischer Reihenfolge) sind: Kurth 1913, Kurth 1917, Kurth 1920, Kurth 1925, Kurth 1931. | |
Ausführlicheres in Krebs 1998b, 70ff. Zu den Begriffen Kraft, Spannung und Energie, 151ff. | |
Vgl. dazu z.B. Freud 1942, 118ff. | |
Eine gleichermaßen faßliche wie ausführliche Zusammenfassung bietet Ellenberger 1973. | |
Kurth 1917, 68. | |
Kurth befindet in der Romantischen Harmonik (Kurth 1920, 11): »Die übliche Harmonielehre [...] bezeichnet den Akkord schlechtweg als Klang; in erster Linie ist er aber Drang«. | |
Zur These des geistigen Zusammenhanges der Theorie Kurths mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse vgl. Lieberman 1968, 4; ferner Gruber 1994. Gruber glaubte an eine direkte Abhängigkeit Kurths von Freuds Vorstellungen des Unbewußten. | |
Schopenhauer 1977b, 621ff. | |
Ebd., 622. | |
Ebd., 624. | |
Ebd., 627 bzw. 625. | |
Ebd., 625. | |
Ebd., 630. | |
Ebd., 624. | |
Ebd., 643 bzw. 622. | |
Freud 1947, 11f. | |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien genannt: Hemecker 1991; Zentner 1995; Kaiser-El-Safti 1987; Gödde 1999. | |
Kurth 1920, 4. | |
Ebd., 4. | |
Ebd., 48. | |
Man bedenke, welche Variationsbreite an ›Konsequenzen‹ beispielsweise Hegels Philosophie eröffnete: Die ›Fortsetzer‹ seines Systems reichten von Karl Marx auf der politischen Linken, die dem 20. Jahrhundert den real existierenden Sozialismus bescherte, bis zur Staatsvergottung auf Seiten der Rechten, ohne die in Deutschland die Akzeptanz des Dritten Reiches wohl weniger eindeutig ausgefallen wäre. | |
Zentner 1995, 135ff. | |
Krebs 1998b, 185ff. | |
Ausgeführt ist sie in Kurth 1920, 14ff. | |
Kurth widerspricht jedoch der vertikalen Auffassung b-des-f-g (T. 1) in einem für ihn wichtigen Punkt: Er sieht nicht den Klang, sondern die Linie g-as im Vordergrund, g also nicht als Akkordton (Kurth 1920, 53ff.). Dagegen wäre einzuwenden: Wagner komponiert mit g in T. 1 einen Liegeton, der – harmonisch gesehen – den Ton as zur Nebennote macht. Kurth ist andererseits jedoch zuzugestehen, daß er die ›Strebung‹ g-as in den Zusammenhang der Fortsetzung b-c rückt, also eine übergreifende Linienbewegung meint. Dies aber würde der partiell vertikalen Auffassung des ersten Klanges nicht zuwiderlaufen, vor allem dann nicht, wenn man bedenkt, daß Kurth selbst unter dem Vorzeichen der psychischen Wandelbarkeit und Flexibilität des Musikhörens in manchen Analysen einzelne Töne als zugleich ruhend und drängend wertet. | |
Kurth 1920, 58f. | |
Welche der beiden Energien die größere Spannkraft gegen den jeweiligen Folgeton entfaltet, läßt Kurth offen, wie ihm denn überhaupt eine Quantifizierung im Stile physikalischer Spannungs- oder Energiebegriffe fern liegt. Kurth betrachtet jedenfalls beide Fortschreitungen als stark energetische, gegenüber rein diatonischen Wendungen intensivierte Linienzüge. | |
Kurth 1931, 173. | |
Schopenhauer 1977a (Bd. 2), 412. | |
Kurth 1920, 82. | |
Krebs 1994. | |
Strauss, Richard, Die Frau ohne Schatten, Kl. A., 132ff. | |
Ebd., Erster Aufzug, ab Ziffer 128. | |
Ebd., Kl.A., 98ff. | |
Ebd., Kl.A., 102. | |
Ob es bloßer Zufall ist, daß Strauss in seiner Salome mit der Rückung cis-Moll/Cis-Dur zu D9 Narraboths schwärmerische Aussage über die Prinzessin von Judäa ganz ähnlich komponiert? Der zugehörige Text lautet immerhin: »Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht!« (Strauss, Salome, Kl.A., 5, System 2). | |
Kurth 1920, 384ff. | |
Ebd., 394. | |
Ebd., 394f. | |
Vgl. Krebs 1994. Darin wird der Versuch unternommen, Doppelterzklänge des frühen 20. Jahrhunderts als Symbole für gehemmte Sexualenergie zu interpretieren. | |
Korngold, Erich Wolfgang: Violanta, Kl.A., 17f. | |
Ebd., 43f. | |
Ebd., 69f. | |
Violanta selbst spricht davon, sie sei stets durch »kalte Pflicht« am wirklichen Leben gehindert worden (Kl. A., 124). | |
Vgl. Krebs 1998a. |
Literatur
Korngold, Erich Wolfgang, Violanta. Oper in einem Akt von Hans Müller. Musik von Erich Wolfgang Korngold. Vollständiger Klavierauszug mit Text von Ferd. Rebay, Mainz-Leipzig: B. Schotts Söhne, o.J.
Strauss, Richard, Die Frau ohne Schatten. Oper in drei Akten von Hugo von Hofmannsthal. Musik von Richard Strauss; Vollständiger Klavierauszug mit Text von Otto Singer, Bramstedt: Fürstner Ltd., o.J.
Wagner, Richard, Tristan und Isolde; Klavierauszug mit Text von Felix Mottl und Gustav F. Kogel, Frankfurt-London-New York: Peters, o.J.
Ellenberger, Henry F. (1973), Die Entdeckung des Unbewußten, 2 Bde., Bern: Huber.
Freud, Sigmund (1942), Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Gesammelte Werke 5), London.
Freud, Sigmund (1947), Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse (Gesammelte Werke 12), London.
Gödde, Günter (1999), Traditionslinien des ›Unbewußten‹. Schopenhauer–Nietzsche–Freud, Tübingen: Ed. diskord.
Gruber, Gerold W. (1994), Artikel: »Analyse«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, neubearbeitete Ausgabe, hg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd. 1, Kassel: Bärenreiter, Sp. 577–591, insb. Sp. 583.
Hemecker, Wilhelm W. (1991), Vor Freud. Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen der Psychoanalyse, München: Philosophia.
Kaiser-El-Safti, Margret (1987), Der Nachdenker: Die Entstehung der Metapsychologie Freuds in ihrer Abhängigkeit von Schopenhauer und Nietzsche, Bonn: Bouvier.
Krebs, Wolfgang (1994), »Terzenfolgen und Doppelterzklänge in den ›Gezeichneten‹ von Franz Schreker. Versuch einer energetisch-psychoanalytischen Betrachtungsweise«, in: Die Musikforschung 47, 365–383.
Krebs, Wolfgang (1998a), Dramaturgie der Entgrenzung. Erich Wolfgang Korngolds Operneinakter ›Violanta‹, in: Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft 1: http://www.8ung.at/fzmw/1998/1998_1b.htm, 26–39.
Krebs, Wolfgang (1998b), Innere Dynamik und Energetik in Ernst Kurths Musiktheorie. Voraussetzungen, Grundzüge, analytische Perspektiven, Tutzing: Hans Schneider.
Kurth, Ernst (1913), Die Voraussetzungen der theoretischen Harmonik und der tonalen Darstellungssysteme, Bern: Haupt; 2. unveränderte Aufl. (mit einem Nachwort von Carl Dahlhaus), München 1973.
Kurth, Ernst (1917), Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bachs melodische Polyphonie, Bern: Haupt [Titel ursprünglich: Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie ]; 21922; 31927; Reprint der 3. Aufl. Hildesheim: Olms, 1977.
Kurth, Ernst (1920), Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan, Bern: Haupt; 21922; 31923; Reprint der 3. Aufl., Hildesheim: Olms, 1985.
Kurth, Ernst (1925), Bruckner, (2 Bde.) Berlin: Hesse, Reprint Hildesheim: Olms, 1971.
Kurth, Ernst (1931), Musikpsychologie, Berlin: Hesse; 21947; Reprint Hildesheim: Olms, 1969.
Lieberman, Ira (1968), Some representative works from Beethoven’s early period analyzed in light of the theories of Ernst Kurth and Kurt von Fischer, Diss. Columbia Univ.
Schopenhauer, Arthur (1977a), Die Welt als Wille und Vorstellung (Zürcher Ausgabe, Bde. 1–4), Zürich: Diogenes.
Schopenhauer, Arthur (1977b), Zur Metaphysik der Geschlechtsliebe, (Zürcher Ausgabe, Bd. 4), Kapitel 44 aus Die Welt als Wille und Vorstellung, Zürich: Diogenes.
Zentner, Marcel R. (1995), Die Flucht ins Vergessen: die Anfänge der Psychoanalyse, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.