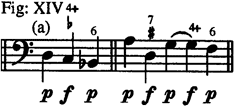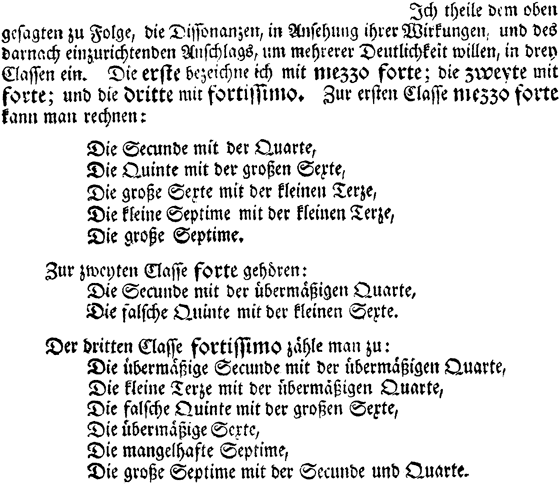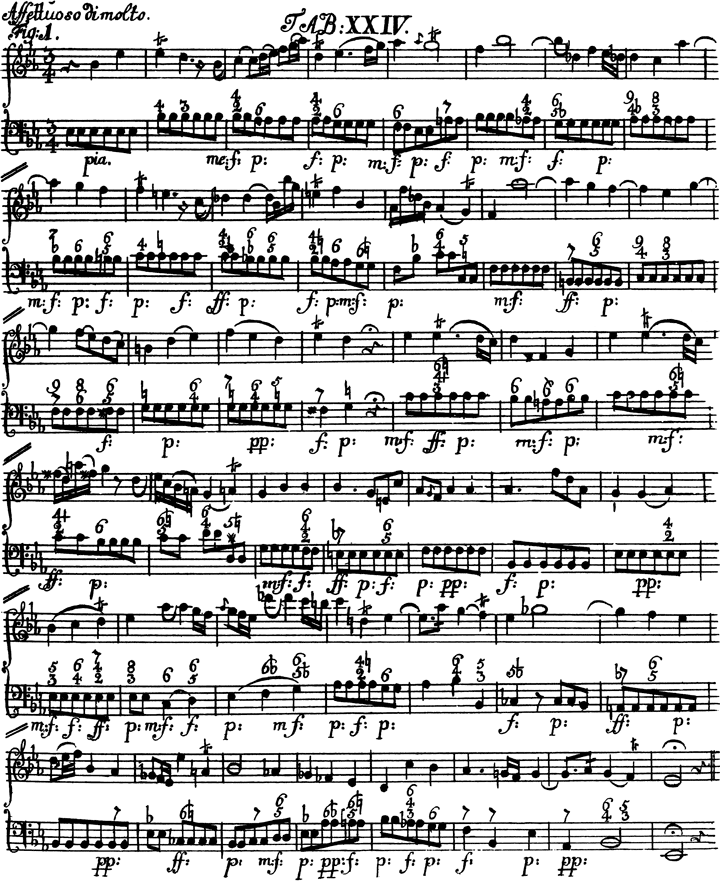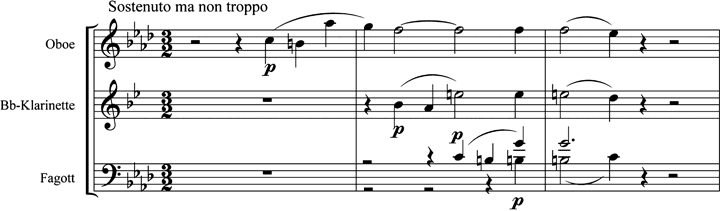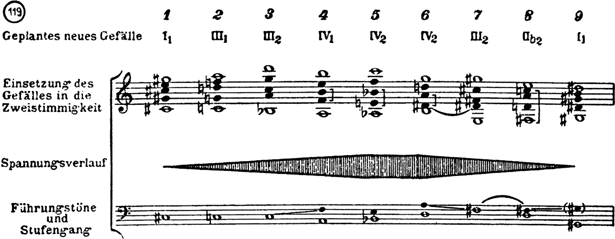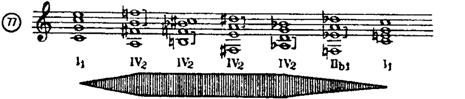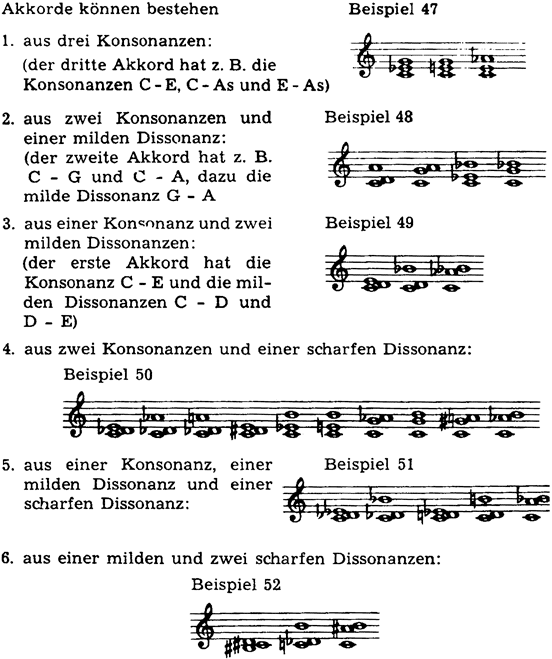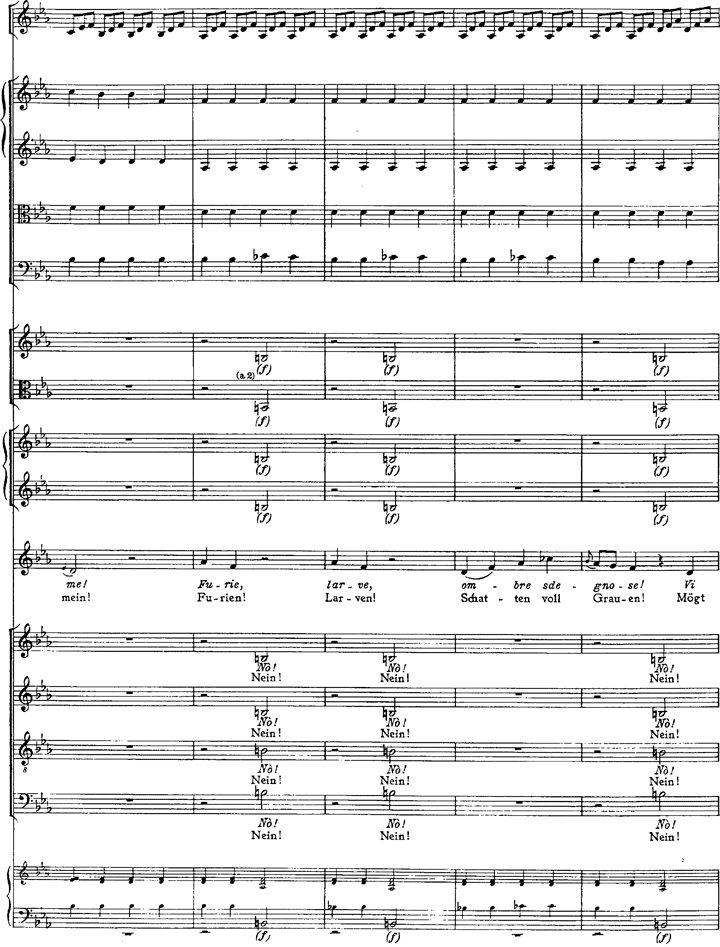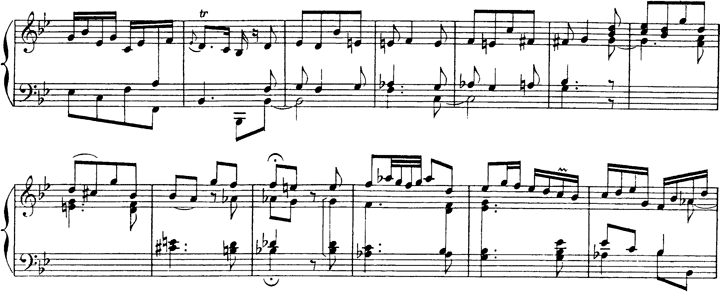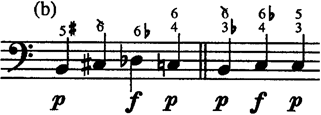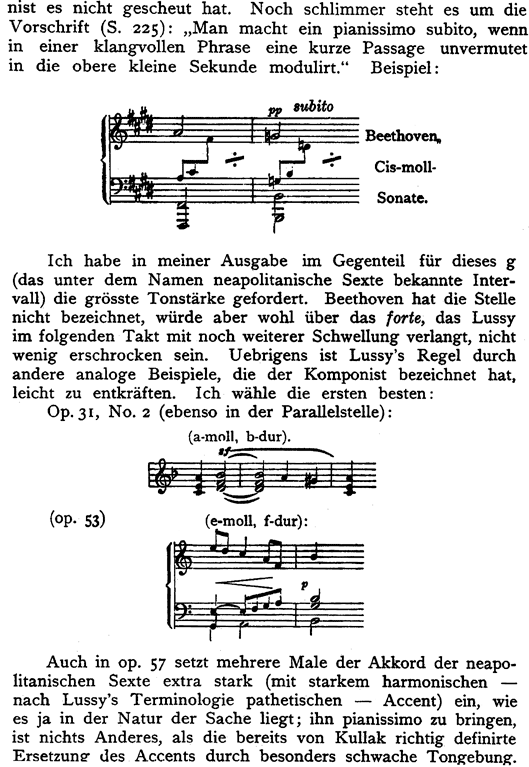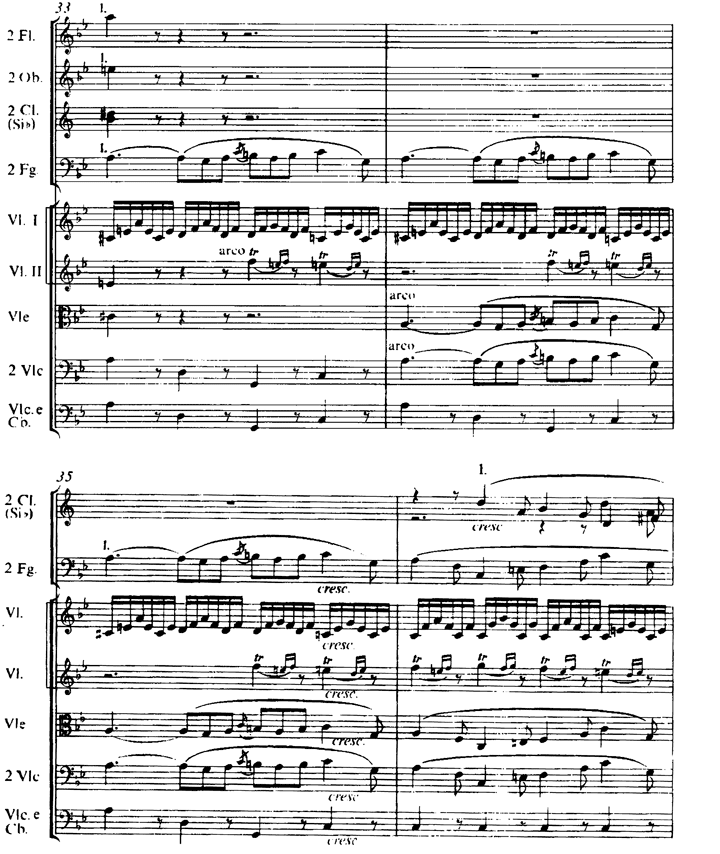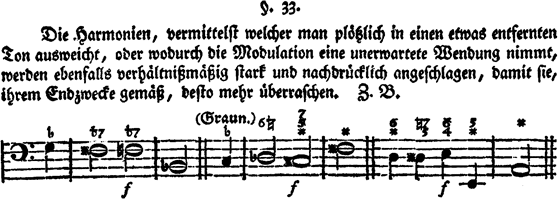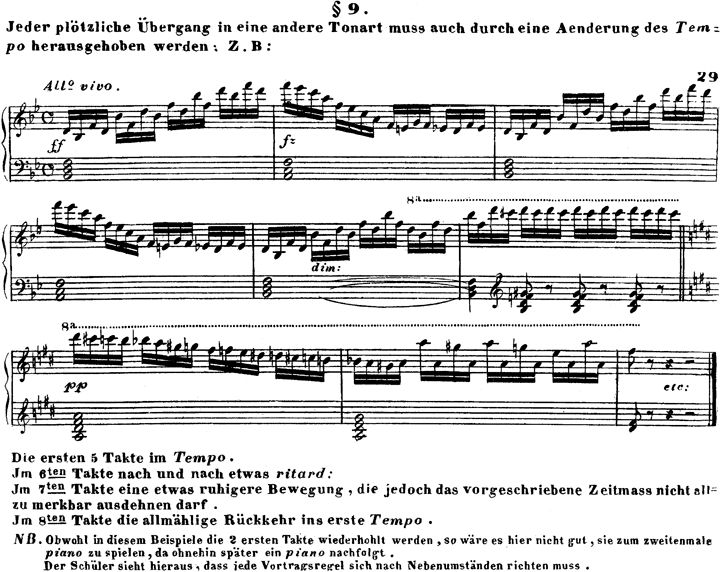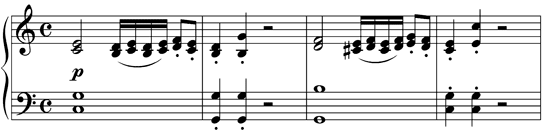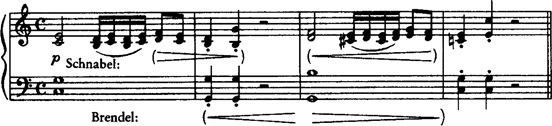Harmonik und Aufführungspraxis[1]
Hubert Moßburger
Wie lässt sich Harmonik aufführungspraktisch interpretieren? Diese Frage erscheint ungewohnt, sind es doch vorherrschend andere musikalische Parameter, welchen aufführungspraktische Relevanz beigemessen wird: dem Rhythmisch-Metrischen hinsichtlich Agogik und Akzentuierung, dem Melodischen im Hinblick auf Dynamik und der formalen Gliederung bezüglich Artikulation und Phrasierung. Als Gründe für die Vernachlässigung der Harmonik als Faktor der Aufführungspraxis mögen gelten: erstens, dass die Harmonik im wahrnehmungsästhetischen Hintergrund als logisch-zusammenhangstiftendes Prinzip wirkt, und zweitens der Rückgang der improvisatorischen Anteile der Komposition (Ornamentik) ab 1800; zudem schränkten die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer dichter über den Tonsatz ausbreitenden Vortragsbezeichnungen den Interpreten in seiner Gestaltungsfreiheit ein. Dennoch kommt der Harmonik in fast allen Vortragslehren des 18. und 19. Jahrhunderts (Quantz, Bach, Türk, Czerny, Riemann) noch zentrale Bedeutung für die Aufführungspraxis zu. Auf Grundlage dieser Quellen werden folgende Kriterien für die Interpretation von Harmonik zusammengestellt, in ihrem geschichtlichen Wandel untersucht und an Literaturbeispielen belegt: Konsonanz-Dissonanz, Chromatik (tonartfremde Klänge), Enharmonik, Akkordprogression und Modulation. Als musikalische Gestaltungsmittel dieser fünf Interpretationsaspekte stehen Dynamik, Gewichtung (ganzer Akkorde, aber auch von Einzeltönen), Agogik, Intonation und Farbgebung zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Harmonik nur ein Teilmoment von Musik ist, das in Wechselwirkung zu anderen Parametern steht, muss sich der Interpret seiner Aufgabe, einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen musikalischen Faktoren herzustellen, umso bewusster sein. Dass aber Harmonik selbst schon komponierte Interpretation (z.B. einer Melodie) ist, nimmt den Interpreten nicht nur in die Pflicht, sondern lädt ihn auch ein zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die fantastischen Interpretationsmöglichkeiten musikalischer Komposition.
Befragt man Musiker nach dem Wert von Harmonielehrekenntnissen für die eigene musikalische Praxis, wird man unterschiedliche Antworten erhalten: Der Organist kann sie für die Improvisation gebrauchen, der Dirigent für die überblickende Koordination der Orchesterpartitur, der Pianist als Memorierhilfe seiner Grifffolgen und die Soloinstrumentalisten und Sänger verweisen das Problem auf die Vorgenannten. Lenkt man nun die Frage auf die Interpretation, wird zwar kaum jemand den generellen Nutzen satztechnischer Kenntnisse dafür offen bestreiten; stellt man jedoch die präzisierende Frage, wie sich denn Harmonik aufführungspraktisch interpretieren lasse, wird man Ratlosigkeit antreffen oder pauschalierende Verweise auf den konkreten Zusammenhang ernten. Dagegen stellt die Interpretation rhythmischer und melodischer Verläufe weniger ein Problem dar: Je nach Relation von Rhythmus und Metrum, Melodieverlaufsrichtung, Taktordnung, motivisch-thematischer Disposition oder der Hierarchie von Einzeltönen bzw. Linien im mehrstimmigen Satz lassen sich mit gutem Gespür dynamisch-agogisch-artikulatorische Entscheidungen treffen.
Die stiefmütterliche Behandlung der Harmonik als aufführungspraktisches Kriterium kann jedoch nicht allein auf die mangelnde Bereitschaft der Interpreten zur ›Anstrengung zum Begriff‹, also zur analytischen Durchdringung und Bewusstmachung der komplexen harmonischen Dimension zurückgeführt werden; sie hat auch kompositionsgeschichtliche und ästhetische Gründe: Erstens weist die im 18. und 19. Jahrhundert vorherrschende Melodieästhetik der Harmonik eine primär logische Funktion zu. Als ein im wahrnehmungsästhetischen Hintergrund wirkendes Regulativ stiftet die Harmonik für die primär melodischen Vorgänge Zusammenhalt.[2] Zweitens hatte die kompositorische Ausarbeitung der Mittelstimmen bis hin zum »obligaten Accompagnement«, von dem Beethoven behauptete, er sei damit »auf die Welt gekommen«[3], den Niedergang des Generalbasses in der Komposition zur Folge. Die Kenntnis der Harmonik war ab dem späten 18. Jahrhundert also nicht mehr direkt an die Aufführungspraxis gebunden. Drittens entwickelte sich die Ornamentik von einem akzidentiell-improvisatorischen zu einem essentiell-festgeschriebenen Moment des Tonsatzes. War beispielsweise für einen Flötisten im 18. Jahrhundert die Kenntnis und Berücksichtigung der Harmonik für die konkrete Ausführung von Verzierungen unverzichtbar, so geriet die Harmonik durch die zunehmende detaillierte Festlegung der ›res facta‹ immer weiter aus dem Blickfeld der Interpreten. Viertens entlasteten die im Laufe des 19. Jahrhunderts sich immer dichter über den Tonsatz ausbreitenden Vortragsbezeichnungen den Interpreten von der Verantwortung aus einem differenzierten Harmonieverständnis interpretatorische Folgerungen zu ziehen.[4]
Die zunehmende Festschreibung von Mittelstimmen, Verzierungen und Vortragszeichen wirkte sich auch auf die pädagogische Praxis der Musiktheorie aus: Harmonielehre wurde – im Gegensatz zur Generalbasslehre – von der kompositorischen und aufführenden Praxis abgekoppelt und zu einem bloßen Propädeutikum für angehende Komponisten bzw. zu einem wissenschaftlichen Abstraktum.
Insgesamt wandelte sich das Verständnis des Interpreten von einem mehr oder weniger freien Gestalter einer ›Res facta‹ barocker Musik hin zu einem Nachschöpfer oder »Statthalter«[5] des autonomen, in sich geschlossenen klassisch-romantischen Kunstwerks. Entsprechend verengte sich die allgemeine Vortragslehre des 18. Jahrhunderts, in der noch allgemein verbindliche Regeln zur harmonischen Interpretation zu finden waren, zu werkindividuellen Interpretationsanalysen, in denen die Harmonik hinter dem Primat des Deutlichkeitspostulats motivisch-thematischer Entwicklungen zurückstehen musste.[6]
Dennoch wurde die Vortragslehre auch im 19. Jahrhunderts nicht vollständig durch den neu entstehenden, scheinbar individualisierten Interpretenkult verdrängt; die aus dem 18. Jahrhundert stammenden Anweisungen zum Vortrag bzw. ›Ausdruck‹ der Harmonik wurden weiter tradiert, wenn auch teilweise unter veränderten ästhetischen Voraussetzungen und mit entsprechenden Folgerungen. Die von Johann Joachim Quantz bis Theodor W. Adorno verstreuten Regeln und Bemerkungen zur Harmonik als Aspekt der Aufführungspraxis unter Berücksichtigung ihrer historisch-ästhetischen Voraussetzungen zusammenzustellen und auszuwerten, vielleicht aber auch »verloren gegangene Selbstverständlichkeiten« (Riemann) wieder aufzudecken, macht sich diese Arbeit zum Ziel. In den Vortragslehren des 18. und 19. Jahrhunderts finden sich folgende für die Aufführung von Harmonik relevanten Themenkreise: Konsonanz und Dissonanz, Diatonik-Chromatik-Enharmonik, Akkordprogression, Ausweichung bzw. Modulation, Harmonik und Metrik; im 20. Jahrhundert kommt die Wechselbeziehungen von Linie und Klang hinzu.
Konsonanz und Dissonanz
18. Jahrhundert
Dass der Dissonanz aus satztechnischen und ästhetischen Gründen mehr Gewicht als der auflösenden Konsonanz zukommt, gehört heute zu den kaum erwähnenswerten Selbstverständlichkeiten gängiger Musizierpraxis. Indessen lohnt die Frage nach der historischen Differenzierung. Carl Philipp Emanuel Bachs äußerst einflussreicher Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, den noch Beethoven zum Unterricht heranzog, weist in seinem 1753 veröffentlichten ersten Teil im Kapitel »Vom Vortrage« auf den Zusammenhang zwischen Klang und Dynamik hin:
Indessen kann man mercken, daß die Dissonanzen insgemein stärker und die Consonanzen schwächer gespielt werden, weil jene die Leidenschafften mit Nachdruck erheben und diese solche beruhigen, Fig XIV. (a).[7]
Abb. 1: Bach, Versuch, Teil 1 (1753), Fig. XIV (a)
In den beiden von Bach beigefügten Notenbeispielen erhalten die konsonanten Dreiklänge und ihre Umkehrungen ein Piano, die dissonanten (zwischendominantischen) Septakkorde ein Forte und zwar, wie es scheint, unabhängig von ihrer metrischen Taktposition. Im Hinblick auf die Praxis räumt Bach allerdings ein:
Wegen der Kürze habe ich in den Exempeln hierüber das f. und p. häuffen müssen, ohngeacht ich wohl weiß, daß diese Art, alle Augenblicke Schatten und Licht anzubringen, verwerflich ist, weil sie statt der Deutlichkeit eine Dunkelheit hervor bringet, und statt des Frappanten zuletzt etwas gewöhnliches wird.[8]
Etwa 35 Jahre später ergänzt Daniel Gottlob Türk in seiner Klavierschule von 1789 im Abschnitt »Von der zum Ausdruck erforderlichen Stärke und Schwäche« die prinzipielle Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung um eine graduelle Dissonanzenabstufung:
Wenn man bey dieser Regel [die bereits Bach aufgestellt hat] vorzüglich auf den Grad des Dissonirens Rücksicht nimmt, so folgt, daß je härter eine Dissonanz ist, oder je mehr Dissonanzen in einem Akkorde enthalten sind, je stärker muß man die Harmonie anschlagen. Doch kann und darf diese Regel nicht immer auf das strengste befolgt werden, weil sonst wohl zu viel Abwechselung entstehen möchte.[9]
Türk stellt allerdings nur zwei Gruppen von Dissonanzen auf, und zwar solche, die stark und solche, die weniger stark dissonieren und entsprechend mehr oder weniger stark anzuschlagen sind; die Differenzierung der konsonanten Akkorde hingegen überlässt er dem »fein« empfindenden Spieler:
Abb. 2: Türk, Klavierschule (1789), § 32, 351
Zu den Akkorden, die einen »gemäßigteren Grad der Stärke« verlangen, zählt Türk den kleinen Mollseptakkord in Sekundstellung, alle Stellungen des Dominantseptakkords und den Quartvorhalt mit und ohne None. Bei den »nachdrücklich« anzuschlagenden, »stark dissonierenden« Akkorden führt Türk alle komplexen Klangtürme auf, welche seine Zeit zu bieten hatte:[10] den Dursekundakkord (Nr. 2), den kleinen Dominantseptnonenakkord, den übermäßigen Septakkord (an letzter Stelle) sowie weitere Klänge mit starken Vorhaltsspannungen, die alle als isolierte Momentaufnahmen unaufgelöst für sich stehen. Auffällig ist, dass der viel gebrauchte verminderte Septakkord (ohne Orgelpunkt wie in Nr. 5) und der halbverminderte Septakkord nicht vorkommen; wahrscheinlich sind sie bei der von Türk getroffenen Auswahl zwischen den beiden Gruppen angesiedelt. Weiter fällt auf, dass, während die mildere Dissonanzgruppe in sich homogen ist, die stark dissonierende Gruppe mit ihrer weiten Spannbreite vom milden Dursekundakkord zum scharfen übermäßigen Septakkord im Dissonanzgrad heterogen zusammengestellt erscheint. Türks Einteilung entspricht ziemlich genau Ernst Kreneks Zweiteilung in »scharfe« und »milde« Dissonanzqualitäten: die »stark dissonierenden« Akkorde Türks beinhalten die »scharfen« Dissonanzen der kleinen Sekunde bzw. kleinen None oder grossen Septime (einzige Ausnahme bildet der vorvorletzte Akkord mit Sext-Nonen-Vorhalt), die »weniger dissonierenden« Akkorde haben nur »milde« Dissonanzen (grosse Sekunde bzw. grosse None oder kleine Septime).[11]
Die von Bach bis Türk nachgezeichnete Entwicklung ließe für das 19. Jahrhundert eine weiter zunehmende Differenzierung der Dissonanzgrade und ihrer Spielweise erwarten. Doch beschränken sich die Vortragslehren der Folgezeit wieder auf die prinzipielle Konsonanz-Dissonanz-Unterscheidung C.Ph.E. Bachs. Überraschender Weise war es Johann Joachim Quantz, der bereits 1752, also noch ein Jahr vor Bach, die umfassendste und ausführlichste Vortragslehre zur aufführungspraktischen Differenzierung von dissonanten Akkorden vorlegt hatte. Im Sinne eines Opus summum bezieht Quantz im Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen im Abschnitt »Von den Clavieristen insbesondere« auch den Begleiter mit ein. Zunächst erfolgt die zeitgemäße ästhetische Begründung durch die Affekte:
Eben diese Erregung der abwechselnden Leidenschaften, ist auch die Ursache, warum die Dissonanzen überhaupt stärker, als die Consonanzen angeschlagen werden müssen. Die Consonanzen setzen das Gemüth in eine vollkommene Ruhe und Zufriedenheit: die Dissonanzen hingegen erwecken im Gemüthe einen Verdruß. […] Je härter also der Verhalt der Dissonanzen ist; je gefälliger ist ihre Auflösung.[12]
Entsprechend dieser graduellen Auffassung teilt Quantz die Dissonanzen »in Ansehung ihrer Wirkungen und des darnach einzurichtenden Anschlags, um mehrerer Deutlichkeit willen, in drey Classen ein«:[13]
Abb. 3: Quantz, Versuch (1752), § 14, 228f., drei Dissonanzklassen
Um eine bessere Übersichtlichkeit und Memorierbarkeit zu gewährleisten, gebe ich eine Übersetzung in moderne Terminologie:
1. Klasse: mezzo forte | 2. Klasse: forte | 3. Klasse: fortissimo |
– Kleiner Mollsekundakkord – Sixte ajouteé – Verminderter Sextakkord – Kleiner Mollseptakkord – Grosser Durseptakkord | – Dominantsekundakkord – Dominantquintsextakkord | – Verminderter Septakkord (in allen Stellungen) – Übermäßiger Sextakkord – Dominantseptvorhaltsakkord über Tonika |
Abb. 4: Quantz’ Generalbassangaben in moderner Akkordbenennung (§ 14)
Im unmittelbar vorhergehenden Paragraphen (§ 13) gibt Quantz eine andere, mit § 14 teilweise inkongruente Dissonanzqualifizierung:[14]
»Nicht so empfindlich … | … als«: |
– Quartvorhalt – Nonen, Quartnonen- und Septnonenvorhalt – »Septime, wenn sie mit der Sexte und Quarte abwechselt, oder wenn sie über einer durchgehenden Note stehet« (§ 15) | – Sixte ajouteé – Dominantquintsextakkord – Dominantseptakkord – Kleiner Mollseptakkord – Großer Durseptakkord – Kleiner Mollsekundakkord »erfordern noch mehr Nachdruck«: – Großer Dursekundakkord – Dominantsekundakkord – Verminderter Septakkord (in allen Stellungen) – Übermäßiger Sextakkord – Dominantseptvorhaltsakkord über Tonika |
Abb. 5: Johann Joachim Quantz, Versuch (1752), § 13, 227f.
Geht man davon aus, dass das Spätere gegenüber dem Früheren Ergebnischarakter bzw. letztendliche Gültigkeit hat, dann kann die in § 14 explizit drei Klassen zuweisende Aufstellung als weiterführende Differenzierung von § 13 verstanden werden. Insofern hat Quantz von der zuerst aufgestellten Gruppierung (§ 13) die linke Spalte (in Abb. 5) nicht mehr berücksichtigt, da es sich bei diesen Klängen nur um Vorhaltsbildungen (nach Heinrich Christoph Koch: um unwesentliche, »zufällige« Dissonanzen) handelt, die, wie Quantz bemerkt, »keinen besonderen Ausdruck erfordern«.[15] Die oben (Abb. 5) in der rechten Spalte befindlichen Akkorde (mit wesentlichen Dissonanzen), die zunächst nur in zwei Untergruppen aufgeteilt wurden, differenziert Quantz nun (in § 14) weiter in drei Klassen: die obere Untergruppe (rechte Spalte) bildet nun größtenteils die erste mf-Klasse, die untere die dritte ff-Klasse. Offensichtlich hatte Quantz die Einsicht, dass weder der dominantische Quintsextakkord in die erste Klasse, noch der dominantische Sekundakkord zur dritten Klasse gehört, dazu bewogen, noch eine zweite f-Klasse aufzustellen. Anders als in der ersten Aufstellung (§ 13), ist in der ersten Klasse der grundstellige Dominantseptakkord durch den verminderten Dreiklang in erster Umkehrung ersetzt, und der große Durseptakkord ist in der dritten Klasse ›durchgefallen‹. Diese Änderungen sind entweder aus Nachlässigkeit oder aufgrund der Schwierigkeit entstanden, die beiden Klänge eindeutig zuzuordnen. Gerade diese Inkonsequenzen zeigen, wie problematisch eine exakte Graduierung von Zusammenklängen in abstractu ohne musikalischen Kontext sein kann.
Quantz’ dissonante ›Dreiklassengesellschaft‹ zeigt zweierlei: Zum einen ist sie gegenüber den späteren Kategorisierungen Bachs (mit der nur prinzipiellen Trennung von Konsonanz und Dissonanz) und Türks (mit der gröberen Zweiteilung) weitaus differenzierter; so gehören nach Quantz der Mollsekundakkord der ersten und der dominantische Quintsextakkord der zweiten Klasse an, während die beiden Akkorde bei Türk auf einer Ebene nebeneinander stehen. Zum anderen zeigt sich in Quantz’ Klassifizierung der Dissonanzen ein Ereignis von großer musikgeschichtlichen Tragweite: Wurden spätestens seit der Contrapunctuslehre die ›Konsonanzen‹ in die Qualitäten ›perfekt‹ und ›imperfekt‹ geteilt, so sind es nun umgekehrt die ›Dissonanzen‹, die weiter untergliedert werden;[16] der Fokus richtet sich im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung immer mehr auf die Dissonanzen und das Problem ihrer Interpretation. Quantz’ Versuch enthält also nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Interpretationsgeschichte, sondern auch eine einzigartig ausführliche Klangästhetik, die erst im 20. Jahrhundert durch Paul Hindemiths Klangwertigkeiten im »harmonischen Gefälle«[17] oder Ernst Kreneks sechs Kombinationen von Spannungsgraden[18] überboten wurde.[19]
In einem beigefügten Probestück, einem »Adagio« für Soloinstrument (Flöte) und Basso continuo demonstriert Quantz seine Vortragstheorie:
Abb. 6: Quantz, Versuch (1752), Tab. XXIV, Affettuoso di molto
Das Affettuoso di molto zu spielende Stück ist zu diesem Zweck mit dynamischen Vortragszeichen geradezu übersät. Nahezu jeder Akkord wird hier eigens differenziert, wozu Quantz absichtlich ein langsames Zeitmaß gewählt hat. Für die Praxis relativiert Quantz sein Dreiklassensystem, um ein ausgewogenes dynamisches Gefälle zu erreichen: Die konsonanten Begleitakkorde dieses Adagio sollen im »mezzo piano« gehalten werden, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, sie zu schwächen oder zu stärken. Die Dissonanzen sollten
mit einer proportionirlichen Stärke ausgedrücket werden; dergestalt, daß beym Pianissimo die Dissonanzen aus der dritten Classe, nur die Stärke von der ersten; und beym Piano die Stärke von der zweyten Classe bekommen: die übrigen aber nach diesem Verhältniß auch gemäßiget werden: widrigenfalls würde der Abfall, wenn solcher mit einer allzu großen Heftigkeit geschähe, dem Gehöre mehr Verdruß, als Vergnügen erwecken.[20]
Zudem müsse man bei mehreren, direkt aufeinander folgenden Dissonanzen »auch den Ausdruck durch Verstärkung des Tones, und der Vermehrung der Stimmen, immer mehr und mehr wachsen, und zunehmen lassen« (vgl. die beiden Dominantseptakkord-Umkehrungen in T. 6).[21]
Die dynamischen Bezeichnungen stimmen überwiegend mit der Quantzschen Klassifizierung überein. Jedoch wird im Probestück die zugunsten eines ausgeglicheneren Dynamikgefälles aufgestellte Regel an einigen Stellen durchbrochen: In den Takten 36f. und 38f. werden die Akkorde der Fortissimo-Klasse (verminderter Septakord über A bzw. übermäßiger Sextakkord über ces) aufgrund des vorausgehenden Piano bzw. Pianissimo nicht zur zweiten bzw. ersten Klasse ›degradiert‹. Vielmehr scheint es umgekehrt, dass die Akkorde (Dreiklänge = mp) vor dem Fortissimo-Klang eine oder gar zwei Dynamikklassen überspringen, um ein zu steiles ›Gefälle‹ zu vermeiden (z.B. in T. 10f., 14f., 21). Mit anderen Worten: Treten Akkordtypen der dritten Klasse auf, werden sie gemäß der Vortragsanweisung Affettuoso di molto gleichsam ohne Rücksicht, aber auch ohne Vorsicht (nach jedem ff tritt stets ein Piano auf) entsprechend auch im Fortissimo gebracht. Wenn auch die von Akkord zu Akkord wechselnden, heute extrem wirkenden dynamischen Schattierungen auf dem Cembalo und auf dem Clavichord, aber auch auf dem noch wenig dynamisch kontrastreichen Pianoforte des 18. Jahrhunderts nicht so dramatisch-zersplittert geklungen haben mögen, so ist die Quantzsche Akkordklassifizierung mit ihrer ›dynamischen Analyse‹ im Probestück ein wichtiges Zeugnis des ›empfindsamen Stils‹, der sich im Unterschied zur Affekteinheit des Barock die »abwechselnden Leidenschaften«[22] auf die Fahnen geschrieben hat.[23]
19. Jahrhundert
Die Vortragslehren des 19. Jahrhunderts führen, wie gesagt, diese Tendenz der Dissonanzdifferenzierung nicht fort, sondern reduzieren sie auf die prinzipielle Feststellung, dass dissonierenden Akkorden mehr Nachdruck zukomme, als der nachfolgenden Auflösung. Die Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule op. 500 von Carl Czerny ist ein wichtiges Dokument für die Frage nach der aufführungspraktischen Interpretation von Harmonik und zwar insbesondere auch aufgrund des theoretischen Anspruchs. Aus dem 1839 veröffentlichten dritten Teil Von dem Vortrage seien im Folgenden einige Beispiele zitiert:[24]
Abb. 7: Czerny, Von dem Vortrage (1839), § 6, 9
Neu ist gegenüber der Zeit der ›allgemeinen Vortragslehre‹ des 18. Jahrhunderts, dass jetzt der Komponist, seine künstlerische Absicht gegen die ›Natur‹, gegen das Normative wenden kann, und zwar mit bewusst gesetzten ›Ausnahmen‹. Das gilt insbesondere für die Tatsache, dass dissonante Akkorde auch »sanft« gespielt werden können, ja sogar in manchen Fällen durch die dynamische Rücknahme »mehr Wirkung« erreicht wird:
Abb. 8: Czerny, Von dem Vortrage (1839), § 8, 26f.
In diesem Beispiel, das den viertaktigen Mittelteil eines 16-taktigen Übungsstücks in A-Dur darstellt, sind der verminderte Septakkord in Takt 9 und der Dominantquintsextakkord in Takt 10 im sf bzw. f hervorzuheben (nach Quantz die dritte und zweite Klasse), der folgende dominantische Sekundakkord (T. 10) und der verminderte Septakkord in Takt 11 (letztes Viertel) sind dagegen ins Piano zurückgenommen. Neu in der Interpretationsgeschichte ist auch, dass dissonante Akkorde nicht nur dynamisch, sondern auch agogisch Beachtung finden. Czernys Kommentar zu obigem Notenbeispiel beansprucht darin auch über den konkreten Zusammenhang hinaus Allgemeingültigkeit: Im Ritardando des elften Takts solle »der letzte dissonirende Accord sehr sanft« gespielt, also dynamisch zurückgenommen werden, gleichzeitig aber »noch etwas mehr zurückgehalten« werden, also agogisch retardieren, weil, wie Czerny betont, »jeder [Hervorhebung vom Autor] dissonirende Accord, (wenn er piano ist) auf diese Weise mehr Wirkung macht«.[25] Können das Diminuendo und Ritardando des verminderten Sektakkords im elften Takt noch formal als Rückleitung zur Reprise begründet werden, so steht der Subito-Piano-Sekundakkord in der zweiten Hälfte von Takt 10 als klangliches Ereignis für sich: Der schmerzlich-affekthaltige Akkord des 18. Jahrhunderts scheint ins Gegenteil gewendet. Was hier beim Klassizisten Czerny noch nebeneinander steht – zwei Klänge derselben Quantzschen zweiten Dissonanzklasse, zum einen der Quintsextakkord im Forte, zum anderen der Sekundakkord im Piano – kann nun in der Zuordnung zwischen Akkord und Dynamik völlig umgekehrt werden. Von geradezu romantischer Diktion ist folgende gewagte Spielanweisung Czernys:
Abb. 9: Czerny, Von dem Vortrage (1839), Kap. 6, »Über den Gebrauch der Pedale«, 45
Die im Pianissimo zu spielenden verminderten Septakkordfolgen (T. 2f.), die noch bei Quantz mit einer ins Fortissimo sich steigernden Wucht zu interpretieren waren, werden durch das permanent niedergedrückte rechte und das verschobene linke Pedal zu einem clusterähnlichen, geheimnisvoll-nebelhaften Naturlaut transformiert, was Czerny entsprechend mit den romantischen Symbolen der »Äolsharfe« (Windharfe) und der »Musik aus der Ferne« beschreibt.
Im Zuge der ästhetischen Umwertung von dissonanten Akkorden mit vormals negativ besetzten Affekten zu positiven Ausdruckswerten[26] werden neue aufführungspraktische Möglichkeiten erschlossen: Die Ausdrucksskala beispielsweise des verminderten Septakkords weitet sich vom kreischendem Barrabas-Schrei in Bachs Matthäus-Passion zum mystischen Natursäuseln oder stillen Schmerz im 19. Jahrhundert. Umgekehrt erhalten die vormals eher ausdrucksneutralen konsonanten Dreiklänge, denen bei Quantz das dynamisch flexible Mezzopiano zugewiesen wurde, im Zuge des romantischen Historismus neue Bedeutung. Emphatisch beschreibt E.T.A. Hoffmann in seinem Aufsatz Alte und neue Kirchenmusik die zu seiner Zeit neuartige Wirkung der alten Klänge in Palestrinas Musik:
Ohne allen Schmuck, ohne melodischen Schwung folgen meistens vollkommene, konsonierende Akkorde aufeinander, von deren Stärke und Kühnheit das Gemüt mit unnennbarer Gewalt ergriffen und zum Höchsten erhoben wird.[27]
Diese gewaltig-kraftvolle Wirkung reiner Dreiklänge ist es, welche dann auch in zeitgenössische Kompositionen des 19. Jahrhunderts einfließt, insbesondere in hymnenhafte Schlussapotheosen von Symphonien oder andere choralartige Stellen. In diesem Fall kann man von einer partiellen bzw. optionalen Umkehrung der Klang-Dynamik-Relation im 19. Jahrhundert sprechen: Dissonante Akkorde können nun auch im Piano, konsonante Akkorde auch im Forte interpretiert werden.
20. Jahrhundert
Viele Interpreten des 20. Jahrhunderts haben die romantische Auffassung weitertradiert und auch auf die Musik der Klassik oder sogar auf die des Barock rückübertragen. Gegen diesen »traditionellen Interpretationsmodus«[28], insbesondere die Dissonanzen romantisch zu verklären oder schlimmstenfalls durch Überspielen zu verharmlosen, hat sich Theodor W. Adorno gewandt. In seinen Skizzen »Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion« (1946–59) notiert er:
Dissonanzen spielen. Darin spielt Geschichte. Unter der Vorherrschaft der Tonalität treten sie zurück. Teleologisch haben sie, die Akzidentien, als das treibende Wesen sich enthüllt, während die vorgegebene, abgegriffene Tonalität der Bestätigung nicht mehr bedarf. Die Interpretation muß die Dissonanzen ins Licht rücken. – Sehr Verwandtes gilt für die schlechten Taktteile.[29]
In diesem Sinn kritisiert Adorno den Dirigenten Bruno Walter als »lyrische[n] Theaterkapellmeister, ohne Sinn fürs Antithetische, Durchbrechende« und belegt dies unter anderem mit der lapidaren Bemerkung: »In der Egmont-Ouvertüre vertuscht er die Dissonanzen«.[30] Da Adorno mit einem Stichwort zum Seitensatz fortfährt, bezieht er sich wahrscheinlich auf die Takte 6 und 8 der langsamen Einleitung:
Abb. 10: Ludwig van Beethoven, Ouvertüre zu Goethe’s Egmont (T. 5–7)
Bei dieser frei imitierenden Stelle treten frei abspringende und einsetzende Dissonanzen auf: In Takt 6 kollidiert der Ton g1 der ersten Klarinette mit dem f2 der ersten Oboe, worauf das c1 im ersten Fagott mit dem d2 der Klarinette zusammenstößt. Ihre schmerzliche Wirkung im Sostenuto sollte nach Adorno eben nicht überspielt bzw. »vertuscht«, sondern ins Licht gerückt werden. Adorno vertritt damit einen »aktualisierenden Interpretationsmodus«[31], bei dem Vergangenes aus dem Geist der Gegenwart reflektiert wird. Seine Erfahrungen mit der Neuen Musik lassen ihn Dissonanzen in älterer Musik als Antithetisches, Widersprechendes, Subkutanes ansehen[32], dessen Geschichtsträchtigkeit (als »Tendenz des Materials« zur emanzipierten Dissonanz) durch die moderne Interpretation zu neuem Leben erweckt werden soll.[33]
Für die neue Musik des 20. Jahrhunderts sind noch zwei theoretische Entwürfe zur Dissonanzgraduierung zu erwähnen, die für die Aufführungspraxis fruchtbar gemacht werden können. Es handelt sich dabei um die bereits erwähnten Komponisten und Theoretiker Paul Hindemith und Ernst Krenek. Erst diese beiden haben die Quantzsche Dissonanz-Klassifizierung nach 200 Jahren weiter differenziert. Hindemith versteht unter dem von ihm geprägten Begriff ›harmonisches Gefälle‹ »das im Spielen mit den Wert- und Spannungsunterschieden sich ergebende Auf und Ab der Klänge«.[34] Harmonischer Wert (Grundtonstabilität eines Akkordes) und Spannung stehen im umgekehrt proportionalen Verhältnis:
Da aber in unserer Akkordtabelle von Abteilung zu Abteilung, von Untergruppe zu Untergruppe die harmonische Spannung der Akkorde im gleichen Maße anwächst wie der harmonische Wert nachlässt, bedeutet ein Akkordschritt von einem besseren zu einem schlechteren [weniger wertvolleren] Akkord eine Erhöhung, der umgekehrte Weg ein Nachlassen der Spannung.[35]
Dabei verkörpert die Gruppe IV die höchste dissonante Anspannung, während die Gruppen V und VI aufgrund ihrer »unbestimmbaren« Grundtönigkeit die niedrigsten harmonischen Werte darstellen. Die sechs Gruppen der Hindemiths Buch beigefügten »Tabelle zur Akkordbestimmung« seien hier in Erinnerung gerufen und der besseren Übersichtlichkeit zu Akkordtypen zusammengefasst (bei den tiefer gestellten arabischen Ziffern bedeutet eine 1 grundstellige und eine 2 nicht-grundstellige Klänge oder, wie Hindemith sagt: »Grundton liegt höher im Akkord«):
I1 (grundstelliger Dur- und Molldreiklang); I2 (Umkehrung)
IIa (grundstelliger Dominantseptakkord); IIb1 (grundstellige Klänge mit großer Sekunde und kleiner Septime); IIb2 (Umkehrungen); IIb3 (mit mehreren Tritoni)
III1 (grundstellige Klänge ohne Tritonus mit Sekunden und Septimen); III2 (Umkehrung)
IV1 (grundstellige tritonushaltige Klänge mit kleinen Sekunden und großen Septimen); IV2 (Umkehrung)
V (übermäßiger Dreiklang, Quartenakkord; Grundton »unbestimmbar«)
VI (verminderter Drei- und Vierklang; Grundton »unbestimmbar«)
Die unterschiedlichen Spannungsgefälle veranschaulicht Hindemith in graphischen Flächen, die an schraffierte Crescendo- und Decrescendozeichen erinnern. Dabei gibt es viele Möglichkeiten der Gestaltung: Das ›Gefälle‹ kann stetig ansteigen und wieder abfallen:
Abb. 11: Hindemith, Unterweisung (1940), 192, Nr. 119
Das Gefälle kann steil ansteigen, sich auf gleichem Niveau halten, um schließlich vermittelt wieder abfallen:
Abb. 12: Hindemith, Unterweisung (1940), 147, Nr. 77
Es kann auch wellenförmig an- und abschwellen:
Abb. 13: Hindemith, Unterweisung (1940), 147, Nr. 76
Für Hindemith entsteht im Gefälle ein »harmonisches Crescendo und Diminuendo«.[36] Anders als im Quantzschen Begriff der »proportionirlichen Stärke«[37] oder in Hugo Riemanns »harmonischer Dynamik«[38], der jeweils real klingend gedacht ist, meint Hindemiths Begriff zunächst nicht das »rein dynamische Zu- und Abnehmen, dessen Zumessung stets im Machtbereiche des ausführenden Spielers oder Sängers liegt«.[39] Das »harmonische« als inneres, dem Wesen der Klänge anhaftendes »Crescendo und Diminuendo« wird nach der analytischen Bewusstwerdung gleichsam unbewusst-reflexartig auch nach außen dringen. Hindemiths Differenzierung der Spannungsgrade nicht mehr konventioneller Akkorde und seine dynamisch-suggestive Darstellung im »harmonischen Gefälle« kann eine wertvolle Interpretationshilfe moderner Harmonik sein.
Eine weitere, vereinfachte Systematik bietet Ernst Krenek in seinen Zwölfton-Kontrapunkt-Studien von 1940. Er geht von einer im Prinzip derjenigen Daniel Gottlob Türks ähnlichen Dreiteilung aus. Neben den Konsonanzen stehen sich »Dissonanzen von geringer Spannung (›milde‹ Dissonanzen)« wie große Sekunden und kleine Septimen und »Dissonanzen von stärkere Spannung (›scharfe‹ Dissonanzen)«[40], wie kleine Sekunden und große Septimen, gegenüber. Aus der Kombination der drei Kategorien stellt Krenek nach dem Baukastenprinzip sechs Spannungsgrade dreitöniger Klänge zusammen:
Abb. 14: Krenek, Zwölfton-Kontrapunkt (1952), Sechs »Spannungsgrade der Akkorde«, 31f.
Krenek gibt noch zu bedenken, »dass in der praktischen Komposition die Spannungsgrade vielfältigen Modifikationen unterworfen sind, die von der Lage der Intervalle, der Dynamik, der Instrumentation usw. abhängen.«[41] Zwar erscheint die Dynamik im Unterschied zur Vortragslehre des 18. Jahrhunderts nicht als interpretatorische Folge des vorhandenen Dissonanzgrades, sondern, wie die Instrumentation, als eine vom Komponisten vorgegebene Bedingung für die Klangwirkung; dennoch ist die Dynamik, ähnlich dem »harmonischen Gefälle« Hindemiths, kompositorisch ausgeformten Klängen implizit. Krenek formuliert dies tendenziell:
[…] schärfere Dissonanzen werden die Höhepunkte einleiten und hervorheben, die abnehmende Intensität des musikalischen Ablaufs hingegen wird durch mildere Akkorde charakterisiert sein.[42]
Auch hier ist der Interpret indirekt aufgerufen, die verschiedenen Spannungsverläufe im formalen Geschehen nachzuvollziehen und umzusetzen.
Die Geschichte der aufführungspraktischen Interpretation von Dissonanzen lässt sich im groben Ablauf wie folgt auf den Punkt bringen:
Zeit | 18. Jahrhundert | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert |
Dynamik | im Forte-Bereich | auch im Piano | wieder prägnanter, schärfer |
Begründung | Affekte erregen | romantische Ästhetik des Geheimnisvollen, Verschleiernden | Deutlichkeit, Wahrheit |
Abb. 15: Tabelle zum historischen Wandel der Dissonanz
Diatonik – Chromatik
18. Jahrhundert
In der abendländischen Musiktheorie vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert wurde die Diatonik als das Reguläre, Normhafte, die Chromatik hingegen als das Abweichende, Fremde, Besondere betrachtet. Jahrhunderte lang weigerte sich die Musiktheorie, die in der musikalischen Praxis immer häufiger und wichtiger werdenden chromatischen Töne ins reguläre Tonsystem aufzunehmen und unterschied zwischen ›musica vera‹ und ›musica ficta‹ bzw. ›musica falsa‹. Bezeichnete noch Christoph Bernhard (um 1660) chromatische Schritte als »Passus duriusculus« (harter Schritt) und empfahl, sich vor diesen »unnatürlichen Gängen [zu] hüten«,[43] so hebt Andreas Werckmeister 1707 die Vorteile der Chromatik hervor:
Hingegen kann man die so genannten Chromatischen Semitonia auf gewisse Arth in alle Modos regulares zufälliger weise einmischen, damit man eine Veränderung habe, und die Bewegungen des Gemüthes desto mehr erregen könne.[44]
Unter dem Druck der kompositorischen Praxis, die von den neuen »wohltemperierten« Stimmungen Gebrauch machte, wurde das Tonsystem nun als »vermischtes« gesehen, in dem alle Töne, auch enharmonisch, zu gebrauchen waren. Ästhetisch wurden Diatonik und Chromatik allerdings bis ins 19. Jahrhundert als Gegensätze begriffen. Johann Philipp Kirnberger schreibt in Sulzers Allgemeiner Theorie der schönen Künste den beiden musikalischen Erscheinungen konträre Ausdrucksebenen zu:
Die Fortschreitung [der Melodie] durch diatonische Stufen hat etwas leichtes und Gefälliges; die chromatische Fortschreitung durch halbe Töne etwas schmerzhaftes, auch bisweilen etwas Fürchterliches. […] Ein solcher [chromatischer] Gang drukt also natürlicher Weise allemal etwas aus, das dem freyen Wesen der größern diatonischen Fortschreitung entgegen ist, und dienet insbesondere, solche Leidenschaften auszudruken, die das Gemüth in eine Beklemmung setzen, und etwas Trauriges haben, Schmerz und Betrübniß, Schreken, Furcht und auch Wuth. Da aber die chromatische Fortschreitung im Grunde die Schönheit des Gesanges und der Harmonie hemmet, so muß sie in einem Stük nicht allzu oft, sondern nur an den Stellen angebracht werden, wo der Affekt besonders auszuzeichnen ist.[45]
Wie die Dissonanzen, werden daher auch die chromatischen Töne als musikalisches Mittel zur Affektsteigerung und Intensivierung des Ausdrucks verwendet und sind daher mit Nachdruck bzw. Forte auszuführen. C.Ph.E. Bach stellt dazu eine Regel auf, derzufolge die Ausführung von chromatischen Tönen unabhängig von deren konsonanter oder dissonanter Einbindung ist:
Man kann allenfalls auch diese Regel mercken, welche nicht ohne Grund ist, daß die Töne eines Gesangs, welche ausser der Leiter ihrer Ton-Art sind, gerne das forte vertragen, ohne Absicht, ob es Con- oder Dissonanzen sind, und daß gegentheils die Töne, welche in der Leiter ihrer modulirenden Ton-Art stehen, gerne piano gespielt werden, sie mögen consoniren oder dissoniren (c).[46]
Dazu gibt er folgendes Notenbeispiel:
Abb. 16: Bach, Versuch, Teil 1 (1753), Fig. XIV (c)
Bach setzt hier seine Regel konsequent um: dissonanten Klänge, die diatonisch sind, stehen im Piano, und umgekehrt sind konsonante Klänge mit chromatischen bzw. tonartfremden Tönen im Piano zu spielen. Das führt für den heutigen Hörer bzw. Spieler zu paradoxen und befremdenden Situationen: die Akkorde mit Vorhalten (Quart-, Sept- oder Nonen-Synkopendissonanzen) erscheinen durch das vorgeschriebene Piano leicht, die jeweiligen Auflösungen durch das Forte schwer, und zwar ›nur‹, weil sie einen tonartfremden Ton beinhalten, und sei es auch nur eine picardische Terz (wie beispielsweise im fünften Akkord). Die gewohnten Akzentverhältnisse der Synkopendissonanz erscheinen auf den Kopf gestellt: Vorbereitung und Auflösung der Dissonanzen sind metrisch schwer, der Dissonanzeintritt selbst ist leicht. Dies hat die ungewohnte Folge, dass sämtliche dominantischen Akkorde (auch die auf der erst später als leitereigen anerkannten Durdominante in Moll) nichtauftaktig-dynamisch zu ihrer Tonika führen, sondern abtaktig betont stehen. Das von Bach metrisch-rhythmisch neutral ohne Taktstriche notierte Beispiel bildet durch die dynamischen Zeichen Akkordpaare aus, deren Schwer-Leicht- bzw. Dominant-Tonika-Gefälle unseren heutigen, vom 19. Jahrhundert geprägten metrischen Vorstellungen genau entgegengesetzt ist. Weist Bach damit bereits auf die für Beethovens Musik so charakteristischen Akzentverschiebungen voraus?[47]
Es gibt aber auch eine praktische Erklärung für Bachs Dynamik: Würde er neben den chromatischen auch noch die dissonanten Akkorde betonen, so müssten durchgehend (bis auf den konsonanten und diatonischen d-Moll-Dreiklang) alle Akkorde unmittelbar aufeinander folgend im Forte gespielt werden (dieses Problem ergibt sich im oben angeführten Notenbeispiel zur Demonstration der Konsonanz-Dissonanz-Regel nicht, da dort Dissonanz und tonartfremder Ton in einem Akkord zusammenfallen). Um den Ausdruck zu differenzieren, ist für Bach Chromatik offensichtlich das primäre, Dissonanz dagegen das sekundäre Kriterium. Diese höhere Sensibilität für Chromatik als das gegenüber der Dissonanz Besonderere, geht zurück auf die neue Ästhetik des Einfachen und Natürlichen, die sich bewusst von der als »schwülstig und verworren« (Johann Adolph Scheibe) empfundenen Musik des Barock, insbesondere der J.S. Bachs, abkehrt. Gegenüber der stetig im modulatorischen Fluss sich befindlichen chromatischen Harmonik J.S. Bachs entwickelt die Musik der Frühklassik durch Reduktion auf eine prinzipiell diatonische Kadenzharmonik die Vorstellung von Tonart als zentripetalem Kräftefeld. Jede Infiltration der Diatonik durch tonartfremde Töne wird dadurch bewusster und sensibler wahrgenommen. Insofern kann Chromatik bei C.Ph.E. Bach zu einem primären aufführungspraktischen Kriterium werden.
19. Jahrhundert
Galt also die Chromatik im 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund der diatonischen Norm als das auch in den Vortragslehren betonte Besondere, Abweichende und darum Nachdrückliche im Ausdruck[48], so wurde dieser Aspekt im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend irrelevant. Denn durch das Vordringen der vollchromatischen Alterationsharmonik wurde der Unterschied zwischen Diatonik und Chromatik immer mehr verwischt und teilweise ganz aufgegeben. Chromatische Einzeltöne oder Akkorde werden tendenziell zur Regel und sind dann kein Ereignis mehr, das es herauszustellen gälte: Bei Max Reger etwa gäbe es andernfalls kaum mehr eine Partie unterhalb der Fortegrenze. Während Dissonanzen auch in der Atonalität, in der sie eher die Regel, Konsonanzen hingegen die Ausnahme sind, in Form eines Spannungsfeldes differenziert werden können (s. Hindemith oder Krenek), ist eine Abstufung innerhalb der Chromatik schlechterdings unmöglich; zum einen, weil es innerhalb der gleichstufig temperierten Stimmung keine graduellen Unterschiede mehr gibt, und zum anderen, weil chromatische Töne ihre qualitative Bedeutung als Leit- bzw. Strebetöne verlieren.
Enharmonik
Wie lässt sich ein Ton oder ein Akkord interpretieren, der in sich zwei entgegengesetzte harmonische Bedeutungen vereint? Diesem paradoxen Phänomen der Enharmonik, das E.T.A. Hoffmann »unisonierender Dualismus«[49] nannte, sprach man im 18. und 19. Jahrhundert eine »große Wirkung«[50] zu. Der Charakter der Enharmonik sei »das Unerwartete und Ueberraschende«[51], sie sei zum »Ausdruck solcher Leidenschaften [geeignet], die etwas schmerzhaftes haben, oder schnell eine andere Wendung nehmen«[52], sie gehöre zu den »frappantesten Mitteln« zur Erzielung »pikanter Effekte«[53], die »geheimnisvolle und überraschende«[54] Wirkung beruht auf einem »kleinen Betrug«[55] des Ohrs, der »Täuschungen«[56] oder »Zwiespältiges«[57] zum Ausdruck bringen könne.
Für die aufführungspraktische Realisierung dieses »frappanten« musikalischen Ausdrucksmittels gab es im 18. Jahrhunderts zuvörderst zwei Möglichkeiten: bei Sängern, Streichern und Bläsern war es die Intonation; bei Tasteninstrumenten waren es Dynamik und Agogik. Die sogenannte »akustische Enharmonik«[58] mit nicht nur vorgestelltem, sondern hörbarem Tonhöhenunterschied ist ein Relikt aus der griechisch-antiken Genoslehre und deren Wiederbelebungsversuchen im 16. Jahrhundert (Tastenspaltung in verschiedene Tonhöhen auf dem Arcicembalo, z.B. in cis- und des-Taste), das bis ins 18. Jahrhundert hinein wach blieb. Für Kirnberger würde die Einführung von »kleinsten enharmonischen Intervallen […] in manchen Fällen der Ausdruck der Leidenschaften sehr viel stärker werden«.[59] Die Empfindung des enharmonischen Unterschieds selbst auf temperierten Tasteninstrumenten sei »so groß, daß gute Sänger eine würkliche Rükung in der Stimme machen […] und eben dieses tun auch die guten Spieler«.[60] So fordert Jean-Jacques Rousseau für Christoph Willibald Glucks Furienszene aus Orpheus es Euridice, dass der Ton h beim »Nò« des Furienschreis höher als das ces im Bass des Orchesters intoniert werden sollte, um einen beabsichtigten »Missklang« zu erreichen. Dies führt zu einer »simultanen Enharmonik«:[61]
Die übermäßige Sept, die diese beiden Töne darzustellen scheinen, überschreitet sogar die Oktav, und durch eben diese Überschreitung kommt der Missklang des Furienschreis zustande, weil die mit der Auflösung des b zum h verbundene Vorstellung eines Leittones die Stimme natürlicherweise höher treibt als nur bis zur Oktav des ces der Bässe; es versteht sich, dass der Effekt dieses Schreis sich auf dem Klavier nicht so herstellen lässt wie wenn man singt, weil die Tonhöhe auf dem Instrument nicht in gleicher Weise modifiziert werden kann.[62]
Abb. 17: Christoph Willibald Gluck, Orpheus ed Euridice, 2. Akt, 1. Szene (Orpheus und Chor: »Ach erbarmet, erbarmet euch mein«, T. 133–137)
Hinsichtlich einer flexiblen Intonation bestehen heute unter historisch-theoretischem und ästhetischem Blickwinkel prinzipiell zwei gegensätzliche Möglichkeiten: Die Terz eines Durdreiklangs wäre im Hinblick auf eine in sich ruhende Tonika als reine Terz tiefer zu nehmen als in der gleichstufigen Stimmung; im 19. Jahrhundert bestand gegenüber dieser vertikalen Auffassung die Tendenz, große Terzen als Leittöne höher, also zielgerichtet-dynamisch (linear) zu intonieren.[63] Die intonatorische Interpretation länger gehaltener enharmonischer Töne könnte beispielsweise bei einer Umdeutungsmodulation eines Dominantseptakkords in einen übermäßigen Quintsextakkord zu einem durch glissandoartiges Anheben der Septime f zum Leitton eis von statten gehen, wie dies auch die Geiger seit dem 19. Jahrhundert praktizierten. Freilich ließe sich fragen, ob der enharmonische Überraschungseffekt nicht durch eine solche tendenzielle Intonation eher geschmälert, durch ein gleichsam neutrales, gleichschwebendes Mittel auf konstanter Tonhöhe hingegen verstärkt würde. Und vielleicht könnte man auch soweit gehen, die leittönig-dynamischen Annäherungen an das Ziel umzukehren und die enharmonische Verwandlung in die entgegengesetzte Richtung des Auflösungsziels intonieren, was gleichsam einen ›enharmonischen Intonations-Trugschluss‹ zur Folge hätte.
Auch wenn bei Tasteninstrumenten die aufführungspraktische Möglichkeit einer akustischen Realisierung der enharmonischen Unterschiede durch Intonation wegfällt, so begnügten sich die Theoretiker, Komponisten und Ausführenden des 18. Jahrhunderts nicht mit der bloßen Vorstellungskraft enharmonischer Umdeutungen. Diese sollten durch einen entsprechenden Vortrag ›hörbar‹ gemacht werden. Jean-Philippe Rameau beschreibt den enharmonischen Effekt in seinem Cembalostück mit dem programmatischen Titel L’Enharmonique folgendermaßen:
Der Effekt, den im zwölften Takt die Reprise [des Stücks] L’Enharmonique hervorruft, wird vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein. Man gewöhnt sich jedoch daran, wenn man sich darum bemüht, und man fühlt darin auch die ganze Schönheit, wenn man den ersten Abscheu überwindet, den der Makel der Gewohnheit in diesem Fall verursachen kann. Die Harmonie, welche diesen [enharmonischen] Effekt hervorruft, ist keine zufällige; sie ist logisch begründet und von der Natur gestattet: Für die Kenner ist er das Pikanteste; aber die Ausführung muss hier der Intention des Autors folgen, indem man den Anschlag zärtlicher macht und den [musikalischen] Fluss mehr und mehr aufschiebt, bis man zum Höhepunkt gelangt ist und hier muss man einen Moment innehalten, wie es das Fermatenzeichen angibt.[64]
Abb. 18: Jean-Philippe Rameau, L’Enharmonique (Nouvelles Suites de pièces de clavecin), T. 45–57
Bei der angeführten Stelle aus dem zweiten Teil (›Reprise‹) des Stücks handelt es sich um einen von der Haupttonart g-Moll ausgehenden und in das flüchtig berührte f-Moll mündenden synkopierten Fauxbourdon (f-Moll wird dann Subdominantparallele der folgenden Es-Dur-Kadenz). Der enharmonische Querstand zwischen cis und des zeigt die virtuelle Umdeutung eines verminderten Septakkords an: cis-e-g-b als zu d-Moll gehörig (bleibt elliptisch) wird in e-g-b-des verwandelt und nach f-Moll aufgelöst. Damit aber die ›stumme‹ Umdeutung zu ›sprechen‹ beginnt, fordert Rameau den besagten weichen (rührenden) Akkordanschlag, verbunden mit einer agogischen Verzögerung, was kompositorisch noch durch den empfindsamen Doppelvorhalt und die Suspiratio begründet ist. Enharmonik erscheint hier als Verirrung in die fremde Tonart der Mollvariante der VII. Stufe in Moll; diese Irritation würde der Ausführende mit »gutem Geschmack«, also der gebildete Spieler, auch ohne Vortragsbezeichnung (wie das in T. 15/17 der Fall ist) zu einer kleinen ›Schrecksekunde‹ ausdehnen.
Im Unterschied zu Rameaus empfindsamerer Behandlung der Enharmonik in einem konkreten musikalischen Kontext, verlangt C.Ph.E. Bach für harmonische »Betrügereyen«, worunter er neben Trugschlüssen auch enharmonische Fortschreitungen zählt, generell das Forte:
Ein besonderer Schwung der Gedancken, welcher einen hefftigen Affeckt erregen soll, muß starck ausgedruckt werden. Die so genannten Betrügereyen spielt man dahero, weil sie offt deßwegen angebracht werden, gemeiniglich forte (b).[65]
Abb. 19: Bach, Versuch, Teil 1 (1753), Fig. XIV (b)
In beiden Notenbeispielen handelt es sich um die enharmonische Umdeutung von aufwärts strebenden zu abwärts führenden oder stabilen Tönen (Unterstimme: cis-[d]-des, Oberstimme: ais-[h]-b im ersten Beispiel und gis-[a]-as in der Oberstimme des zweiten Beispiels). Um der Erregung eines »heftigen Affekts« willen, können solche enharmonischen Verwandlungen anstelle von intonatorischen Möglichkeiten durch ein dynamisches, bei Rameau noch durch ein agogisches Vortragsmittel hörbar gemacht werden.
Ob nun durch tendenzielle Intonation oder durch Dynamik bzw. Agogik: Festzuhalten bleibt das Bedürfnis im 18. Jahrhundert, die Enharmonik nicht nur als »Sache der Auffassung und des beziehenden Denkens« (Carl Stumpf) zu betrachten, also der bloßen Imagination zu überlassen, sondern sie zu einem akustisch mitvollziehbaren musikalischen Ereignis zu machen. Selbst im 19. Jahrhundert, wo der Unterschied zwischen Diatonik, Chromatik und Enharmonik geringer, teilweise verwischt wird, gilt Enharmonik überwiegend als besonderes, im Vortrag zu berücksichtigendes Ausdrucksmittel, dem weiterhin der Ruf des »Betrügerischen« anhaftet und vor dessen allzu häufigem Gebrauch gewarnt wurde.[66]
Akkordfortschreitung und Modulation
Ungewöhnliche Progressionen
Außergewöhnliche Akkordfortschreitungen wie Trugschlüsse, Neapolitaner, Varianten oder Medianten wurden in der Vortragslehre des 18. Jahrhunderts ähnlich behandelt wie Dissonanzen und Chromatik bzw. Enharmonik: Als Abweichungen von der konsonanten, diatonischen Norm sollen sie vor allem dynamisch, später im 19. Jahrhundert auch agogisch aus dem Kontext herausgehoben werden.
Trugschlüsse
Trugfortschreitungen, in der Theorie des 18. Jahrhunderts auch »betrügerische«, »abgebrochene«, »vermiedene« oder »unterbrochene« Kadenzen genannt[67], gehören zu den für die Aufführungspraxis relevanten, formal und semantisch bedeutsamen Attraktionspunkten. Sulzer beschreibt sie als psychologisch-zeitliches Ereignis:
Ihre Würkung ist eine Ueberraschung, bey welcher man eine Zeitlang stille steht, dabey aber das Gefühl, daß ein fernerer Aufschluß erfolgen soll, behält. Man kann dadurch das Gefühl einer Verwunderung, eine Frage, oder die Erwartung einer Antwort ausdruken.[68]
Daniel Gottlob Türk stellt in seiner Klavierschule acht trugschlüssige Wendungen auf, deren Zahl er jedoch nicht begrenzt wissen will (siehe Ende des folgenden Zitats: »u.s.w.«). Er fordert für die unterschiedlichen Trugwirkungen (auch für die zuletzt angeführten rein melodischen) entsprechend verschiedene dynamische Stärkegrade:
Abb. 20: Türk, Klavierschule (1789), § 34, »Trugschlüsse«, 352
Von den damals zur Verfügung stehenden dynamischen Vortragszeichen wählt Türk Forte und Fortissimo; die Zwischengrade sind dem Spieler überlassen. In dem angeführten Beispiel sind drei Trugschlussklänge im Fortissimo zu spielen: der Dominantseptakkord über E (Nr. 4), der verminderte Septakkord über gis (vorletztes Beispiel) und der Dominantsekundakkord über f (letztes Beispiel). Die Frage, warum Türk gerade diese drei mit Fortissimo bezeichnet hat, lässt sich satztechnisch begründen. Ausschlaggebend sind wohl drei hierarchisch abgestufte Kriterien: Dissonanz, Leittonauflösung in den Grundton und ungewöhnliche Stimmführung der restlichen Stimmen. Alle drei Fortissimo-Akkorde sind dissonant, die ersten beiden verfehlen in den Oberstimmen den erwarteten Grundton und alle drei lassen eine harte Stimmführung erkennen (zwei querständige Großterzparallelen beim E7, einen Tritonussprung in den verminderten Septakkord über gis und im Bass ein gekappter Leitton im Sekundakkord über f). Erfüllen die drei Fortissimo-Akkorde alle drei bzw. einmal nur zwei Kriterien, so fehlt bei den anderen Trugschlüssen entweder das wesentliche Kriterium der Dissonanz (Nr. 1–3) oder das für die Trugwirkung so wichtige Merkmal der Leittonauflösung: Bei den dissonanten Akkorden im Forte (über es und cis) findet jeweils die melodische Auflösung (fis-g) statt. Die musiktheoretische Begründung mag vielleicht nicht restlos befriedigen, empfindet man doch auch den einen oder anderen Forte-Trugschluss Türks als sehr hart (z.B. den übermäßigen Sextakkord über es oder den verminderten Septakkord über cis). Da es sich hierbei aber, wie Türk betont, um eine graduelle Abstufung handelt, obliegt die Umsetzung bei nah verwandten Härtegraden auch dem persönlichen ›Betrugserlebnis‹ des Interpreten.
Neapolitaner, Variantklänge und Rückungen
In einer Besprechung von Mathis Lussy’s Traité de l’expression musicale von 1873 kritisiert Hugo Riemann den dynamischen Bezeichnungsvorschlag bezüglich des neapolitanischen Sextakkords in Beethovens Mondscheinsonate:
Abb. 21: Riemann 1886, 167ff.
Mit der »in der Natur der Sache« liegenden Begründung meint Riemann wohl die traditionelle operndramatische Semantik des neapolitanischen Sextakkords als Ausdrucksmittel des Klagens, Leidens, der »schmerzlichen Akzente«, wie er in seinem Elementar-Schulbuch der Harmonielehre schreibt.[69] Obwohl Riemann in seiner Beethoven-Ausgabe das Gegenteil Lussy’s vorschlägt, relativiert er schließlich doch seine Kritik mit dem Hinweis, dass auch oder gerade durch die plötzliche dynamische Zurücknahme bei Höhepunkten die Wirkung eines Akzents entsteht. Adorno spricht in Bezug auf Beethovens typische Subito-Piano-Höhepunkte von einem »dynamischem Trugschluß«.[70] Da der erste Satz der Mondscheinsonate keinen operndramatischen Charakter hat und an der Stelle mit dem neapolitanischen Sextakkord kein Höhepunkt vorliegt, ist es wohl kaum angemessen, diesen Akkord in extremer Weise aus dem Kontext herauszustellen. Beethoven, der sonst akribisch vorschreibt, wie was zu spielen ist, enthält sich bezüglich dieses für das Stück so charakteristischen Klangs in ungewöhnlicher Weise differenzierender Vortragsbezeichnungen: Außer in den Takten 16 und 18, in denen der Akkord durch eine dissonierende kleine None geschärft und von Beethoven daher durch einen Crescendo- bzw. Decrescendo-Pfeil markiert wird, verbleiben alle anderen Neapolitanerstellen im Pianissimo oder Piano. Durch die sempre-pp-Vorschrift sowie die Anweisung, dass »dieses ganze Stück […] sehr zart und mit Pedal gespielt werden« solle, verwandelt Beethoven den traditionell affekterregenden neapolitanischen Sextakkord in einen romantischen Klang der Entrückung. Der flächendeckend nocturne-artig dunkle Klang dieses Stimmungsstücks wird unterstützt von der verdunkelnden Abschattierung des neapolitanischen Akkords, der in diesem Satz nahezu leitklangmotivische Bedeutung erlangt. Diese sowohl strukturelle als auch semantische Funktion kann der Pianist mehr durch ›entrückende‹ Agogik und Farbgebung als durch Dynamik subtil unterstreichen, ohne aus dem von Beethoven vorgegebenen ›Sempre-pp-Rahmen‹ zu fallen.
Wie der neapolitanische Sextakkord gehören auch Varianten (Dur-Moll-Verbindungen), Medianten oder gar Halbtonrückungen zu den mit Chromatik verbundenen Fortschreitungen, die nach der Vortragslehre des 18. Jahrhunderts durch verstärkte Tongebung aus dem Kontext hervorzuheben sind. Stellen die letzten drei Verbindungsarten im 18. Jahrhundert noch eher außergewöhnliche Attraktionspunkte dar, so zählten sie im 19. Jahrhundert zu den häufiger verwendeten Ausdrucksmitteln, die ihre immer noch besonderen, individuellen Klangwirkungen vom Geheimnisvoll-Mystischen bis zum Mächtig-Dramatischen entfalteten. Auch wenn sie in der zweiten Jahrhunderthälfte Gefahr liefen, zu gewohnten Mitteln herabzusinken, war man sich ihrer Besonderheit immer noch bewusst. Hugo Riemann beispielsweise zeigt sich sehr empfindlich gegenüber querständig verbundenen Varianten, die zum besseren Hörverständnis durch den Interpreten besonders verdeutlicht werden müssen:
[…] die Ersetzung der Tonika durch ihre Variante [tastet] die Tonalität an und wird jederzeit vom Ohr abgelehnt werden, wenn sie nicht durch wirkliche chromatische Veränderung in derselben Stimme unzweideutig als beabsichtigt erscheint. […] Manche Komponisten – Mozart, Schubert – spielen gelegentlich mit Querstandswirkungen dieser Art; da gilt es für den Vortragenden nachzuhelfen und das Verständnis des querständigen Tones entweder durch dynamische Accentuation oder aber durch agogische, d.h. ein geringes länger Verweilen auf dem chromatisch veränderten Tone zu erleichtern.[71]
Riemann bezeichnet an anderer Stelle »diese höchst fatale Querstandswirkung« bei Dur-Moll-Wechsel als »üble Wirkung«, die »eine Trübung, ein Verwischen, einen Flecken im Tongebilde« bedeute.[72]
Der Frage, ob zum Dur-Moll-Wechsel eine allgemeine Vortragsregel aufgestellt werden könne, widmet sich Otto Klauwell in seinem 1883 erschienenen Buch Der Vortrag in der Musik. Versuch einer systematischen Begründung desselben zunächst rücksichtlich des Klavierspiels:
Dass eine Wendung von Dur nach Moll einen Uebergang vom forte zum piano zur Folge habe oder umgekehrt, scheint zwar der Natur jener beiden Tongeschlechter ganz entsprechend zu sein, erleidet aber in der Praxis der Komposition so viele vorgeschriebene Ausnahmen, dass auch ein entgegengesetzter Vortrag seine volle ästhetische Berechtigung hat.[73]
Diese Bemerkung, die Riemann »vortrefflich«[74] findet, zeigt einmal mehr, dass Ausdruck und Bedeutung von Harmonien geschichtlichen Veränderungen unterworfen waren: Das Jahrhunderte lang tradierte Diktum Gioseffo Zarlinos, Klänge mit grosser Terz seien ›allegro‹ und daher kraftvoll oder heiter, Klänge mit kleiner Terz dagegen ›mesto‹ und daher zurückhaltend-traurig zu interpretieren, wurde zwar (auch noch von Otto Klauwell und Hugo Riemann) als ›natürlich‹ empfunden; dennoch sah man sich unter dem Druck der Vielfalt kompositorischer Lösungen gezwungen, auch die künstlerische Verkehrung der vermeintlich natürlichen Verhältnisse in ihr Gegenteil ästhetisch zu legitimieren. Die von der Kunst durchkreuzte vermeintliche Natur erlaubt keine allgemeinverbindliche Regel. Franz Schubert hat die ausdruckshafte Dur-Moll-Ambivalenz im ersten Satz seines Streichquartetts G-Dur, D 887 thematisiert: Der Beginn würde mit dem Anschwellen des G-Dur-Dreiklangs im Piano zu seiner Mollvariante im Fortissimo in diesem Sinne gegen die ›natürliche‹ Dynamik verstoßen; in der Reprise (T. 278ff.) wird diese Folge umgekehrt und damit die ›natürliche Ordnung‹ wiederhergestellt; in den letzten acht Takten des Satzes kulminiert der »Kampf der (Ton-) Geschlechter« in eine doppelchörig verzahnte, eintaktig verdichtete Imitation zwischen hohen und tiefen Streichern, die Dur und Moll im wechselseitigen dynamischen Schlagabtausch formulieren, bis sich schließlich die ›Natur‹ des kräftig-›männlichen‹ Durdreiklangs durchsetzt.
Harmonische Rückungen wie Medianten, chromatische Grundtonfortschreitungen und Tritonusprogressionen gehören auch im späten 19. Jahrhundert noch zu den einschneidenden, den ›logischen‹ Kadenzzusammenhang aufbrechenden Mitteln, die sich zu klangsinnlichen Eigenmomenten verselbständigen:
Besonders zahlreich werden hierbei mit der Steigerung romantischen Kunstcharakters neben den chromatischen die mediantischen Fortschreitungswirkungen aller Art: Rückungen von Klängen, deren Grundtöne um eine große oder kleine Terz, aufwärts oder abwärts, von einander abstehen, ohne […] einer Tonart anzugehören, lenken auf ihre grellen und vielfachen Reize; auch zu unmittelbaren Fortschreitungen von Klängen, deren Grundtöne um verminderte Quinten, übermäßige Quarten und sonstige alterierte Intervalle von einander entfernt sind, greift die romantische Farbenfreudigkeit. Solche Rückungen erscheinen schon von früh an oft wie ein Keil plötzlich in die sonst noch tonal einfache Reihe der Klangverbindungen hineingetrieben; so klafft ein Riß auf, der durch Rückleitung oder verbreiterte Zusammenfassung wieder überbrückt wird.[75]
Um die ›einschneidende Wirkung‹ zu verdeutlichen, fordert beispielsweise Theodor W. Adorno für den Schnittpunkt der unvermittelt gegenüber gestellten Mediant-Flächen im ersten Satz von Beethovens 6. Symphonie (T. 162f.: B-D und T. 208f.: G-E) eine minimale artikulatorische Trennung:
Harmonische Verhältnisse müssen durch die Form dargestellt werden. Rückungen etwa, im Gegensatz zu Modulationen, durch Plötzlichkeit, Unvermitteltsein, also minimale Luftpausen. Durchführung der Pastorale.[76]
Aufgrund des von Beethoven vorgeschriebenen durchgehenden Crescendos wäre hier weniger eine dynamische als eine agogische Phrasierung möglich. Adorno, der aus der Sicht der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts in Beethovens Musik auch das »Antithetische, Durchbrechende«[77] betont wissen will, verhindert mit seiner Vortragsanweisung ein romantisierendes Verwischen und Zerfließen der Grenzen, wie es bei den Dirigenten seiner Zeit wohl üblich war. Dies geht auch aus seiner Kritik an Bruno Walters »phrasenverschleifender« Interpretation des zweiten Satzes (»Szene am Bach«) der Pastorale hervor (gemeint sind wohl die nahezu identischen Takte 33–35):
Auch die Phrasierung ist aus dem musikalischen Sinn zu entwickeln. Wenn z.B. im langsamen Satz der Pastorale – einem bei Beethoven völlig exterritorialen Stück – ein Takt dreimal hintereinander wiederholt wird, so bedeutet dies eine Stauung, gleichsam ein nicht Loskommen, in äußerster Absicht (Form als Mittel des Ausdrucks). Also darf auch die Interpretation nicht ›fließen‹. Mit anderen Worten, die wörtlich wiederholten Phrasen müssen, wie erneute Ansätze, durch sei’s noch so minimale Luftpausen von einander getrennt sein. Bruno Walter sucht sie widersinnig im ›Fluß‹ zu halten und lässt das Fagott ohne jede Phrasierung spielen, wie er überhaupt die Neigung hat, Phrasen zu verschleifen.[78]
Abb. 22: Ludwig van Beethoven, 6. Symphonie, 2. Satz, T. 33–35
Zwar beschreibt Adorno hier die »Form als Mittel des Ausdrucks«; die Trennung der drei Takte wird aber von der Terzrückung C-Dur–A-Dur nicht nur unterstützt, sondern entscheidend mitbestimmt. Auch diese Medianten sind also, wie im ersten Satz, durch »minimale Luftpausen« in ihrer Unvermitteltheit herauszustellen.[79] Dem ›Philosophen der Neuen Musik‹ kommt es also generell darauf an, Dissonanzen und auffällige, unkonventionelle Wendungen vergangener Musik nicht zu überspielen, zu verharmlosen, oder romantisch zu verklären, sondern deutlich zu artikulieren (»Dissonanzen ans Licht rücken«, »Luftpausen«, »ausspielen«[80], »erneute Ansätze«, »gegen das Schema zu musizieren, das Subkutaner herauszubringen«) und damit für die Interpretation in neuer Weise zu aktualisieren.
Modulation
Als Zweck von Modulation bzw. Ausweichung wurde im 18. und 19. Jahrhundert ein zweifacher benannt: Der Tonartenwechsel ist zum einen dazu da, die musikalische Mannigfaltigkeit zu fördern, zum anderen, um den Wechsel der Leidenschaften bzw. Charaktere zu verdeutlichen. Dies ist durch den ausführenden Spieler bzw. Sänger sinnfällig zum Ausdruck zu bringen. Die Wirkung einer Modulation ist von vielen Momenten abhängig. Generell galt der Modulationsweg als wichtiger als das Ziel: Ein allmählich-organisch sich entwickelnder Tonartenübergang erfordert weniger Gestaltungskraft als ein unvermittelter. Daher konzentrieren sich die Vortragslehren vornehmlich auf ›plötzliche‹ Übergänge. Der entscheidende Moment des Übergangs erfolgt durch denjenigen Akkord, der das von der Ausgangstonart abweichende Tonmaterial einführt (meist der neue Leitton) und der entsprechend hervorgehoben werden soll:[81]
Abb. 23: Türk, Klavierschule (1789), § 33 (1. und 2. Beispiel), 351
Die Modulation von g-Moll nach B-Dur im ersten Beispiel zeigt, dass der Weg interessanter ist als das Ziel: Die nahverwandten Paralleltonarten werden, statt auf einfach-diatonischem Wege (z.B. einem Moll-Dur-Parallelismus), mit einer chromatischen Rückung verbunden. Dabei werden beide Dominanten – der verminderte Septakkord von g-Moll und der Dominantseptakkord von B-Dur – schnittartig einander gegenüber gestellt. Das Forte-Zeichen erhält aber nicht der elliptisch bleibende, dissonantere verminderte Septakkord, sondern seine unerwartete Fortführung in den Dominantseptakkord der Zieltonart. Nicht die an sich harmlose Stimmführung vom fis zum f bei liegenbleibenden Oberstimmen wird hervorgehoben[82], sondern das überraschende Umschwenken auf ein neues tonales Ziel. Türk führt nach diesem Beispiel überwiegend Modulationen in entfernte Tonarten an, wie das zweite von Carl Heinrich Graun. Hier handelt es sich um eine enharmonische Modulation von c-Moll nach Fis-Dur. Dabei wird ein b-Moll-Sextakkord enharmonisch in einen Cis-Dur-Septakkord verwandelt, der sich als Dominante nach Fis-Dur auflöst. Diese Fortschreitung suggeriert die bekannte phrygische Wendung mit dem (doppeldominantischen) übermäßigen Quintsextakkord, der sich als des-f-h in den C-Durdreiklang auflösen würde. Die Überraschung besteht darin, dass der Ton h über dem Basston des nicht als Leitton aufwärts, sondern über dem enharmonisch verwechselten Basston cis als Septime abwärts geführt wird. Und genau in diesem Moment wird der nichts ahnende Hörer durch das Forte auf ein überraschendes Ereignis hingewiesen bzw. vorgewarnt. Es ist aber auch eine zweite Deutung möglich. Die Verbindung von c-Moll mit dem b-Moll-Sextakkord verweist auf die mögliche Ausgangstonart As-Dur, in der diese beiden Akkord über der dritten und vierten Skalenstufe zu einer Kadenz ansetzen. Die Fortsetzung von der IV. zur V. Stufe (des-es) wird jedoch jäh unterbrochen durch den anstelle der Dominante Es-Dur unerwartet einsetzenden Cis-Dur-Septakkord. Das Forte würde bei dieser Auffassung an der von Türk regulär vorgesehenen Stelle des hörbar nachvollziehbaren Umschlagens in die Zieltonart stehen. Die überraschende Wirkung läge hier im Gegensatz zur ersten Deutung nicht auf dem Fis-Dur-Akkord, sondern bereits auf dessen Dominante.
Carl Czerny nimmt in seinen beiden Modulationsbeispielen aus dem dritten Kapitel »Von den Veränderungen des Zeitmasses« die Dynamik als vom Komponisten gegebene Vorschrift an und fordert, dass »jeder plötzliche Übergang in eine andere Tonart […] auch durch eine Aenderung des Tempo herausgehoben werden« muss.[83]
Abb. 24: Czerny, Von dem Vortrage (1839), § 9, 28f.
Es handelt sich hier um eine enharmonische Modulation von B-Dur nach D-Dur mittels übermäßigem Quintsextakkord. Die Ausgangstonart soll im Fortissimo, die Zieltonart im Pianissimo erklingen. Die neue Tonart wird neben einem Diminuendo auch mit einem Ritardando vorbereitet. Obwohl die Modulation vom dunklen B-Dur ins helle D-Dur der dreigestrichene Oktavlage kulminiert, empfiehlt Czerny einen diesem Ausdruck entgegen gesetzten Vortrag des Abbauens und Zurücknehmens. Dies hängt mit der eingangs erwähnten Tatsache zusammen, dass die dynamischen Eckpfeiler als vom Komponisten vorgegeben zu betrachten sind, wonach sich die anderen Vortragsparameter zu richten haben. Ausgehend vom dynamischen Vorgaberahmen verhält sich der Vortrag zur musikalischen Entwicklung gegenläufig, was sicherlich auch Beethovens Einfluss zu verdanken ist. Im nächsten Beispiel ist es genau umgekehrt:
Abb. 25: Czerny, Von dem Vortrage (1839), § 10
Es handelt sich um dieselbe enharmonische Modulation mittels eines übermäßigen Quintsextakkords um eine Großterz aufwärts, diesmal von Es-Dur nach G-Dur. Der Kulminationspunkt beim Umkippen in die Zieltonart wird hier nun durch das dynamische Anschwellen gleichsam ›natürlich‹ erreicht. Allerdings bleibt die retardierende Vorbereitung der Modulation wie im ersten Beispiel, die somit als Konstante beim Vortrag ›plötzlicher Übergänge‹ aufgefasst werden kann. Die Agogik nach dem Erreichen des Höhepunkts ist jedoch wieder umgekehrt zum ersten Beispiel: Die neue Tonart muss mindestens »im rechten Tempo, ja beinahe etwas rascher, eintreten«. Daraus lässt sich folgende Vortragsregel nach Czerny ableiten: Jede ›plötzliche Modulation‹ muss, unabhängig von dynamischen Vorgaben, agogisch vorbereitet werden; hingegen geschieht die agogische Gestaltung nach Erreichen des Modulationsakkords in Abhängigkeit von der dynamischen Vorgabe. Wird die neue Tonart im Piano oder Pianissimo erreicht, erfolgt eine »allmähliche Rückkehr ins erste Tempo«; ist die neue Tonart im Forte bzw. Fortissimo zu spielen, muss umgehend das erste Tempo wieder aufgenommen oder sogar der Tempoverlust im vorangegangenen Ritardando durch ein bewegteres Tempo wieder aufgeholt werden. Für die Modulation kann also keine allgemein verbindliche Vortragsregel aufgestellt werden, da der Vortrag nicht allein von der musikalischen Struktur abhängt, sondern auch von den, wie Czerny sagt, »Nebenumständen« a priori gegebener Vortragsbezeichnung. Der Interpret muss also korrelativ reagieren: zum einen auf den vom Komponisten vorgegebenen Vortragsrahmen und zum anderen auf die musikalische Struktur selbst.[84]
Gewöhnliche Akkordprogressionen
Dass ungewöhnliche, von der diatonischen Kadenznorm abweichende Akkordprogressionen wie Trugschlüsse, neapolitanische Wendungen oder harmonische Rückungen von Haus aus besondere Aufmerksamkeit von Seiten des Hörers und Interpreten zufällt, scheint selbstverständlich. Wie lassen sich dagegen gewöhnliche, konsonante Akkordverbindungen wie Quint- und Terzverwandtschaften interpretieren?[85] Inwiefern können sie überhaupt sinnvoller Gegenstand eines ausdrucksvollen Vortrags sein? Ausschlaggebend für deren Interpretation ist die in der Harmonielehre des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelte Rangfolge von Fundamentfortschreitungen. Die hierarchisch abgestuften Klangqualitäten wurden dort in dreierlei Hinsicht betrachtet: die einzelne Harmonieverbindung als (absolutes) Akkordpaar für sich, die Akkordfortschreitung im Hinblick auf ihre Schlussfähigkeit bzw. Kadenzwirkung[86] und das Verhältnis der Fundamentschritte zu Metrik und Akzentstufentakt.
Akkordprogressionen per se und Kadenzfunktion
Einzelnen Akkordverbindungen wurden nach wechselnden Kriterien ästhetisch wertende Attribute zugewiesen, die dynamische Konnotationen implizieren bzw. suggerieren: so »matt« und »entscheidend«[87] bei Sechter oder »schwach« und »stark«[88] bei Schönberg. Arnold Schönberg stellt folgende Rangfolge nach den Kriterien der »Überwindung« von Tönen (gemeinsamen Tönen) und deren Bedeutungsänderung im Akkord (»Degradierung« eines Grundtons zur Terz oder »Beförderung untergeordneter Töne«[89]) auf: »überstark« sind Sekundschritte, »stark« sind Quintschritte (wobei die fallende Quinte stärker ist als die steigende) und »schwach« sind Terzschritte im Fundament (wobei der steigende Terzschritt »der relativ schwächste Schritt« ist). Diese graduell abfallende Rangfolge isoliert betrachteter Akkordpaare muss jedoch im Hinblick auf ihre Schlussfähigkeit revidiert werden: Die »überstarken« Sekundprogressionen kommen allenfalls als Trugschluss in Frage[90] und die Terzverbindungen scheiden ganz aus. Die Kadenztheorie des 18. und 19. Jahrhunderts hat mit Blick auf den letzten Kadenzschritt von der Penultima zur Ultima den verbleibenden Quint- und Sekundschritten – wiederum in ästhetisch wertenden Begriffen – unterschiedliche Schlusswirkungen zugeschrieben: Vom vollkommenen und unvollkommenen authentischen Ganzschluss über den Plagalschluss (Appendixcharakter) und Halbschluss bis hin zum Trugschluss reicht die Spannbreite schwächer werdender Schlusskraft. Für die aufführungspraktische Umsetzung bedeutet dieses ›Gefälle‹ in Analogie zur Interpunktion in der Sprache weniger ein dynamisches als vielmehr ein agogisch-artikulatorisches Moment: Die unterschiedlichen Kadenzwirkungen formen unterschiedlich starke Zäsuren aus, auf die der Interpret in seiner Phrasierung differenziert reagieren muss.
Harmonik und Metrik
Ein weiteres, umstrittenes Gebiet der Aufführungspraxis ist die Korrelation von Fundamentschritt und Taktmetrik, und zwar sowohl innerhalb des einzelnen Taktes als auch hinsichtlich der Gewichtung ganzer Taktgruppen. So versucht beispielsweise Simon Sechter, die metrischen Gewichtsabstufungen innerhalb eines Viervierteltakts mit den Qualitäten der Fundamentschritte in Übereinstimmung zu bringen. Der »entscheidendste« Schritt der fallenden Quinte markiert stets den Taktbeginn, der weniger »entscheidende« steigende Quintschritt ist dem Eintritt der dritten Zählzeit vorbehalten, und die »matten« Terzschritte haben ihren Platz auf den »schlechten« zweiten und vierten Taktzeiten.[91] Da solche systematischen, a priori erstellten Zuweisungen mit der Kompositionspraxis kaum in Einklang zu bringen sind, sei der Zusammenhang von Harmonik und Metrik innerhalb des Akzentstufentaktes auf wenige im 19. Jahrhundert allgemein anerkannten Grundsätze reduziert: Erstens bestimmt der harmonische Rhythmus die Metrik entscheidend mit; entsprechend sollte zweitens mindestens beim Taktübergang ein Harmoniewechsel erfolgen; und drittens werden tendenziell schwere Taktzeiten und insbesondere Finalklänge durch starke Schritte formuliert (diesbezüglich ist die Dominante leichter als die Tonika). Diese empirisch nachweisbaren Regeln verstehen sich als Folie bzw. idealtypische Konstruktion, vor deren Hintergrund Abweichungen erkannt und interpretiert werden können.
Schwieriger wird das Verhältnis von Harmonik und Metrik bei Ausdehnung des Metrikbegriffs auf ganze Taktgruppen. Dabei treten Widersprüche zwischen Taktgewicht und harmonischen Akzent bzw. »harmonischer Dynamik«[92] auf. Setzt man die empirisch belegbare und von den meisten Theoretikern des 18. und 19. Jahrhunderts bestätigte Tatsache[93] voraus, dass beim abschließenden Quintfall die Dominante leicht (U), die Tonika schwer (/) sei, so fällt bei Moritz Hauptmanns Übertragung des Akzentstufentakts auf die Achttaktperiode mit der Folge schwer-leicht der letzte, sehr leichte Takt mit einer schweren Schlusstonika (siehe die Zeile »harmonisches Gewicht«) zusammen:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hauptmann: | /// |
| / |
| // |
| / |
|
harmonisches |
|
|
|
|
|
| U D | / T |
Riemann: |
| / |
| // |
| / |
| /// |
Kadenz-Dynamik: | U / T crescendo S | U / D diminuendo T | ||||||
Abb. 26: Inkongruenz von Harmonik und Metrik bei Hauptmann und Riemann
Dagegen scheinen in Hugo Riemanns metrisch normativem Grundschema der auftaktigen Ordnung leicht-schwer metrisches und harmonisches Gewicht zusammenzustimmen. Berücksichtigt man jedoch Riemanns »natürliche Dynamik für Harmoniefolgen«, nach der »innerhalb der Tonart Wegbewegung von der Tonika als Steigerung crescendo fordert, Rückkehr zur Tonika dagegen diminuendo«[94] (siehe Abb. 20), so widerspricht dies der von Riemann selbst geforderten akzentuierten Schlusstonika (im Gegensatz zur auftaktigen Anfangstonika). »Harmonische Dynamik« (diminuendo) und harmonisch-metrisches Gewicht (schwer, akzentuiert) stehen sich gegenüber.
Der musikalisch durchaus fruchtbare, theoretisch aber prekäre Widerspruch von betontem Schlussakzent und dynamisch entspannender Lösungswirkung der Tonika wird durch Begriffe wie ›Tiefakzent‹ oder ›inneres Gewicht‹ (bzw. ›inneres Crescendo‹) entschärft, wenn nicht versöhnt. Gegenüber dem ›Hochakzent‹, der einen Kulminationsklang als Punkt höchster Intensität darstellt, gelangt bei einem ›Tiefakzent‹ die harmonische Bewegung zu ihrem Ziel und kommt dadurch zur Ruhe. Das erreichte Ziel hat den Akzent, der aber gleichzeitig durch ein Absenken des harmonischen Spannungsbogens als ›Tiefpunkt‹ gemildert wird. Der Kulminationspunkt liegt hier zwischen den Klängen; er wird als ›inneres Crescendo‹ »im Augenblick des Übergangs von D zu T, an der Taktgrenze«, erreicht.[95] Das ›innere Crescendo‹ nimmt dem äußeren Akzent die Schärfe, gleichzeitig steuert es einem spannungsmindernden Diminuendo entgegen.
Wie problematisch, darum aber auch fruchtbar, die Anwendung einer harmonischen Metrik bzw. metrischen Harmonik als theoretische Anschauungsform a priori auf die Praxis ist, zeigen folgende gegensätzliche Interpretationen des harmonisch-chiastischen Frage-Antwort-Modells am Beispiel der ersten vier Takte des ersten Satzes der Klaviersonate C-Dur op. 2 Nr. 3 von Ludwig van Beethoven:
| T | D | D7 | T | harmonischer Chiasmus |
Riemann: | U | / | U | / | metrischer |
Hauptmann: | / |
| / | U | Parallelismus |
Schnabel: | / |
| U | / | metrischer |
Brendel: | U | / | / | U | Chiasmus |
Abb. 27: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate C-Dur op. 2 Nr. 3, T. 1–4
Wie sehr der Satz, dass die Tonika gegenüber der Dominante schwer sei, von der formalen Funktion beider Akkorde abhängt, zeigt die erste, sich an Riemanns auftaktig-dynamischem Modell orientierende Auffassung. Der obige Satz erscheint in den ersten beiden Takten umgekehrt: Die Tonika ist leicht, die Dominante schwer. Denn es handelt sich hier um die Aufeinanderfolge zweier Schlussformeln, des Halb- und des Ganzschlusses, die beide ein Ziel bilden und damit einen Schwerpunkt formulieren. Bereits Marpurg konstatiert 1763, dass sowohl ganze als auch halbe Kadenzen »männlich seyen, und in Thesin fallen sollen.«[96] Diese Überlagerung des harmonischen Chiasmus (Umkehrung von T-D zu D-T) mit dem metrischen Parallelismus leicht-schwer – leicht-schwer zeigt auch das Akzentmodell nach Hauptmann mit der im Vergleich zu Riemann umgekehrten Folge schwer-leicht – schwer-leicht. Für Hauptmann »hat ein Erstes gegen sein Zweites die Energie des Anfangs und damit den metrischen Accent«; das Erste ist das »Bestimmende« und darum schwer, das Zweite ist das »Bestimmte« und darum leicht.[97] Das hat zur Folge, dass das leichte metrische Gewicht in den Takten 2 und 4, wie oben schon angedeutet, dem kadenzierenden Finalgewicht widerspricht. Betrachtet man allerdings den Notentext genauer, so wird die Auffassung nach Hauptmann sinnfälliger als die nach Riemann: Der Akzent des Anfangs wird im ersten und dritten Takt durch breitere rhythmische Werte (rechte Halbe, links Ganze) gewichtet, während die Takte 2 und 4 nur kurze, im Staccato leichte Viertel aufzuweisen haben, die weiblich enden und in Pausen münden; zudem erscheint im dritten Takt der einzige dissonante Akkord (Dominantseptakkord). In aufführungspraktischer Konsequenz könnte hier unterschieden werden zwischen metrischem Taktgewicht (T. 1 und 3) einerseits und (mehr inneren) »melodischem Nachdruck« (Polth) auf dem zweiten und vierten Takt andererseits[98], wohin die rhythmisch-melodische Bewegung der rechten Hand zielt. Metrisches Anfangsgewicht und zielgerichteter Spannungsverlauf bildeten zusammen eine Kombination des hauptmannschen mit dem riemannschen Ansatz.
Im Gegensatz zu den Theoretikern des 19. Jahrhunderts interpretieren zwei Praktiker des 20. Jahrhunderts (Schnabel und Brendel) den komponierten harmonischen Chiasmus auch als metrischen. Diese Deckungsgleichheit verblüfft ob ihrer Einförmigkeit, scheint sie doch die im oben aufgestellten Satz von der kontextunabhängigen Zuweisung, die Dominante sei leicht, die Tonika schwer, allzu wörtlich zu nehmen: Bei Schnabel ist die Tonika stets schwer, die Dominante immer leicht, bei Brendel umgekehrt. Alfred Brendel kritisiert in einem Gespräch mit Konrad Wolff die »metrische Artikulation« Schnabels nach dem »Prinzip Schwer-Leicht-Leicht-Schwer«[99] am oben angeführten Beethoven-Beispiel:
Außerdem hatte er [Schnabel] diese Vorliebe, innerhalb der Perioden ›leichte‹ und ›schwere‹ Takte zu identifizieren. Es gibt bei Ihnen [in Konrad Wolffs Buch Interpretation auf dem Klavier. Was wir von Artur Schnabel lernen[100]] ein Beispiel, das den Anfang von Beethovens Sonate op. 2/3 in das Schema Schwer-Leicht-Leicht-Schwer einordnet, was ich völlig absurd finde.
Warum sollte die Dominante leicht sein, die Tonika am Anfang und am Ende hingegen schwer? Wenn ich hier überhaupt etwas ›festlegen‹ wollte, wäre es das Gegenteil: ein Blick auf den Klaviersatz zeigt mir, daß die linke Hand im dritten Takt eine Dezime spielen muß. Diese ungewöhnliche Dezime markiert für mich den Höhepunkt der Phrase. Danach entspannt sie sich, denn bei aller Energie ist dieser Beginn doch auch gekennzeichnet durch eine gewisse kecke Grazie. Was Schnabel hier verlangt, wirkt auf mich forciert.[101]
Brendel wehrt sich gegen eine schematisch festgelegte Anwendung[102] und begründet seine gegenteilige Auffassung mit der haptischen Spannung der Dezime in T. 3, die den Höhepunkt der Phrase darstelle[103], und durch den musikalischen Charakter, dessen »kecke Grazie« die Energie des Anfangs, wie das Hauptmann nennen würde, nicht vertrage.
Die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Interpretationen zeigen, dass die komplexen Beziehungen zwischen Metrik und Harmonik sich nicht in simplifizierenden Thesen fassen lassen. Riemann ging einer satztechnischen Begründung metrischer Phänomene aus dem Weg, da dies die Gefahr einer Durchkreuzung des universellen Geltungsanspruchs seines ›normativen Grundschemas‹ bedeutet hätte – schon eher änderte er die Musik selbst (beispielsweise durch Verschiebung der Taktstriche des Originals) als seine Theorie.[104] Ginge man aber von einer satztechnischen Begründung aus, müssten mehrere, zum Teil miteinander konkurrierende Aspekte wie rhythmisch-metrische Akzente, melodische Höhepunkte, harmonische Spannungsverhältnisse und Vortragsbezeichnungen berücksichtigt werden.[105] Diese komplexe Wechselbeziehung fordert von jedem verantwortungsbewussten Interpreten eine adäquate analytische Auseinandersetzung mit dem musikalischen Kontext.
Schluss
Robert Schumanns vielzitierte Maxime aus den Musikalischen Haus- und Lebensregeln »Lerne frühzeitig die Grundgesetze der Harmonie« und weiter »Fürchte dich nicht vor den Worten: Theorie, Generalbaß, Contrapunkt etc.; sie kommen dir freundlich entgegen, wenn du dasselbe thust«, kann als Legitimation für den Theorieunterricht in Anspruch genommen werden. Freilich reicht es heute nicht mehr, die Hemmschwellen gegenüber der Musiktheorie abzubauen und auf ein freundliches Entgegenkommen des zu Erlernenden zu warten. Zu viele Schichten sowohl der Kompositions- als auch der Interpretationsgeschichte haben sich abgelagert und harren des (Wieder-)Entdeckens und Differenzierens. Theorie kann und will den Interpreten nicht bevormunden. Gleichwohl gilt es, zwischen abstrakter Theorie und künstlerischer Praxis zu vermitteln, um das Musizieren vor »blindem Praktizismus«[106] zu bewahren. Wie eine Transformation von musiktheoretischen Kenntnissen zu Zwecken der Aufführungspraxis realisiert werden könnte, wurde mit dem vorliegenden Beitrag im Hinblick auf das Verhältnis von Harmonik und Interpretation exemplifiziert: Die Bewusstmachung unreflektierter Traditionen ermöglicht eine Distanzierung von vermeintlichen Selbstverständlichkeiten und schafft damit die Voraussetzung für eine Interpretationsgeschichte, die prinzipiell so offen und unabschließbar ist wie das Kunstwerk selbst.
––– (2006a), »Logik und Ästhetik von Harmonie und Melodie«, in: Musikalische Logik und musikalischer Zusammenhang: Ein Symposion zur Musiktheorie und Ästhetik im 19. Jahrhundert, hg. von Patrick Boenke und Birger Petersen, Hildesheim u.a.: Olms (in Vorbereitung).
Anmerkungen
Der Begriff ›Aufführungspraxis‹ ist nicht auf die sogenannte ›Alte Musik‹ beschränkt, er soll vielmehr auf den performativen Aspekt von Interpretation hinweisen, um Verwechslungen mit der hermeneutischen Bedeutungsrichtung auszuschließen. | |
Vgl. Moßburger 2006a. | |
Vgl. Beethoven 1800. | |
Die Notwendigkeit satztechnischer Kenntnisse für die Aufführungspraxis zeigt sich besonders einleuchtend am Bedeutungswandel des »Tempo rubato«: war dieses noch für Daniel Gottlob Türk ein »Tonverziehen« (1789, 375) im Sinne einer »anticipatio« oder »retardatio« (ebd., 374), als synkopierende Verschiebung einer Stimme gegen eine andere ohne Veränderung des Tempos nur in Rücksicht auf eine korrekte Stimmführung möglich, so bedeutet dieser Begriff für Carl Czerny eine subtile Temponuancierung (»das willkührliche Zurückhalten oder Beschleunigen des Zeitmasses«, 1839, 31), die keine Stimmführungskenntnisse mehr voraussetzt. | |
Dahlhaus 1976, 370f. | |
Vgl. Danuser 1992, 271ff. | |
Bach 1753, 130. | |
Ebd. | |
Türk 1789, 350f. | |
Diese Klangbildungen sind bereits im Generalbassteil von C.Ph.E. Bachs Versuch (Teil 2, 1762) zu finden. | |
Krenek 1952, 16. Den Tritonus bezeichnet Krenek als »neutrales Intervall« (ebd., 17). | |
Quantz 1752, 227. | |
Ebd., 228f. | |
Ebd., 227f. | |
Ebd., 230. | |
Bereits um 1250 differenzierte Johannes de Garlandia in drei Dissonanzklassen (›perfekte‹: kleine Sekunde, Tritonus, große Sept; ›mittlere‹: große Sekund, kleine Sext; ›imperfekte‹: große Sext, kleine Sept) und zwar nach dem ästhetischen Kriterium der »Verträglichkeit« (für das Ohr) und nach der Auflösungseignung bei Halbtonanschluss in die Konsonanzen (vgl. Sachs 1990, 137–141). | |
Hindemith 1940, 144ff. | |
Krenek 1952, 31f. | |
Die große Wirkung der Quantzschen Vortragslehre zeigt sich, neben ihrer Vorbildfunktion für weitere »Versuche« von C.Ph.E. Bach (1753), Leopold Mozart (1756) und einer zweiten Auflage der Quantz’schen Flötenschule 1780 in Breslau, insbesondere darin, dass F.W. Marpurg den Quantzschen Abschnitt »Von den Clavieristen insbesondere« seiner dritten Sammlung Clavierstücke mit einem praktischen Unterricht für Anfänger und Geübtere beifügte. | |
Quantz 1752, 229. | |
Ebd., 230. Dem ausführenden Generalbassspieler stehen nach Quantz, neben der Differenzierung des Anschlags, folgende satztechnische Mittel der Realisierung zur Verfügung: die Lage bzw. der Abstand der Stimmen zueinander (»die dissonirenden Klänge, wenn sie nahe bey einander liegen, [klingen] viel härter, als wenn sie weit aus einander liegen«, ebd., 230), die Wahl der Stimmenanzahl und die Akkordbrechung: gegenüber dem Pianoforte, auf dem »alles erforderliche am allerbequemsten bewerkstelligt werden« kann, und auf dem Clavichord, dem es nur am »Fortissimo mangelt«, kann auf dem einmanualigen Cembalo »das Piano durch einen gemäßigteren Anschlag, und durch die Verminderung der Stimmen das Mezzo forte durch Verdoppelung der Octaven im Basse; das Forte durch eben dieses, und wenn man noch in der linken Hand einige zum Accorde gehörige Consonanzen mitnimmt; das Fortissimo aber, durch geschwinde Brechungen der Accorde von unten herauf, durch eben diese Verdoppelung der Octaven, und der Consonanzen, in der linken Hand, und durch einen heftigern und stärkern Anschlag, hervorgebracht werden« (ebd., 230f.). | |
Quantz 1752, 227. | |
Wie ernst Quantz es mit seiner dynamischen Ausführungsanweisung meint, zeigt das von ihm vorgeschlagene Hörexperiment, das »Probestück« doch einmal ohne dynamische Differenzierung zu spielen, dabei aber dennoch auf die Dissonanzen, die Trugschlüsse oder die chromatischen Töne zu achten, deren eigentliche Dynamik man unwillkürlich-gefühlsmäßig auch ohne Bezeichnung »sehr leicht wird errathen können« (ebd., 228). | |
Czerny 1839, 9. | |
Ebd., 26f. | |
Vgl. Moßburger 2005, 383ff. | |
Hoffmann 1921, 115 | |
Danuser 1992, 16. | |
Adorno 1946–1959, 87. | |
Ebd., 109f. | |
Danuser 1992, 17. | |
An anderer Stelle versteht Adorno die Dissonanz als etwas, das »dem Trug der bestehenden Harmonie den Glauben verweigert« (1956, 13). | |
Adorno weist relativierend auf seine ›Regel‹ für die Praxis hin: »Die Regel, gegen das Schema zu musizieren, das Subkutane herauszubringen, schlechte Taktteile, Dissonanzen zu spielen usw. darf nicht mechanisch-undialektisch aufgefasst werden. Denn das Schema war der traditionellen Musik nicht nur äußerlich, und je größer sie war, um so weniger äußerlich war es. Vielmehr war es konstitutiv und hat die Gegenkräfte selbst mitgezeitigt. Das heißt aber: sie war ein Spannungsfeld […]. Die Interpretation muß dies Kraftfeld aktualisieren. Also nicht nur die Dissonanzen spielen und die Konsonanzen fallen lassen, sondern die Spannung zwischen beidem nach Maß des kompositorischen Sinnes realisieren. Man muß die Konsonanzen, die guten Taktteile, die Grundzählzeiten durchfühlen – nur in Relation zu ihnen lebt das andere« (1946–59, 106). | |
Hindemith 1940, 145. | |
Ebd., 144f. | |
Ebd., 146. | |
Quantz 1752, 229. | |
Riemann 1884, 171–190. | |
Hindemith 1940, 146. | |
Krenek 1952, 16. Vgl. Türks Aufgliederung in »Harmonien, welche stark dissoniren« und in solche, die »weniger dissonirend« sind (1789, 351). | |
Ebd., 33. Vgl. zum Kriterium der »Lage der Intervalle« auch Quantz 1752, 230. | |
Ebd, 34. | |
Bernhard 1660, 77 (Cap. 29). | |
Werckmeister 1707, 87. | |
Sulzer 1771, 474. | |
Bach 1753, 130. | |
Vgl. z.B. Beethovens Klaviersonate G-Dur, op. 14 Nr. 2, 2. Satz, T. 17–19. | |
Vgl. außer Bach 1753 auch Quantz 1752, 228, Sulzer 1771/74, 702, und Türk 1789, 337. | |
Hoffmann 1820/22, 338. | |
Sulzer 1774, 67. | |
Koch 1802, 868. | |
Sulzer 1774, 71. | |
Hoffmann 1921, 123f. | |
Sechter 1854, 218. | |
Koch 1802, 863. | |
Sechter 1854, 218. | |
Stephani 1927, 84. | |
Moßburger 2006b. | |
Kirnberger 1774, 18f. | |
Sulzer 1774, 68. | |
Vgl. Moßburger 2006a. | |
Rousseau 1776/77, 182f. | |
Lindley 1987, 296. | |
Rameau 1731/36, XXXVIf. Für die Übersetzung ins Deutsche danke ich Thomas Fesefeldt. | |
Bach 1753, 130. | |
Hugo Riemann fasst dies zusammen: »Die eigentliche Enharmonik ist immer mehr oder weniger eine Irreleitung des Ohres, die wohl gelegentlich mit gutem Effekt möglich ist, keinesfalls aber als selbstverständliches Mittel für alle Fälle parat gehalten werden darf« (1918, 121). Die Rezeptionskonstante des »Trügerischen« der Enharmonik geht aus von der temperierten Gleichsetzung zweier in reiner Stimmung an sich verschiedener Tonhöhen. Dies wurde seit dem 17. Jahrhundert als akustischer »Betrug« aufgefasst und ist in folgenden Ausdrücken überliefert: »dem Gehöre Mäuse-Dreck für Pfeffer verkauffen« (Printz 1678, 89); »Täuschung des Gehöres« (Kirnberger 1771, 18f.), »kleiner Betrug« (Koch 1802, 863f.), »kindisches Vexierspiel« (Hoffmann 1820/22, 49), »der äußere Schein nur zum Truge Gelegenheit gibt« (Sechter 1854, 212), »Unwahres«, existiert »eben nur im trüben Elemente der Ungenauigkeit temperierter Intonation« (Hauptmann 1853, 187f.), »die trügerischen Mittel der Enharmonik« und »Irreleitung des Ohrs« (Riemann, 1902, 484 bzw. 1918, 121). Unter wechselnden historisch-ästhetischen Bedingungen wurde dieses feststehende theoretische Phänomen unterschiedlich interpretiert: vom »heftig erregten Affekt« (Bach 1753, 130) über »eine geheimnisvolle und überraschende Wirkung« (Sechter, 1853 I, 218) bis hin zur psychologischen Deutung des »Krisenhaft-Zwiespältigen«, »seelisch-Konflikthaltigen« (Stephani 1927, 83–85) im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. | |
Vgl. Polth/Schwind 1996, Sp. 274. | |
Sulzer 1771, 435. Auch um 1900 wird der Trugschluss noch als »ein Mittel der Steigerung« (Louis/Thuille 1907, 106) mit einer »sehr starken Wirkung« (Schönberg 1911, 161) erkannt. Bei Schönberg trägt auch der »überstarke« Sekundschritt von der V. zur VI. Stufe zur Wirkung bei. | |
Riemann 1919, 137. Auch die Alteration der kleinen (phrygischen) Sext (bzw. Sekund) erhält nach traditioneller Vortragslehre als chromatischer Ton einen Akzent (vgl. die musikalisch-rhetorische Figur der »Pathopoeia«). | |
Adorno 1993, 88. | |
Riemann 1887, 75f. | |
Riemann 1919, 78. | |
Zitiert nach Riemann 1886, 177. | |
Ebd. | |
Kurth 1923, 269f. »Die leuchtenden mediantischen Schritte erscheinen bei Wagner (wie namentlich auch bei Liszt, Bruckner und Hugo Wolf) in Symbolisierung hoher Weihe« (ebd., 272). Dagegen beschreibt Kurth die »grelle chromatische Rückung« mit ihrem »unheimlichen Aufleuchten« als »Todesmotiv«: »der Eintritt vom A-Dur nach dem As-Dur-Dreiklang ist ein Effekt, der eine Art scharfer Reibungswirkung birgt; es ist, als wäre die harte Dissonanzreibung einer kleinen Sekunde auf das Phänomen der Klangfortschreitung übertragen und zu klangsinnlicher Macht vergrößert« (ebd., 266). | |
Adorno 1946–1959, 147. | |
Ebd., 109f. | |
Ebd., 109. | |
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass bereits Hugo Riemann die Bemerkung in A.F. Christiani’s »Das Verständnis im Klavierspiel« von 1886 für »gut« befand, »dass man vor direkten Tonartenwechseln (ohne Modulation) ritardiren und vor dem Einsatz der neuen Tonart pausiren sollte« (Riemann 1886, 163). | |
»[…] bei der Modulation im Seitensatz [aus Beethovens Ouvertüre zu Egmont], wo er um der Perspektive willen ausspielen lassen müsste, hastet er [der Dirigent Bruno Walter] aus Angst vorm rhythmischen Stillstand weiter« (Adorno 1946–1959, 110). Adorno meint wohl die Takte 90–100, in denen eine chromatisch-enharmonische Modulation mit der Mollsubdominante auftritt, wobei er die harmonische Raumwirkung der sich von der Seitensatztonart As-Dur weit abhebenden A-Dur-Entrückung perspektivisch verdeutlicht (»ausgespielt«) haben möchte. | |
Noch Riemann erkennt dies an: »Vortrefflich ist Christianis Kapitel über die zu accentuierenden Modulationsnoten; er giebt da einen sehr richtigen Hinweis, dass diejenige Note, welche die Modulation entscheidet (in der Regel der Leitton der neuen Tonart) womöglich ausgehalten und mit ihrer Auflösung verbunden werden sollte, jedenfalls aber hinlänglich accentuiert, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken« (1886, 163). | |
Die Modulationstheorie nach Riemann würde hier gar eine retrospektive enharmonische Umdeutung des verminderten Septakkords (der Leitton fis wird zur None ges) ›vornehmen‹, und damit eine funktionale Verbindung konstruieren, die der Auffassung zur Zeit Türks fremd war. | |
Czerny 1839, 28f. | |
Eine allgemeine Gültigkeit beanspruchende Regel stellt Hugo Riemann auf, allerdings nicht für den Tonartenübergang selbst, sondern für den großformalen Tonartenverlauf hinsichtlich der prinzipiellen Differenz von Weg- und Rückmodulation: »Der Rückgang ist etwas ganz anderes als die Modulation. Diese zwingt uns von der Haupttonart weg, ist ein Gewaltakt; der Rückgang geleitet uns nach Hause, ebnet uns den Weg, den wir gern gehen; daher das sanfte, oft geradezu Rührende des Rückgangs, daher auch das Gesetz des Diminuendo für denselben, während Modulation crescendo erfordert« (1887, 80). »Die Modulation in eine fremde Tonart [bedingt] crescendo, Rückmodulation (wenn auch nur zuletzt) diminuendo« (1886, 148). | |
Selbst der Dogmatiker Moritz Hauptmann gibt zu bedenken, dass »die Folge consonanter Harmonie an sich noch ohne Bestimmung für die metrische Stellung ihrer Folgeglieder« sei (1853, 355). | |
Die Finalis-Stufe der Kadenz selbst ist ihrerseits einer Rangfolge unterworfen (Clausula primaria, secundaria, tertiaria). | |
Sechter 1854, 19. | |
Schönberg 1911, 135–139. | |
Schönberg 1957, 6f. Schönberg ersetzt hier das Begriffspaar »stark-schwach« durch »steigend« bzw. »fallend«, da seiner Meinung nach »Schwäche […] eine Eigenschaft [ist], die in einem künstlerischen Gebilde keinen Platz hat«. | |
Schönberg relativiert die Verwendung des eigentlich theoretisch »stärksten Fundamentschritts« (Sekundschritt) als »für den Alltagsgebrauch zu stark: Allzu scharf macht schartig« (1911, 136 u. 138). | |
Vgl. Grandjean 1998, 159–161. | |
Riemann 1886, 184. | |
Vgl. Grandjean 1998, 164. | |
Riemann 1886, 148. | |
Dahlhaus 1974, 186. In diesem Sinn kann auch Wilhelm Malers Beschreibung der Grundkadenz T-S-D-T gedeutet werden: Zwar werde die Kadenz von der »äußeren Identität von Ausgangs- und Schlussklang« begrenzt und zusammengehalten; »in ihrem inneren Gewicht [Unterstreichung Maler] jedoch unterscheidet sich der erstere durch sein Verlangen nach der S erheblich von dem von der D verlangten letzteren: Die Ausgangs-T ist aktiv, die Schluß-T ist passiv.« (1931, 3) | |
Marpurg 1763, 28. | |
Hauptmann 1853, 241. | |
Zur Unterscheidung von metrischem Akzent und melodischem Nachdruck vgl. auch Polth 2000, 113ff. | |
Brendel 1995, 249. | |
Ebd., 248 Anm. 104. | |
Ebd., 251. | |
Er weist Widersprüche zwischen dem »Schnabel-Prinzip« und der kompositorischen Intention an anderen Beispielen konkret nach (ebd., 249f.). | |
Brendel setzt der Metrik der Taktgewichte seine bogenförmige Phrasenbildung entgegen: »Eine Phrase ist oft wie eine Kurve, wie eine Brücke, die hier unten beginnt, sich hinaufwölbt und dort unten wieder ankommt. Was mich an einer Phrase interessiert, ist weniger das Zählen von Taktstrichen oder das Anzeigen ihrer Bestandteile als das Gesamtbild, die gerundete Figur« (ebd., 249). Brendel geht sogar soweit zu behaupten, dass für ihn »die Kunst des Phrasierens oft gerade im Ignorieren des Taktschemas und in der Schaffung größerer Zusammenhänge« besteht. Es komme für ihn z.B. in Bezug auf den Beginn von Schuberts Klaviersonate B-Dur »darauf an, so zu spielen, als sei das Thema schon eine Weile dagewesen. Die Musik hat schon angefangen, und man setzt sich hin und führt etwas fort. Keinerlei Betonung des Auftakts; wie das Thema ›organisiert‹ ist, wird nicht verraten. So klingt es, wie mir scheint, nur noch geheimnisvoller.« (ebd., 250) | |
Dahlhaus 1989, 186–188. | |
Bereits Jacob Gottfried Weber weist auf die Bedingtheit der Wirkung von Akkordverbindungen durch ihren musikalischen Kontext hin. Als solche »Umstände« nennt er das Tempo, die Akkordstellung, Liegetöne, Metrum, Dynamik und Instrumentation, Einbindung in Sequenzen, formale Zäsur, Mehrdeutigkeit, Stimmführung, harmoniefremde Töne und »durchgehende oder Scheinakkorde« (1824, 185–196). | |
Dahlhaus 1984, 54. |
Literatur
Adorno, Theodor W. (1946–59), Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei Schemata, hg. von Henri Lonitz, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2001.
––– (1956), Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, 7. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991.
––– (1993), Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Bach, Carl Philipp Emanuel (1753–62), Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin, Reprint Kassel: Bärenreiter 1994.
Beethoven, Ludwig van (1800), Brief vom 15.12.1800 an Friedrich Hofmeister, in: Ludwig van Beethoven – Briefwechsel Gesamtausgabe, Bd. 1, 1783–1807, hg. von Sieghard Brandenburg, München: Henle 1996.
Bernhard, Christoph (1660), »Tractatus compositionis augmentatus«, in: Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fassung seines Schülers Christoph Bernhard, hg. von Joseph Müller-Blattau, 3. Aufl. Kassel: Bärenreiter 1999.
Brendel, Alfred (1995), »Artur Schnabels Interpretationslehre. Ein Gespräch mit Konrad Wolff«, in: ders., Musik beim Wort genommen. Über Musik, Musiker und das Metier des Pianisten, 2. Aufl. München, Mainz: Piper, Schott.
Czerny, Carl (1839), Von dem Vortrage. Dritter Teil aus Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule op. 500, Wien, Faksimile-Nachdruck, hg. und mit einer Einleitung versehen von Ulrich Mahlert, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1991.
Dahlhaus, Carl (1974), »Zur Kritik des Riemannschen Systems«, in: Ernst Apfel und Carl Dahlhaus, Studien zur Theorie und Geschichte der musikalischen Rhythmik und Metrik, Bd. 1, München: Katzbichler.
––– (1976), »Der Dirigent als Statthalter«, Melos/NZfM 2, 370–371.
––– (1984), Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Erster Teil: Grundzüge einer Systematik, (= Geschichte der Musiktheorie 10), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
––– (1989), Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Zweiter Teil: Deutschland (= Geschichte der Musiktheorie 11), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Danuser, Hermann (1992), Musikalische Interpretation (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft 11), hg. von Hermann Danuser und Carl Dahlhaus, Laaber: Laaber.
Grandjean, Wolfgang (1998), »Harmonik und Metrik. Simon Sechters ›Gesetze des Taktes‹«, Musiktheorie 13/2, 159–161.
Hauptmann, Moritz (1853), Die Natur der Harmonik und der Metrik, Leipzig: Breitkopf und Härtel, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 2002.
Hindemith, Paul (1940), Unterweisung im Tonsatz, Bd. 1, 2. Aufl., Mainz: Schott.
Hoffmann, E.T.A. (1820/22), Lebensansichten des Katers Murr, München: Winkler 1884.
––– (1921), Musikalische Novellen und Aufsätze, Bd. 2, hg. von Edgar Istel, Regensburg: Bosse.
Kirnberger, Johann Philipp (1771), Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin und Königsberg: G. J. Decker und G. L. Hartung, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1988.
Koch, Heinrich Christoph (1802), Musikalisches Lexikon, Frankfurt a.M.: August Hermann d.J., Reprint Bärenreiter 2001.
Krenek, Ernst (1952), Zwölfton-Kontrapunkt-Studien, Mainz: Schott, orig. als Studies in Counterpoint, New York: Schirmer 1940.
Kurth, Ernst (1923), Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners ›Tristan‹, 3. Aufl., Berlin: Max Hesse, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1985.
Lindley, Mark (1987), »Stimmung und Temperatur«, in: Hören, Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit (= Geschichte der Musiktheorie 6), hg. von Frieder Zaminer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 109–331.
Louis, Rudolf / Ludwig Thuille (1907), Harmonielehre, 9. Aufl. Stuttgart: Klett 1925.
Maler, Wilhelm (1931), Beitrag zur durmolltonalen Harmonielehre, Bd. 1, 13. Aufl. München: Leuckart 1984.
Marpurg, Friedrich Wilhelm (1763), Kritische Briefe über die Tonkunst, Bd. 2, Berlin: Birnstiel, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1974.
Moßburger, Hubert (2005), Poetische Harmonik in der Musik Robert Schumanns, Sinzig: Studio.
––– (2006b), »Vom ›schönsten Tongeschlecht‹ zum ›unisonierenden Dualismus‹. Zur Ästhetik akustischer, funktionaler und visueller Enharmonik«, in: Bericht über den VI. Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie Weimar 2006, hg. von Klaus Heiwolt, Hildesheim u.a.: Olms (in Vorbereitung).
Polth, Michael (2000), Sinfonieexpositionen des 18. Jahrhunderts. Formbildung und Ästhetik, Kassel u.a.: Bärenreiter.
––– / Elisabeth Schwind (1996), »Klausel und Kadenz«, in: Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. hg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 5, Kassel: Bärenreiter, Sp. 256–282.
Printz, Wolfgang Caspar (1678), Phrynis Mitilenaeus oder Satyrischer Componist, 3 Bde., Dresden und Leipzig 1696, Mikrofiche, Leiden: IDC. http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00002473/images/
Quantz, Johann Joachim (1752), Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin: Johann Friedrich Voß, Reprint Kassel u.a.: Bärenreiter 2000.
Rameau, Jean-Philippe (1731/36), Remarques sur les pieces de ce livre et sur les différens de musique, in: Oeuvres Complètes. Publiées sous la Direction de C. Saint-Saëns Tome I. Pièce de Clavecin, Paris 1895: Durand.
Riemann, Hugo (1884), Musikalische Dynamik und Agogik. Lehrbuch der musikalischen Phrasierung, Hamburg: Rather.
––– (1886), »Die Lehre vom musikalischen Vortrag in der neuesten Literatur« mit Nachtrag »Professors Franz Kullak’s Ideen zur Theorie des musikalischen Vortrags«, in: Präludien und Studien II, Leipzig und Frankfurt a.M.: Bechhold 1900, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1967, 140–189.
––– (1887), Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre, Hamburg: Richter.
––– (1902), Große Kompositionslehre, Berlin und Stuttgart: W. Spemann.
––– (1919), Elementar-Schulbuch der Harmonielehre, 3. Aufl., Berlin: Hesse.
––– (1918), Handbuch der Harmonie- und Modulationslehre, 6. Aufl., Berlin: Hesse.
Rousseau, Jean-Jacques (1776/77), »Lettre à M. Burney et Fragment d’observations sur l’Alceste de Gluck, Extrait d’une réponse du petit faiseur sur l’Orphée de Gluck«, in: Jean-Jacques Rousseau, Musik und Sprache. Übersetzt von Dorothea Gülke und Peter Gülke, Wilhelmshaven: Heinrichshofen 1984.
Sachs, Klaus-Jürgen (1990): »Musikalische Elementarlehre im Mittelalter«, in: Rezeption des antiken Fachs im Mittelalter (= Geschichte der Musiktheorie 3), hg. von Frieder Zaminer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 105–161.
Schönberg, Arnold (1911), Harmonielehre, Wien: Universal-Edition.
––– (1957), Die formbildenden Tendenzen der Harmonie, aus den Englischen übertragen von Erwin Stein, Mainz: Schott.
Sechter, Simon (1853/54), Die Grundsätze der musikalischen Komposition, Bde. 1 und 2, Leipzig: Breitkopf & Härtel.
Stephani, Hermann (1927), »Enharmonik (›Polare Harmonik‹) bei Beethoven«, in: Internationaler Musikhistorischer Kongress Wien, 26. bis 31. März 1927, veranstaltet von Bund und Stadt, Wien: Universal-Edition, 83–87.
Sulzer, Johann Georg (1771/1774), Allgemeine Theorie der schönen Künste, 2 Bde., Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1970.
Türk, Daniel Gottlob (1789), Klavierschule, Leipzig und Halle: Selbstverlag, Reprint Kassel u.a.: Bärenreiter 1997.
Weber, Jacob Gottfried (1824), Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst, 2. Aufl., Mainz: Schott.
Werckmeister, Andreas (1707), Musicalische Paradoxal-Discourse, Quedlinburg: Theodor Phil. Calvisius 1707, Reprint Hildesheim u.a.: Olms 1972.
Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.